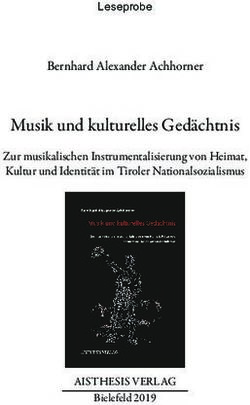SCHAFE IN TIROL Ein Haustier zwischen Wirtschaft und Kult(ur)
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
[Wissenswertes 3. Quartal 2022]
SCHAFE IN TIROL
Ein Haustier zwischen Wirtschaft und Kult(ur)
von Franz Jäger
Seit Jahrhunderten sind Schafe ein unbedingter Teil unserer Berg-
Landwirtschaft. Wolle und Fleisch prägten die Lebenshaltung, wie
einige Beispiele aus der Vergangenheit zeigen. Aus dem Jahre 1415
liegt z.B. ein Vertrag zwischen den Bauern von Vent und Schnals vor,
in dem sie Weiderechte für ihre Schafe aus dem Süden vereinbarten.
In den 1990er Jahren stießen Archäologen im Fineiltal im Schnalstal
auf 2.460 m Seehöhe auf einen Opferplatz aus der ausgehenden
Spätbronzezeit (1350-1200 v. Chr.). Schaf- und Ziegenknochen und ein
Webgewicht weisen neben anderen Fundstücken auf eine üppige
Wollproduktion hin.1 Nach Eva Lechner wurden die Hochlagen seit
4000 v.Ch. beweidet.2 Otto Stolz bezifferte für das Jahr 1782 z.B. den
Schafbestand im Gericht Virgen mit 1.306 Tieren.3 Der Mensch ist den
Schafen im alpinen Raum gefolgt, sie suchten Wege und Übergänge.
Schafe und Wirtschaft
Ein Blick in die Statistik über Schaf- und Betriebsmengen in Tirol zeigt in den letzten Jahrzehnten ein
wechselvolles Bild. Für das Jahr 2021 weist die Statistik Austria für Tirol 84.379 Schafe und 2.815 Betriebe
aus. Diese Zahlen schließen Zucht- und Nutztiere ein.
Schafrassen werden u.a. nach dem Vlies/ Wolltyp und dem Verwendungszweck (Anpassung an die
unterschiedlichen klimatischen Bedingungen) eingeteilt. Man unterscheidet Bergschafe, Landschafe,
Milchschafe und Fleischschafe. Zu den gängigsten Schafrassen zählen das Tiroler Bergschaf (besondere
Alptüchtigkeit, verbreitetste Rasse in Österreich), das Braune Bergschaf (besonders widerstandsfähig und
an das raue Hochgebirgsklima angepasst) und das Tiroler Steinschaf (älteste Rasse in Tirol, stark
gefährdet), dahinter reihen sich mit geringeren Anzahlen das Tscheggenschaf und Walliser
Schwarznasenschaf ein. Jede Rasse hat besondere, für den alpinen Raum nützliche Eigenschaften.
Alm- und Gemeinweiden
Seit alters her verlangte eine rentable Schafzucht eine möglichst kurze Stallfütterung im Winter; dies
erforderte eine jahreszeitlich frühe Weidemöglichkeit nach den kalten Monaten und lange Spätweiden im
Herbst, denn eine Stallfütterung wäre gegenüber dem Ertrag der Schafzucht zu aufwendig gewesen. Josef
Gstrein machte schon in den 1930er Jahren die Erfahrung, dass sich die Schafzucht nicht rentiere, wenn
nicht genügend Weidegelegenheiten vorhanden sind. „Die Schafe sind ein vielfressendes Vieh, im Stalle
gefüttert brauchen sie in kurzer Zeit mehr als sie wert sind.“4 Ein Spruch im Paznauntal sagt ähnliches aus:
Für die Ziegen gilt: halt mich warm und füll den Darm - für die Schafe: führ mich aufs Eis und füttere mit
Fleiß. Den Mangel an Winterfutter für die Schafe glichen Schafbauern früher dadurch aus, dass das im
Sommer gewonnene, gewaschene und getrocknete Jätgras, gedörrte Kartoffelkräuter, Heu, das Rinder
nicht fraßen und Laub verschiedener Bäume gefüttert wurden5. Einer möglichst kurzen Stallfütterung
kamen örtliche Regelungen für Heimweiden entgegen; sie bestimmten inwieweit Schafe z.B. im Frühjahr
oder Herbst auf fremden Wiesen allgemein geweidet werden dürfen. Oft war dies bis Ende April und im
Herbst ab Almabtrieb möglich. In Heilig Kreuz bei Vent mussten z.B. die Kartoffeln bis 1. Oktober geerntet
sein, weil ab diesem Zeitpunkt die Schafe auf den Feldern geweidet werden konnten.6 Für die Beweidung
1
Vgl. Andreas Putzer, Von Bernstein und Hirtinnen – Prähistorische Weidewirtschaft im Schnalstal in Südtirol, in: Archäologisches
Korrespondenzblatt, Nr. 42, Mainz 2012, S. 165.
2
Vgl. Eva Lechner: Das Buch von den Schafen in Tirol. Kultur-Wirtschaft-Tradition, Innsbruck 2002, S. 6.
3
Vgl. Otto Stolz: Geschichte von Osttirol im Grundriß, in: Osttiroler Heimatblätter, Heft 1, Jänner 1925, S.2-4, hier S. 3.
4
Vgl. Gstrein, Franz, Josef: Die Bauernarbeit im Oetztale einst und jetzt, Innsbruck 1932 S. 41.
5
Vgl.: Müller, Hubert: Das Dorfbuch von Antholz, Antholz, 1985, 0.S.
6
Interview mit Alois Reinstadler, geb. 1942, Roppen Kalkofenweg, vom 17. 12. 2020.
www.tirol.gv.at/kunst-kultur/kulturportal/museumsportal/spielen viele Einzelheiten eine Rolle, wie Behirtung, Markierung der Schafe, Schellen, Auftriebsrituale usw.
In diesem Zusammenhang kann die Bedeutung der Alm-Weiden nicht genug unterstrichen werden, hat die
Beweidung der Berghänge ja auch Auswirkungen auf Lawinenschutz...
Hirten und ihre Schafe
Im Zuge des „Wolfsmanagements“ wird häufig die Forderung nach einer
„Hirtenausbildung“ in den Raum gestellt. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt,
dass Kleinvieh, wie Ziegen und Schafe, häufig der Hirtenschaft von Kindern
anvertraut wurde. Sie lernten aus Erfahrung die Eigenheiten der Tiere und
deren Verhalten in gewissen Situationen kennen. Aber vielfach mussten auch
die Schafbesitzer je nach Anzahl ihrer aufgetriebenen Tiere entsprechend viele
Tage eine Herde selbst behirten. Öfters übernahmen Kinder einer Familie
gegen eine Entschädigung das Hirtenamt für andere Schafbesitzer. In diesem
Zusammenhang darf auf die Geschichte der „Schwabenkinder“ verwiesen
werden. Seit dem dreißigjährigen Krieg bis in die 1920er Jahre sandten
Familien des Tiroler Oberlandes ihre Kinder während der Sommermonate als
Hirtenkinder in das Schwabenland aus. Karl Höllrigl bekleidete im Pitztal mit
Begeisterung sein Leben lang das Hirtenamt. Schon als Kind war ihm eine
Schafherde anvertraut7. In der Gegenwart stößt die Bestellung ständiger Hirten
vermutlich auf finanzielle Grenzen.
Nutztiere und Zuchttiere
Wurden in der Vergangenheit Schafe vorwiegend zur Wollgewinnung
gehalten, hat nun die Produktion von Lammfleisch (Milchlamm, jünger
als ein Jahr) einen finanziellen Anreiz geschaffen. Ein wichtiger Zweig
der allgemeinen Schafhaltung ist jedoch die Schafzucht als kontrollierte
Fortpflanzung, dzt. gibt es in Tirol zehn Schafrassen mit Zucht. Sie
garantiert die genetische Sicherung und Weiterführung einer Schafrasse
(Erhaltungszucht). Dafür sind Erfahrung, ein gutes Auge (denn jedes
Tier ist anders) und die Beobachtung der Genetik entscheidend.
Zuchttiere bedürfen einer entsprechenden Fütterung und zur Sicherung
der Genetik muss in gewissen Zeitabständen der Widder ausgetauscht
werden. Eine erfolgreiche Züchtung kann auch finanziell interessant
sein.8 Werden Tiere von Schafbauern für eine Züchtung vorgesehen,
erfolgt durch Fachleute eine Vorbegutachtung. Für Tiere, die für eine
Züchtung nicht geeignet sind, ist die Fleisch- und Wurstverwertung
bestimmt. Ausstellungen, in denen Zuchttiere in verschiedenen Klassen
begutachtet und deren Züchter allenfalls mit Preisen bedacht werden,
fördern Qualität und Ehrgeiz der Züchter. Über die Landesgrenzen hinaus bietet eine Schafschau
„Bergschaf-Interalpin“ Gelegenheit Zuchterfolge zu vergleichen.
Wolle und Verarbeitung - Frauenarbeit
Die Schaf-Schur im Frühjahr und Herbst erfolgte früher in aufwendiger
Handarbeit mit speziellen „Scheren“. Der Scherer musste sich dafür durch
Übung besondere Fertigkeiten aneignen - der Pelz sollte nicht zu hoch
geschnitten werden, zudem bedurfte der Scherer einer besonderen
Sorgsamkeit, damit das Schaf durch die Scherenschnitte nicht verletzt wurde.
In der Gegenwart überwiegt eine maschinelle Schafschur durch
Professionisten, die sich sogar in Meisterschaften in Geschwindigkeit und
sauberes Arbeiten messen.
Gegenüber vergangener Jahre kann nun für Schafwolle ein besserer Preis
erzielt werden, der allerdings von der Qualität abhängt. Es konnten nämlich
neben bekannten Wollprodukten, wie Loden, der in der Bekleidungsindustrie
wieder salonfähig gemacht wurde, neue Verwendungszweige eröffnet werden,
z.B. Schafwollpellets für die Blumendüngung, Wolle für Dämmstoffe und feine
7
Interview mit Karl Höllrigl, geb. 1933, Zaunhof 21, vom 8. 8. 2010.
8
Vgl. Interview mit Johann Jaufenthaler, Zuchtleiter für Ziegen- und Schafzucht vom 5. Mai 2022, geb. 1958, Mutters, Dorfstrasse
28. - Bei der Frühjahrsversteigerung im März in Osttirol wurde für einen Zuchtwidder ein Erlös von 9.560.-Euro netto erzielt. –
siehe: Osttiroler Bote, 24. März 2022, S. 9.
www.tirol.gv.at/kunst-kultur/kulturportal/museumsportal/Wollprodukte. Diese Linien verfolgen moderne Betriebe für Wollverwertung und Wollnutzung, wie z.B. der Verarbeitungsbetrieb „Villgrater Natur“ in Innervillgraten. Die Firma Regensburger in Umhausen („Ötztaler Schafwollzentrum“) wäscht jährlich 250 Tonnen Wolle für mitteleuropäische Betriebe. Daneben werden aus kardierter/gekämmter Wolle Teppiche (in Sondergrößen auf Bestellung) gewebt und Filzwolle in 90 verschiedenen Farben (10 Natur-, 62 Farbtöne, 20 Farbmelierungen) produziert.9 Die Wollverarbeitung, vom Waschen über Kartatschen, Spinnen, Stricken und Weben war in der Vergangenheit Aufgaben der Frauen. Wollartikel deckten nämlich die Kleidung der Bevölkerung, über den Eigenbedarf hinaus konnten mit guter Handarbeit Einkünfte erzielt werden. So trugen Strickwaren im Passeiertal zum Lebensunterhalt bei, wie es Beda Weber beschreibt. „Die Weiber und Mädchen des Thales sind eifrige Strumpfstrickerinnen aus dichtem Wollfaden für Landleute. Ueberall haben sie das Gestricke in den Händen, selbst die Trägerinnen, wenn sie nicht allzu schwer belastet sind.“ Besonders im hinteren Tal „nimmt dieser Eifer zu.“ Waren, die nicht dem Eigenbedarf zukommen, werden außerhalb des Tales verkauft. Dort fand „die feste und billige Ware guten Absatz“. Mädchen verdingten sich im Etschtal zudem als Spinnerinnen, wo sie neben sparsamer Kost 3-6 Kronen pro Woche verdienten.10 Im Paznauntal, speziell in Kappl, trugen Strickereien der Frauen als Verdienst- möglichkeiten zur Linderung der Not des Bergbauernstandes bei. Daraus entwickelte sich eine einträgliche „Hausindustrie“, aus der letztlich das immer noch bestehende „Tiroler Heimatwerk“ hervorging. Frauen aus Kappl erhielten an einer Verteilungsstelle die Wolle und lieferten dort gegen sofortige Bezahlung des Lohnes die fertige Ware ab. 1959 kamen dem Paznauntal immerhin gegen 350.000 Schilling an Stricklöhnen zu11. Zum Stricken und Spinnen gesellten sich die Frauen an den Abenden in den Bauernstuben zusammen, „sie strickten schon wegen der Unterhaltung gerne.“ In vielen Bauernhöfen standen Webstühle, mit denen die eigene Wolle zu verschiedenen Produkten verarbeitet werden konnte. Organisation Tierzucht fällt in Österreich in die Zuständigkeit der Länder, daher gibt es in jedem Bundesland einen Schafzuchtverband, der für die Zucht und administrative Aufgaben der Schafhaltung verantwortlich ist. In Tirol feierte der Verband bereits sein 80jähriges Bestandsjubiläum, er nennt sich jetzt Schaf- und Ziegenzucht Tirol eGen https://www.schafundziege.tirol/. Dort ist die Verwaltung der Schafhaltung konzentriert. Die Genossenschaft übernimmt z.B. die Registrierung der Schafe, dort sind nach der „Lammung“ Zucht- und Nutztierlämmer zu melden und mit einer Ohrnummer zu kennzeichnen. Sie ist für Ausbildung und Auswahl der Juroren verantwortlich, die bei Ausstellungen die Beurteilung der Zuchttiere treffen, veranstaltet Versteigerungen. Schafe und Kult(ur) Schafe und Hirten in der Kunst Die Kirche, als organisierte Gemeinschaft von Christen, verwendet das Schaf / das Lamm als vielfältigen symbolischen Bedeutungsträger. Der Hirte und seine Herde sind eine Metapher für den Pastor und seine Gemeinde (eine Schafherde gilt gemeinhin als gutmütig, relativ einfach lenkbar und trottet dem Leittier hinterher). Sie verwendet auch das Sinnbild des Opferlamms / des „Lamm Gottes“ / des Agnus Dei als Synonym für Jesus Christus (Lämmer sind Symbol für Wehrlosigkeit und unschuldiges Leiden, sie sind Opfertiere), als Osterlamm, gekennzeichnet mit der Siegesfahne, ist es ein Symbol für seine Auferstehung. 9 Ötztaler Schafwollzentrum Umhausen | Tirol in Österreich https://www.tirol.at/reisefuehrer/kultur-leben/shopping/shops/a-o, Stand 5. Mai 2022. 10 Vgl. Weber Beda: Das Thal Passeier und seine Bewohner. Mit besonderer Rücksicht auf Andreas Hofer und das Jahr 1809, Innsbruck, 1852, S. 191. 11 Vgl. Ringler Josef: Das Tiroler Heimatwerk. Ein Rückblick auf seine geschichtliche und wirtschaftliche Entwicklung anläßlich seines 25jäührigen Bestandes, in: Tiroler Heimatblätter, 34. Jg., Heft 10/12, 1959, Innsbruck, S. 153- 168, hier S.155. www.tirol.gv.at/kunst-kultur/kulturportal/museumsportal/
Schon in biblischer Zeit lieferten die robusten und genügsamen Schafe und Ziegen Milch, Fell und Wolle,
sie bildeten einen Besitzanteil der Israeliten. Das ständige Zusammenleben mit den Tieren regte zu
Vergleichen mit menschlichen und göttlichen Wesenszügen an.12 Wir treffen daher im Alten Testament auf
159, im Neuen Testament auf 37 Bezugsstellen, in denen das Verhalten der Menschen jenem der Tiere
gegenübergestellt wird. Zahlreiche Bibelstellen finden in künstlerischen Ausformungen ihren Niederschlag.
Im Neuen Testament hat wohl das Weihnachtsevangelium (Luk 2,1-25) die
häufigste künstlerische Umsetzung (in Kunst, Musik, Literatur) erfahren. Für Tirol
gilt es in diesem Zusammenhang auf die vielen Weihnachtskrippen zu verweisen,
in denen die Geburt Christi mit kunstvoll geschnitzten Schafherden und
musizierenden Hirten umgeben wird. In vielen Krippen sticht eine Figur ins Auge,
ein Hirte, der ein Schaf auf seinen Schultern trägt – er ist dem „guten Hirten“ nach
dem Lukasevangelium (Luk 15,6) nachgebildet: Christus stellt sich als guten
Hirten ins Bild, der einem verlorenen Schaf nachspürt, bis er es gefunden hat.
„Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf die Schultern. Im
17.Jahrhundert etablierte sich das Bild der „Gottesmutter Maria als gute Hirtin“.
Mehrere Versionen liegen diesem „neuen“ Marienbild zugrunde, das in der
Volkskunst seither thematisiert wird. In Tirol ladet in der Pfarrkirche
Perjenn/Landeck eine „Guthirten-Madonna“ zur Andacht ein.
Widder - Prozessionen in Osttirol
Wie in der Bibel so wurden auch in unserem Land Schafe in die Volksfrömmigkeit
inkulturiert. Bis in die Gegenwart wird jährlich am Samstag nach Ostern eine
„Widder-Prozession“ von Virgen bzw. Prägraten zur Wallfahrtskirche Obermauern
organisiert. Damit wird noch immer ein Gelöbnis aus der Pestzeit um 1635 erfüllt.
Es gab für die Bevölkerung damals kein anderes Abwehrmittel gegen die Seuche
als Gebete und Gelöbnisse. Nach der Legende machte eine Bittprozession von
Obermauern nach Virgen auf halben Wege Halt und beteten zum Allerheiligen-
kirchlein. Da sahen die Teilnehmer plötzlich einen Sensenmann aus dem Wald
treten, sein Werkzeug gegen das Tal schwingend. Nach einem Stoßgebet kam
aus Richtung der Kirche von Obermauern ein großer weißer Widder, und stieß
den Sensenmann nieder. Die Dorfgemeinschaft gelobte damals jährlich in einer
Prozession einen drei Jahre alten Widder von Obermauern nach Maria Lavant im
Drautal zu führen und dort zu opfern. Später gelobte man zwischen Virgen und
Niedermauern einen Bildstock zu errichten. Ein Votivbild mit der bildlichen
Darstellung der Legende und der Inschrift „1635 ex voto“ am Bildstock angebracht ist heute in der
Wallfahrtskirche angebracht13. Nach verschiedenen Änderungen des Gelöbnisses führt heute die
Widderprozession von Virgen nach Obermauern, der Widder wird wechselweise von den Fraktionen der
Orte Virgen und Prägraten gestellt, gepflegt, ein Jahr nicht geschoren, und nach dem Prozessionsgang
verlost. Die Einnahmen kommen der Kirchenkassa zugute. Auch in anderen Orten Osttirols kannte man
Widderprozessionen. In Kals kündigt noch in der Gegenwart die Gottesdienstordnung eine „Widder-
versteigerung“ an – allerdings in der Form, dass unter dieser Bezeichnung Sachspenden verlost werden.
Schafe und Hirten in Sagen und Gründungslegenden
Nach der Legende geht die Entstehung der Wallfahrtskirche Maria Lavant in Osttirol auf Hirten zurück, die
ihre Schafe auf dem Kirchhügel nicht mehr finden konnten. Nach längerem Suchen fanden sie die Schafe
auf ihren Vorderbeinen kniend vor einem Marienbild. Die Bewohner, von den Hirten informiert, brachten
das Marienbild in den Ort. Am nächsten Tag fand man das Bild wiederum oben am Erscheinungsort. Den
Gläubigen wurde damit klar, dass Maria am Kirchhügel verehrt werden wollte und errichteten dort eine
Kirche.14
Eine Sage aus dem Ötztal allerdings erzählt von einer Katastrophe, die über einen Schaftrieb
hereingebrochen ist. Schafe aus dem Vinschgau, die nach alten Gepflogenheiten während des Sommers
im hintersten Ötztal die Weide genossen, sollten um Maria Geburt wieder über die Jöcher in ihre
heimatlichen Ställe zurückgetrieben werden. „Es war ein sehr schöner Tag und die Schafhalter waren
hemdärmeln über den Ferner gegangen.“ In der Nähe von Obergurgl begegnete den Hirten ein altes, in
Winterkleider gehülltes Weib. Sie sagte ihnen: „Meine Männer husch, husch.“ Am nächsten Tag, als sich
der Schaftrieb am großen Ferner befand, brach plötzlich ein „so entsetzlicher Schneesturm ein, daß 1.300
12
Tier in der Bibel: https://de.wikipedia.org/wiki/Tiere_in_der_Bibel. Stand: 2. Mai 2022.
13
Vgl. Louis Oberwalder: Virgen im Nationalpark Hohe Tauern, Innsbruck, 1999, S. 264f.
14
Die Wahlfahrt nach Maria Lavant, in: http://www.lavant.at/geschichte/165-die-wallfahrt-nach-maria-lavant, Stand 2. Mai 2022.
www.tirol.gv.at/kunst-kultur/kulturportal/museumsportal/Schafe und alle Menschen bis auf zwei zu Grunde gingen. Dieß sei vor sehr alter Zeit geschehen und jenes
alte Weib, eine Hexe, habe das Wetter gemacht.“15
Schafe und Hirten in Mirakeln
Eine Votivtafel in der Wallfahrtskirche Unser Frau im Schnalstal aus dem Jahre 1694 erinnert an den Dank
eines Hirten, der beim Schaftrieb nach Vent in eine Gletscherspalte stürzte. Ein ähnlicher Vorfall ist im
Mirakelbuch der Wallfahrtskirche Maria unter den vier Säulen in Wilten vermerkt. Im August 1697 stürzte
im Stubai ein Knecht bei der Suche nach versprengten Schafen in eine Gletscherspalte. Er verlobte sich
zur genannten Gottesmutter und versprach dort jährlich eine Messe lesen zu lassen, wenn er gerettet
würde. Auf wunderbare Weise konnte er sich aus der Spalte befreien, als er sich wieder in Todesangst
befand, weil er vier Bären gegenüberstand. Nach einem Hilferuf an die Hl. Maria suchten die Ungeheuer
das Weite.16
Zusammenschau
Schafe waren seit Jahrhunderten existenzsichernde Begleiter der alpinen Bergbevölkerung, sie sicherten
Lebensunterhalt und Kleidung. Die Verbindung von Mensch und Tier hatte schon biblischen Charakter,
weshalb Schafe in der Vergangenheit in die Volksfrömmigkeit inkulturiert wurden.
In unserer Zeit hat sich die Schafhaltung zu einem speziellen Teil der Landwirtschaft entwickelt, dient der
Rassenerhaltung und belebt die Beweidung von Almen und Berghängen. Das Landschaftsbild als
Kulturlandschaft wird teilweise auch durch die Schafhaltung geprägt. Kult und Rituale, wie Markierung,
Schellen und Glocken, Almsegen, usw. werden als Tradition weiter hochgehalten.
Und wer kennt sie nicht, die Redensarten, die bildhaften Ausdrücke sprachlicher Fertigbausteine, die über
die rein wörtliche Bedeutung hinausgehen: „seine Schäfchen ins Trockene bringen“, „jemand ist
belämmert“, „das schwarze Schaf in der Familie sein“, „der Wolf im Schafspelz“ oder „ein Schäferstündchen
halten“… Nicht zu vergessen die „Schafskälte“, ein meteorologischer Begriff, die im Alpenraum relativ
regulär auftritt.
© Land Tirol, Dr. Franz Jäger, Text und Abbildung 3, 4, 11, 13
© Land Tirol, Abbildung 1, 2, 5-9, 12
© Fotoarchiv Leo Jörg, Abbildung 10
Abbildungen:
1 - Schafherde mit Widder, Studie, Öl/Papier, vergoldeter profilierter Holzrahmen; 20,8x25,5 (o. R.),
Friedrich Gauermann (1807-1862). © Land Tirol, Sammlung Hans Jäger, InvNr 475.
2 - Genrebild, bez. „Der Hirte The Shepherd“, Lithographie, 21,4x17,3 (Blatt), 19. Jh.. © Land Tirol,
Sammlung Hans Jäger, InvNr 1542.
3 - Präsentation der „Sieger“ bei der Schafausstellung in Mutters am 22.02.2019.
4 - Siebte Bergschaf-Alpin“ Ausstellung in Innsbruck 2020.
5 – Schafscheren, Eisen, L= 26; Museum Tiroler Bauernhöfe InvNr 617. © Land Tirol, TKK 1990.
6 - Benediktzyklus Nr 4 - Ausschnitt, Öl auf Leinwand, Franz Georg Hermann II (1692-1768); Stift
Stams InvNr 290. © Land Tirol, TKK 1994.
7 - Drehhaspel, Holz gedrechselt, H 98, Dm 94; Heimatmuseum Tannheim, InvNr 1052. © Land Tirol,
TKK 1996.
8 - Wollkardatsche, Holz-Leder-Nägel, 22,5x20,5 (o.Griff); s'Paules und s'Seppls Haus" in Fiss, ©
Land Tirol, Museumsservicestelle 2007.
9 - Bandwebstuhl, Holz-Eisennägel, 55x24x34,5; s'Paules und s'Seppls Haus" in Fiss, © Land Tirol,
Museumsservicestelle 2007.
10 - “Spinnerinnen-Runde“ in Kappl, Dia um 1950, Fotoarchiv Leo Jörg.
11 - Krippenfigur, Holz geschnitzt gefasst, 19. Jh. Privatbesitz
12 - Johannes der Täufer mit Agnus Dei. Holz geschnitzt gefasst, H= 110 (mit Nimbus), Andreas
Thamasch (1639-1697). Stift Stams InvNr 180. © Land Tirol, TKK 1994.
13 - Martin Wibmer mit dem Opferwidder, Bobojach/ Prägraten am Großvenediger, 2022.
Empfohlene Zitierweise:
Jäger, Franz, Schafe in Tirol. Ein Haustier zwischen Wirtschaft und Kult(ur). 2022. Online unter:
https://www.tirol.gv.at/kunst-kultur/kulturportal/museumsportal/ (Zugriff am:…..)
15
Vgl. Trientl Adolf: Tagebuch der Kurazie und Gemeinde Gurgl, angefangen im Jahre 1858, abgeschrieben von Hofinger Winfried,
1991.
16
Mirakelbuch Mariae unter denen 4.Säulen zu Wilthau, Innsbruck, 1734, S.27f.
www.tirol.gv.at/kunst-kultur/kulturportal/museumsportal/Sie können auch lesen