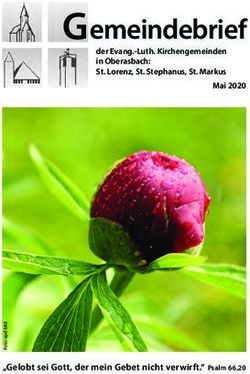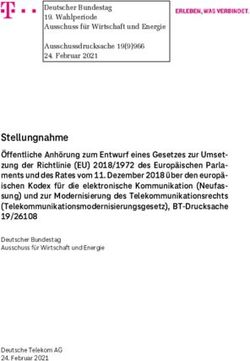Schiller und die Religion
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Schiller und die Religion
Von Dr. Matthias Schulze-Bünte (Universität Frankfurt)
(Vortrag auf der Akademietagung des Bistums Mainz am 29.10.2005)
Guten Tag, meine Damen und Herren,
ich freue mich, heute zu Ihnen über Schiller und die Religion, über Schillers religiöse
Bindungen sprechen zu dürfen. Das Thema wird durch die Herkunft Schillers und durch
vielfältige Textzeugnisse nahe gelegt. Die vielleicht deutlichste Äußerung Schillers zur
Bedeutung des Christentums gleich zu Beginn:
„Die christliche Religion hat an der gegenwärtigen Gestalt der Welt einen so vielfältigen
Antheil, dasß ihre Erscheinung das wichtigste Faktum für die Weltgeschichte wird: aber
weder in der Zeit , wo sie sich zeigte, noch in dem Volke, bey dem sie aufkam, liegt (aus
Mangel an Quellen) ein befriedigender Erklärungsgrund ihrer Erscheinung.“
Es soll verfolgt werden, auf welche Weise sich Schiller in seinen verschiedenen Lebens- und
Schaffensperioden diesem „wichtigsten Faktum für die Weltgeschichte“ immer wieder neu
angenähert hat. Dabei geht es mir nicht so sehr um die Analyse seiner persönlichen
Glaubensüberzeugung. Interessanterweise findet sich im Gesamtwerk weder eine historische
noch eine philosophische Reflexion auf die Person Jesu Christi. Es wird sich aber zeigen, dass
die Dichtkunst in Schillers Sinn eine enge Verbindung zu religiöser Letztbegründung eingeht,
Darüber hinaus wird zu sehen sein, inwieweit die religiöse Praxis für Schiller einen Fixpunkt
menschlicher Freiheit markiert. Folgende Gliederung wird durch das Thema nahe gelegt:
1. Elternhaus und pietistische Ursprünge
2. Die Begründung der Dichtung vor der Kantlektüre
2.1. Die Kritik der natürlichen Religion
2.2. Die Kritik des Katholizismus
3. Schillers ästhetische Initiative: Was ist die Aufgabe der Kunst?
3.1. Schillers kritische Anthropologie
3.2. Die Begründung menschlicher Praxis: Maria Stuart
Zu 1. Elternhaus und pietistische Ursprünge
Schillers Elternhaus ist streng gläubig, die Mutter und der zunächst häufig abwesende Vater
erziehen den Jungen im Geiste des Pietismus. Tägliche Hausgebete, die der Vater sogar
eigens dichtet, sind Rituale des Familienlebens. Der Alltag der Familie wird durch die
Religion bestimmt. Schillers frühe Jugend ist so von einem intensiven Kontakt zum
christlichen Ritus und zu religiösen Fragestellungen gekennzeichnet.
Im Alter von sechs Jahren beginnt der Junge, Latein beim Dorfpfarrer Moser in Lorch zu
lernen, einem Mann, der den Jungen sehr beeindruckt haben muss. Jedenfalls gibt Schiller
später nicht nur dem furchtlosen Pfarrer in seinen Räubern den Namen dieses Dorfpfarrers.
Die Schwester Schillers Christophine berichtet auch, wie stark der Pfarrer und seine
Predigten den Jungen prägen. So verkleidet er sich als Pfarrer.„Mutter und Schwester mussten dem Knaben eine schwarze Schürze umbinden und ein Käppchen aufsetzen. Dabei sah er sehr ernsthaft aus. Was zugegen war, musste zuhören, und wenn jemand lachte, wurde er unwillig, lief fort und ließ sich so bald nicht wieder sehen.“ Die kindliche Identifikation mit der christlichen Lehre wirkt sich auch auf den übrigen Familienalltag aus. Sie geht so weit, dass der junge Schiller Schuhschnallen, Bücher und Kleidungsstücke aus dem Haushalt der Familie an Bedürftige wegschenkt. Das geht solange gut, bis er auch das Bettzeug der Familie weggeben will, was ihm der Vater streng verbietet. Das wörtliche Verständnis des Christentums legt sich daraufhin bei dem Jungen ein wenig. Aufgrund der tief greifenden religiösen Prägung in der Kindheit ist es nicht verwunderlich, dass Schiller, darin von den Eltern unterstützt, den Wunsch äußert, ein Theologiestudium aufnehmen zu wollen: Er will Pfarrer werden. Doch der Herzog Karl Eugen von Württemberg, der den Jungen 1773 in seine neu gegründete Akademie, die spätere Hohe Karlschule aufnimmt, hat andere Pläne: Er nötigt den Jungen zuerst zu einem ungeliebten Jurastudium und nachdem der Lehrplan der Hohen Karlschule um dieses Fach erweitert wird, schließlich zum Studium der Medizin. Schiller schließt dieses Studium auch mit zwei Examensarbeiten ab und ist nach Beendigung seiner Studien auch eine Weile ohne sonderlichen Erfolg als Arzt tätig. Landesherrliches Verwertbarkeitsdenken, nicht persönliche Neigung sind für die Berufswahl verantwortlich. Neben seiner Berufsausbildung aber entwickelt Schiller eine dichterische Begabung, wobei er den Sinn seiner dichterischen Aufgabe zunächst religiös begründet. Die frühe religiöse Neigung des noch kindlichen Dichters zeigt sich an den Titeln seiner zwei ersten Stücke, die allerdings nicht überliefert sind, „Die Christen“ und „Absalom“. Der früheste Begründungsversuch für Schillers Dichtung schreibt sich aus der pietistischen Geisteswelt seines Elterhauses und seiner Umgebung her. Praktisch tätige und lebendige Frömmigkeit in der Gemeinde kennzeichnen den Pietismus. Er ist eine Glaubensausprägung der lutherischen Tradition. Damit wendet sich der Pietismus insbesondere gegen eine immer stärker institutionalisierte lutherische Orthodoxie, die im Sinne des cuius regio eius religio (ggf. erläutern: der Landesherr bestimmt das Bekenntnis seiner Untertanen, nicht der gläubige Gewissensentscheid) politische Bündnisse mit den evangelischen Landesherren eingeht und damit von politischem Kaküldenken und dogmatischer Erstarrung bedroht ist. Neben dem Insistieren auf der Glaubensgültigkeit des Schriftworts betont der Pietismus die Individualität des Gläubigen: Er muss sich durch das Wort Gottes persönlich in seinem Innersten angesprochen und zum neuen Adam geläutert fühlen. Die Gefühlssphäre und die Innerlichkeit des Einzelnen werden damit zum Ort der Gottbegegnung. Der Pietismus baut somit auf der mystischen Tradition des deutschen Geisteslebens auf. Vor dem Hintergrund eines pietistisch geprägten Alltags in Kindheit und Jugend ist die frühe dichterische Selbstbegründung des Jugendlichen wenig verwunderlich. Das erste von Schiller veröffentlichte Gedicht „Der Abend“ begreift 1776 die Dichtung als Gotteslob und Schöpfungsverherrlichung. Ganz im Geiste des Pietismus versteht sich der junge Dichter als Inspirierter, der sich in seinem Inneren und durch das „höhere Gefühl“ von Gott persönlich angesprochen weiß und sich aufgrund dessen durch „die Begeisterung“ zur Aufgabe des Gotteslobs berufen sieht. Folgerichtig hat die Dichtung primär die Aufgabe, den Menschen Gott nahe zu bringen. „Jetzt schwillt der Geist zu höheren Gesängen,
lass strömen sie o Herr aus höherem Gefühl. Laß die Begeisterung die kühnen Flügel schwingen Zu dir, zu dir, des hohn Fluges Ziel.“ Der weitere Bildungsgang Schillers wird allerdings durch eine fortschreitende Abkehr von der pietistischen Gefühls- und Geisteswelt seines Elternhauses gekennzeichnet. Der eher naive und gefühlsbetonte Zugriff auf die Dichtkunst weicht einer reflektierteren und rationaleren Begründung der dichterischen Aufgabe. Auf der Hohen Karlschule begegnet Schiller den philosophischen Gedankenentwürfen seines Zeitalters, die ihm durch seinen Lehrer Jacob Friedrich Abel vermittelt werden. Später nach der Flucht aus Württemberg trifft er auf den Hochgebildeten Christian Gottlieb Körner. Ein frühes Zeugnis dieser Begegnung ist der Briefwechsel zwischen Julius und Raffael. Zu 2. Die Begründung der Dichtung vor der Kantlektüre Mit Leibniz in der Tradition des Johannesevangeliums und des Neuplatonismus verwurzelt, begründet Schiller die Aufgabe des Dichters nun folgendermaßen: Die Welt wird als Schöpfung Gottes aufgefasst. Durch den Schöpfungsakt partizipiert sie am Wesen Gottes. Der Schöpfungsplan erschließt sich dem Menschen aber nicht so wie die Erkenntnis des Naturgeschehens über rationale Erkenntnis und ihre empirische Überprüfung. Gott ist kein Gegenstand der Welterfahrung. Von ihm gibt es demnach kein Wissen in einem naturwissenschaftlichen Sinne. Hypothesen über Gott sind auch nicht wie naturwissenschaftliche Erkenntnisse empirisch überprüfbar. Dennoch muss es möglich sein, von den innerweltlichen Verhältnissen auf den Schöpfer und seinen Schöpfungsplan zu schließen: Aufgrund der Schöpfung erlauben die Verhältnisse in der Natur zwar kein gesichertes Wissen über Gott und sein Wesen. Gleichwohl muss die Annahme berechtigt sein, dass das Naturgeschehen qua Schöpfung am Wesen Gottes teilhat und diesem Wesen und seiner Planung ähnelt. Da die Natur als Schöpfung am Sein Gottes teilhat, sind ihre Gesetze die Chiffern, die spekulativ zur Gotteserkenntnis führen: Die Welt ist Schöpfung Gottes und ihm darum ähnlich. Diese Ähnlichkeit zu erkennen und zu formulieren, wird zur philosophisch begründeten Aufgabe des Dichters. Da die Bildung von Seinsanalogien in die Domäne des Dichters fällt, begründet sich sein Schaffen theologisch. Bereits Schillers frühe Naturdichtung und Gedankenlyrik ist darum auch nicht im spinozistischen Sinne als unmittelbare Naturvergötterung zu deuten. Als Beispiel kann hier das frühe Gedicht „An die Sonne“ erwähnt werden: „Preis dir, die du dorten heraufstrahlst, Tochter des Himmels! Preis dem lieblichen Glanz Deines Lächelns, der alles begrüset und alles erfreut! (...) Alle wesen taumeln wie am Busen der Wonne: Seelig die ganze Natur! Und dieß alles o Sonn‘ entquoll deiner himmlischen Liebe. Vater der Heiligen vergib, daß ich auf mein Angesicht falle Und anbete dein Werk! – (...)“ Ähnlich wie das lebenspendende Wesen der Sonne sich auf die Geschöpfe auswirkt, muss es demnach mit den Wirkungen der göttlichen Liebe auf die Schöpfung bestellt sein, an der die Sonne dadurch teilhat, dass sie als „Werk“ Bestandteil dieser Schöpfung ist. 2.1. Die Kritik der natürlichen Religion
Die darauf gründende Kritik Schillers gilt zunächst verstandesabstrakten Spielarten der so genannten natürlichen Religion, insbesondere dem Deismus: Weil der gewalttätige Kampf der Konfessionen in den europäischen Glaubenskriegen so schrecklich gewütet hat, begegnet die natürliche Religion allen geoffenbarten Religionen mit großer Skepsis. Im Rekurs auf die Erfolge der Naturwissenschaften nimmt der Deismus an, dass sich der Organisationsplan des Universums auf dem Wege der Naturgesetze dem menschlichen Verstand kundgibt. Damit wird das göttliche Planungsdenken allen Menschen ganz unabhängig von ihrer Konfession oder Religion zugänglich. Je deutlicher der göttliche Plan verstandesgemäß erkannt und durchdrungen ist, umso erfolgreicher wird der Mensch auch in moralischer und gesellschaftlicher Selbstorganisation voranschreiten. Da der Überlieferungsbestand der christlichen Offenbarungsreligion sich solcher Verstandesgesetzmäßigkeit nicht fügt, ist die christliche Religion für den Deismus nicht glaubwürdig. Schiller befürchtet angesichts des Deismus, dass ein derartiges verstandesabstraktes Denken, den Religions- und Gottesbegriff der christlichen Religionsgemeinschaften folgenreich beeinträchtigen kann: Dies zeigt Schiller in seinem berühmten Gedicht „Die Götter Griechenlandes“. Die Abstraktionen einer auf das Verstandesdenken reduzierten menschlichen Selbstauffassung führen nicht nur zur „Entgötterung“ und Seelenlosigkeit der Natur, die damit zum Opfer menschlicher Ausbeutung degeneriert. Auch ein Gott dem sinnliche Attribute fehlen, weil er zum „Werk (und Schöpfer) des Verstandes“ geworden ist, entzieht sich der menschlichen Erfahrung. Schiller spricht einer solchermaßen reduzierten Gottesvorstellung glaubenskonstitutive Kraft ab: Ein Gott, dem die sinnliche Anschaulichkeit genommen wird, kann vom Menschen nicht erfahren werden. Und ein Gott, der nicht erfahren werden kann, ist nicht glaubwürdig. Dem deistisch reduzierten Gottesbild stellt Schiller die sinnliche Anschaulichkeit der griechischen Mythologie entgegen. „Wo jezt nur, wie unsre Weisen sagen, seelenlos ein Feuerball sich dreht, lenkte damals seinen goldnen Wagen Helios in stiller Majestät. Diese Höhen füllten Oreaden, eine Dryas starb in jenem Baum, aus den Urnen lieblicher Najaden sprang der Ströme Silberschaum.“ Nach Schillers Auffassung des antiken Mythos ist die gesamte griechische Lebenswelt von der Unmittelbarkeit und Erfahrbarkeit des Göttlichen gekennzeichnet: Selbst einzelne Bäume werden von göttlichen Wesen bewohnt und darum von Menschen verehrt. So zeigt sich an den griechischen Mythen, dass jeder Bereich des menschlichen Lebens und die gesamte Natur in eine göttliche Sphäre transferiert werden. Die sinnliche Anschaulichkeit des Göttlichen, deren Fehlen Schiller an einem verstandesabstrakten Gottesbegriff so sehr beklagt, ist hier bis in Phänomene des alltäglichen Lebens hinein eingelöst. An dieser Stelle muss ein mögliches Missverständnis ausgeräumt werden. Schiller will nicht künstlich naiv die Glaubensinhalte des antiken Mythos an die Stelle des christlichen Glaubens setzen. Der antike Mythos ist für den aufgeklärten Gebildeten kein glaubwürdiger Gehalt mehr. Aber Schiller hält die christlichen Glaubensgemeinschaften für gut beraten, wenn sie sich nicht die Verstandesabstraktionen der Moderne zu eigen machen, sondern sich im Sinne eines Korrektivs auf die Momente des sinnlichen Anschaulichkeit und Erfahrbarkeit zurückbesinnen, die dem Christentum wesensgemäß sind (Inkarnation).
„(…) Religion wirkt im Ganzen mehr auf den sinnlichen Theil des Volks – sie wirkt vielleicht durch das Sinnliche allein so unfehlbar. Ihre Kraft ist dahin, wenn wir ihr dieses nehmen.“ 2.2. Schillers Kritik des Katholizismus Schillers kritische Sicht des Katholizismus ist eindeutig bestimmbar und durch vielfältige Äußerungen, insbesondere innerhalb seiner historischen Schriften belegt. Wie viele seiner Zeitgenossen vertritt Schiller die Ansicht, dass in der Geschichte des Katholizismus nicht nur gegen Grundsätze christlichen Glaubens, sondern auch gegen die Verbindlichkeit der Moral verstoßen wird. Das Grundübel sieht Schiller dabei in der spätmittelalterlichen Identifikation der geistlichen mit der weltlichen Sphäre angelegt: Immer wenn es historisch zu einer Indienstnahme des christlichen Glaubens für die durchsichtigen Zwecke der innerweltlichen Macht- und Interessenausübung kommt, ist das Christentum der Gefahr ausgesetzt, zu politischem Fanatismus oder gewälttätigem Herrschaftsmissbrauch zu degenerieren. In diesem Sinne hält Schiller der historischen Erscheinung des spätmittelalterlichen Katholizismus die Verwahrlosung zu einer weltlichen Gewalt vor: „Durch seine wachsenden Reichthümer, durch die Unwissenheit der Völker und durch die Schwäche ihrer Beherrscher mußte der Klerus verführt und begünstigt werden, sein Ansehen zu mißbrauchen, und seiner stille Gewissensmacht in ein weltliches Schwerd umzuwandeln. Die Hierarchie mußte in einem Gregor und Innozenz alle ihre Greuel auf das Menschengeschlecht ausleeren, damit das überhandnehmende Sittenverderbniß und des geistlichen Despotismus schreiendes Scandal einen unerschrockenen Augustinermönch auffordern konnte, das Zeichen zum Abfall zu geben und dem römischen Hierarchen eine Hälfte Europens zu entreisen.“ Die gewaltsame Verfolgung Andersgläubiger, die Kreuzzüge und die Inquisition bekunden ein fatales Missverständnis des Verkündigungsauftrags. Die Vereinigung von Glaubensfanatismus und Herrschaftsideologie identifiziert die weltlichen Belange der Politik mit den geistlichen des Glaubens. Politische Rebellion ist Ketzerei, Verstoß gegen die Glaubensdoktrin politischer Aufruhr. Gesteigert wird die Verfolgungspraxis durch die Erfolge des Protestantismus in Europa. In seiner Schrift „Der Abfall der der Vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung“ schreibt Schiller „Ebenso wie die göttliche Regierung die ganze Schöpfung umfasst, sollte der Despotismus des Glaubens ihm (dem spanischen König Philipps II) die ganze politische Welt unterjochen. Jeder Aufrührer wäre dann zugleich Ketzer, und jeder Ketzer würde als Aufrührer behandelt. Man hätte sich gegen den Monarchen vergangen, sobald man sich von der Formel seines Glaubens entfernte. Eine solche Tyrannei des Gewissens – die schlimmste aller schlimmen Regierungsformen – wollte Philipp in seinen Staaten errichten. Er wollte seine irdische profane Gewalt mit dem göttlichen Zepter vermählen. Ein finstrer und grausamer Aberglaube verschlang das Licht der Vernunft und errichtete seinen Thron auf den Trümmern der Gewissensfreiheit.“ Die daraus resultierende inquisitorische Praxis verurteilt Schiller auch im letzten Auftritt des Don Carlos: Der König wird vom Großinquisitor dazu genötigt, sich der Räson der Inquisition
zu beugen und seinen Sohn Carlos zur Hinrichtung auszuliefern. Als Philipp die Alternative erwägt, den Sohn entfliehen zu lassen, kommt es zu dem folgenden Dialog. Die Ermordung des Sohnes durch die Inquisition wird seitens des Großinquisitors durch den Glauben gerechtfertigt. So wie Gott seinen Sohn geopfert hat, soll auch Philipp seinen Sohn Carlos opfern. Dass hier offenkundig ein absichtliches Missverständnis der christlichen Lehre vorliegt, bedarf keiner weiteren Erläuterung. König: Mein Sohn ist Hochverraths verdächtig. Grossinquisitor: Was beschließen Sie? König: Alles oder nichts. Grossinquisitor: Was heißt hier alles? König: Ich laß ihn fliehn, wenn ich ihn Nicht sterben lassen kann. Grossinquisitor mit lauerndem Gesicht: Nun? Beide schweigen eine Zeit lang König: Können Sie einen neuen Glauben mir erdenken, der Kindermord des Gräßlichen entkleidet? Grossinquisitor: Die ewige Gerechtigkeit zu sühnen, starb an dem Holze Gottes Sohn. König: Sie wollen Durch ganz Europa diese Meinung pflanzen? Grossinquisitor: So weit, als man das Kreuz verehrt. Soviel zu Schillers Positionen in Bezug auf die religiösen Strömungen seiner Zeit. Wir kommen nun zur klassischen Wendung in Schillers Dichtung und Theoriebildung. Hierzu werden wir zunächst den Kalliasbriefwechsel ansehen und dann eines seiner späten Dramen, die „Maria Stuart“ betrachten. Zu 3. Schillers ästhetische Initiative: Was ist die Aufgabe der Kunst? Will man sich Schillers ästhetische Initiative nach seiner Kantlektüre vor Augen führen, so bietet sich zunächst der Kalliasbriefwechsel mit dem Freund Christian Gottfried Körner an: Dabei ist für Schiller durch die Kantlektüre deutlich, dass sich die Aufgabe einer Letztbegründung der Dichtkunst nach der „Kritik der Urteilskraft“, der so genannten Kritik der Kritiken neu stellt. So einfach schöpfungsgläubig, wie das noch an der Theosophie des Julius gezeigt wurde, lässt sich die Dichtung nicht mehr begründen. So geht es Schiller zuerst darum, die formalen Bedingungen dichterischer Rede abzuklären. Sehr deutlich kann man sich diese formalen Bedingungen an dem Dualismus des Freiheitsbegriffs klar machen. Schiller stellt den Vollzug der „Freiheit in der Tat“ gegen die Darstellung der Freiheit im Symbol der schönen Kunst. Diese Freiheit nennt Schiller „Freiheit in der Erscheinung“. Betrachten wir zunächst die „Freiheit in der Tat“. Schiller ist im Gefolge seiner Kantlektüre der Auffassung, dass der Mensch im Handlungsvollzug sich aus Freiheit selbst bestimmen und konkretisieren kann. Doch von den Resultaten menschlicher Handlungen her ist nicht über die moralische Qualität der Willensbildung zu befinden. Niemand kann letztlich sagen, ob sein Gegenüber aus moralischen oder bloß eigennützigen Motiven handelt. Denn die Willensmotive menschlichen Handelns bleiben der Anschauung verborgen. Auch der Erfolg
oder Misserfolg einer Handlung sagt nichts über die moralische Dignität der zugrunde liegenden Absicht aus. Dem gegenüber kann die symbolische Darstellung des Dramas menschliche Willensmotive zur Anschauung bringen. Da diese Darstellung dabei weder einem bestimmten praktischen Interesse dient also keinen konkreten Handlungszweck verfolgt noch zu einer bestimmten positiven Erkenntnis führt, ist es in jeder Hinsicht interesselos. Die Kunst ist „Freiheit in der Erscheinung“. So kann die menschliche Freiheit von ihren Motiven her in der Dichtung und hier insbesondere im Drama in die Erscheinung treten und damit positiv erfahren werden. Um es anders zu sagen: in der Darstellung des Dramas kann man konkret sehen, was und wie jemand will, und auf welche Weise er diese Motive verwirklicht, in der Erfahrungswelt nicht. 3.1. Schillers kritische Anthropologie Im Anschluss an die Kantlektüre modifiziert Schiller sein Menschenbild dem Vermittlungsauftrag gemäß, der sich für ihn aus der „Kritik der Urteilskraft“ ergibt. Unbefriedigend erscheint ihm die Alternative, nach welcher der Mensch entweder ausschließlich aus naturgesetzlichem Antrieb, d.h. neigungsgemäß handelt, oder aber unter der Gesetzmäßigkeit moralischer Maxime steht. Denn auch dem moralischen Handeln eignet etwas Zwanghaftes in der Erscheinung. „Offenbar hat die Gewalt, welche die praktische Vernunft bei moralischen Willensbestimmungen gegen unsere Triebe ausübt, etwas Beleidigendes, etwas Peinliches in der Erscheinung. Schön ist aber ein Charakter, eine Handlung nicht, wenn sie die Sinnlichkeit des Menschen, dem sie zukommen, unter dem Zwang des Gesetzes zeigen.“ Den daraus erwachsenden Vermittlungsanspruch zwischen praktischer und theoretischer Vernunft, Sittlichkeit und Sinnlichkeit, Pflicht und Neigung kennzeichnet Schiller mit dem Begriff des „schönen Charakters“, bzw. der „schönen Handlung“. In der schönen Handlung sind naturgesetzliche Bestimmtheit und moralische Selbstbestimmung zwanglos zur Synthese gelangt. Sie vollzieht sich mit einer Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit so, als ob sie nur Neigungsantrieben gehorchen würde. Dem schönen Charakter ist das moralische Gesetz zur zweiten Natur, d.h. habituell geworden: „Also wäre eine moralische Handlung alsdann erst eine schöne Handlung, wenn sie aussieht wie eine sich von selbst ergebende Wirkung der Natur. Mit einem Worte: eine freie Handlung ist eine schöne Handlung, wenn die Autonomie des Gemüts und Autonomie in der Erscheinung koinzidieren. Aus diesem Grunde ist das Maximum der Charaktervollkommenheit eines Menschen moralische Schönheit, denn sie tritt nur alsdann ein, wenn ihm die Pflicht zur Natur geworden ist.“ Wenn man die späten Dramen Schillers vor diesem Hintergrund liest, dass in ihnen in der Tat menschliche Motive, die Horizonte möglicher menschlicher Selbstbestimmung zur Erscheinung gebracht werden sollen, dann ergibt sich daraus ein wichtiger Hinweis, wie sie zu lesen sind: Sie stellen nämlich bestimmte alternative Motivationsebenen der praktischen Vernunft, man könnte auch sagen sie stellen unterschiedliche Lebensprogramme oder Selbstentwürfe dar. Diese Lebensentwürfe werden in den Dramen einander konfrontiert. Dabei wird gezeigt, welche Tragweite diese Lebensentwürfe haben und wohin sie ihre Apologeten führen. 3.2. Die Begründung menschlicher Praxis: Maria Stuart
So erhebt sich erneut die Frage, welche Rolle und welche Tragweite Schiller einer religiösen Begründung der Lebensführung einräumt. Schon ein oberflächlicher Blick auf die Heldinnen seiner späten Dramen lässt etwas Merkwürdiges erkennen: Die Figur der Maria Stuart definiert sich aus ihrem Glauben, die Figur der Johanna von Orleans entstammt der Legendenbildung um eine Heilige. Beide sind ihrer historischen Existenz nach Katholikinnen. Das soll aber an dieser Stelle nicht in erster Linie interessieren. Denn es geht Schiller hier nicht um die historische Wahrheit. Dichtung ist keine Geschichtsschreibung. Schiller verwendet den historischen Stoff nur, um mit ihm seine kritische Anthropologie zu vermitteln. „Die poetische Wahrheit besteht aber nicht darinn, das etwas wirklich geschehen ist, sondern darinn, daß es geschehen konnte, also in der innern Möglichkeit der Sache. Selbst an wirklichen Begebenheiten ist nicht die Existenz, sondern das durch die Existenz kund gewordene Vermögen das poetische.“ In diesem Sinne haben wir es bei der Maria Stuart nicht mit der historischen Figur zu tun. Die historische Erscheinung bietet Schiller nur die Möglichkeit die Motivationshorizonte der praktischen Vernunft bei ihrer Selbstverwirklichung vorzuführen. So werden die Selbstbestimmung aus Neigung in der Figur der Elisabeth, die aus einer moralischen Motivation in der gestalt Talbots und die aus dem Glauben in der Figur der Maria Stuart konfrontiert. Wir wollen uns vordringlich mit Maria Stuart beschäftigen. Schiller führt uns in einen Konflikt, bei dem es vordergründig um einen Machtkampf zwischen der englischen Königin Elisabeth I. und der Maria Stuart geht. Seit ihrer Flucht aus Schottland befindet sich Maria in Gefangenschaft der englischen Königin. Denn von Marias Anspruch auf die englische Krone geht eine ernsthafte Bedrohung für Elisabeths Herrschaft aus. Trotz dieser Bedrohung zögert Elisabeth eine Verurteilung Marias hinaus, weil das Todesurteil über die Schwester ihr Ansehen und ihr Bild vor der Geschichte beschädigen würde. Sehen wir uns Maria Stuart einmal so an, wie sie in das Drama eingeführt wird. Ihr erstes Auftreten zeichnet sie gegenüber allen anderen Personen des Dramas als Gläubige aus: Sie hält ein Kruzifix in der Hand und ersucht ihren Wächter Paulet, einen Gottesdienst nach katholischem Ritus abhalten zu dürfen, was ihr jedoch verweigert wird. „Schon lange Zeit entbehr ich im Gefängnis Der Kirche Trost, der Sakramente Wohltat. Und die mir Kron und Freiheit hat geraubt, Die meinem Leben selber droht, wird mir Die Himmelstüre nicht verschließen wollen.“ Diese gläubige Selbstauslegung Marias ändert nichts daran, dass sie sich in der Vergangenheit mit schwerer Schuld belastet hat: Sie hat ihren Ehemann ermorden lassen und in Missbrauch ihrer Macht, den Freispruch für den Täter erwirkt. Anschließend hat sie den Mörder sogar geheiratet. Diese Verbrechen kann sich Maria trotz Beichte nicht verzeihen: „Frischblutend steigt die längst vergebne Schuld Aus ihrem leichtbedeckten Grab empor! Des Gatten rachefoderndes Gespenst Schickt keines Messedieners Glocke, kein
Hochwürdiges in Priesters Hand zur Gruft.“ Die Gläubige ist weder schuldlos noch ist sie ihrer geschichtlichen Rolle entrückt. Maria steht nicht nur für ihr Recht auf Freiheit, sondern auch für ihren Anspruch auf die englische Krone ein: „Ein heilig Zwangsrecht üb ich aus, da ich Aus diesen Banden strebe, Macht mit Macht Abwende, alle Staaten dieses Weltteils Zu meinem Schutz aufrühre und bewege Was irgend nur in einem guten Krieg Recht ist und ritterlich, das darf ich üben.“ Allerdings hat sich Maria seit Gattenmord und Bluthochzeit geläutert. Entgegen der Anklage Elisabeths hat sie nie versucht, die englische Königin ermorden zu lassen. An den Anschlägen auf deren Leben, die letztlich das Todesurteil gegen Maria legitimieren sollen, trägt sie entgegen Anklage und Urteil keine Schuld, wie auch die Aussage des Schreibers Kurl unmittelbar nach ihrer Hinrichtung beweist „Den Mord allein, die heimlich blutge Tat, Verbietet mir mein Stolz und mein Gewissen Mord würde mich beflecken und entehren.“ Der Streit der Königinnen eskaliert in der übrigens frei erfundenen Begegnung auf Schloss Fotheringhay. Zunächst verleugnet Maria ihre königliche Herkunft, ihren Thronanspruch und sogar ihr Recht auf persönliche Freiheit. Damit erhofft sie, ihre Begnadigung erlangen zu können. Maria appelliert an das Gewissen Elisabeths: „(...) sprecht es aus, das Wort um dessentwillen Ihr gekommen, Denn nimmer will ich glauben, dasß Ihr kamt, um Euer Opfer grausam zu verhöhnen. Sprecht dieses Wort aus. Sagt mir: Ihr seid frei, Maria! Meine Macht habt ihr gefühlt, Jetzt lernet meinen Edelmut verehren. Sagts, und ich will mein Leben, meine Freiheit Als ein Geschenk aus Eurer Hand empfangen. - Ein Wort macht alles ungeschehn. Ich warte Darauf. O laßt michs nicht zu lang erharren.“ Da Elisabeth moralische Appelle fremd bleiben, verhallt diese Gnadenbitte wirkungslos. Die Gelegenheit zur Versöhnung ist unwiderruflich vertan. Angesichts der Aussichtslosigkeit ihrer Bitte fällt Maria in den alten Hass gegenüber Elisabeth zurück: „Der Thron von England ist durch einen Bastard Entweiht, der Britten edelherzig Volk Durch eine listge Gauklerin betrogen. - Regierte recht, so läget Ihr vor mir Im Staube jetzt, denn ich bin Euer König.“
Auch die Motivbildung aus dem Glauben ist von Rückfällen bedroht. Trotz Gewissenerforschung und Wandlung ihrer Lebensführung ist Maria vor neuerlicher Schuldverstrickung nicht sicher. Die Folgeszene zeigt sie im Genuss ihrer Rache. „O wie mir wohl ist, Hanna! Endlich, endlich Nach Jahren der Erniedrigung, der Leiden, Ein Augenblick der Rache, des Triumphs! Wie Bergeslasten fällts von meinem Herzen, Das Messer stieß ich in der Feindin Brust.“ Mit dieser Szene verdeutlicht Schiller, dass auch der gläubige Mensch allen willkürlichen Neigungsantrieben und Irritationen ausgesetzt ist, die ihm seine irdische Existenz auferlegen. Insbesondere ist Maria nicht in der Lage, konsequent moralisch zu handeln. Sie weiß aus ihrem Glauben, wie sie handeln sollte und sie bemüht sich auch darum. Dieses Bemühen scheitert aber an der Wirkungsmächtigkeit ihrer partikularen Ansprüche, Neigungen und Wünsche. Die Gläubige ist eine geschichtliche Person. Ein grundlegender Wandel im Habitus Marias tritt aber mit der Abendmahlsszene im siebten Auftritt des fünften Akts ein. Wir haben gesehen, wie sich Maria vor dieser Szene darstellt, als Gläubige zwar, doch notwenig in alle weltlichen Belange eingebunden. Wir wollen nun sehen, in welcher Weise sich ihr Habitus verändert. Ein Mordanschlag auf Elisabeth, den Maria aber nicht zu verantworten hat, befördert das Todesurteil durch die englische Königin, die gleichwohl davor zurückschreckt, es zu vollstrecken und zu vertreten.. Dieses Urteil wirft Maria völlig auf die Gewißheit ihres Glaubens zurück. Aufs neue „ein Kruzifix in der Hand“ gibt sie ihrem ehemaligen Haushofmeister Melvil gegenüber Auskunft über die Begründung ihres Glaubens. Dabei verdeutlicht sie, dass die subjektive Befindlichkeit des Herzens zur Begründung der Glaubensüberzeugung nicht ausreicht. Die Heilstat muss vielmehr in die Erfahrung des Einzelnen gelangen und von diesem lebensgeschichtlich real eingeholt werden können. Der Glaube bedarf der Positivität des „irdischen Pfandes“, um sich seiner selbst zu vergewissern. „Ach Melvil! Nicht allein genug ist sich das Herz, ein irdisch Pfand bedarf der Glaube , das hohe Himmlische sich zuzueignen.“ Garant für diese Erfahrbarkeit des Glaubens ist das religiöse Symbol, das als „irdisches Pfand“ das göttliche Gnadenwirken in die menschliche Erfahrung bringt. Erfahrbar wird diese Präsenz des Gnadenwirkens im Vollzug des Sakraments. Nur vor diesem Hintergrund erscheint Marias Klage verständlich, in ihrem Gefängnis vom Vollzug des Abendmahls ausgeschlossen zu sein. „Der Bischof steht im reinen Meßgewand, er faßt den Kelch, er segnet ihn, er kündet Das hohe Wunder der Verwandlung an, Und niederstürzt dem gegnwärtgen Gotte Das gläubig überzeugte Volk- Ach! Ich Allein bin ausgeschlossen, nicht zu mir In meinen Kerker dringt der Himmelssegen.“
Da gibt sich Melvil als geweihter Priester zu erkennen. Maria beichtet zunächst, indem sie die Schuldverstrickung ihrer geschichtlichen Existenz aus ihrem Glauben heraus bekennt und bereut. Vor dem neuerlichen Bekenntnis von Gattenmord und Bluthochzeit bereut Maria freimütig ihre abermalige Schuldverstrickung, ihre Liebe zu dem bekanntermaßen unwürdigen Leicester und ihren Haß auf Elisabeth. „Von neidschem Hasse war mein Herz erfüllt, Und Rachgedanken tobten in dem Busen. Vergebung hofft ich Sünderin von Gott Und konnte nicht der Gegnerin vergeben.“ Melvil insistiert darauf, dass Maria sich auch zu ihrer möglichen Verstrickung in den Mordanschlag auf Elisabeth durch Babington und Parry bekennt. „Du sagst mir nichts von deinem blutgen Anteil An Babingtons und Parrys Hochverrat? Den zeitlichen Tod stirbst du für diese Tat, Willst Du auch noch den ewgen dafür sterben?“ Doch Maria weist alle Verantwortung für den Mordanschlag von sich. Darin zeigt sich ihre moralische Bildung und Läuterung. (Wie die Ermordung ihres Ehemannes zeigt, blieben ihr solche Maximen in der Vergangenheit fremd.) Der Beichte folgt die Absolution. Sie ist wie folgt gekennzeichnet: Maria kann sich nicht selbst von Schuld freisprechen, sie ist weder scheinheilig noch selbstgerecht. Auch das Recht spielt dabei keine Rolle. Denn die Rechtspraxis steht in der Willkür menschlicher Auslegung, wie die ungerechtfertigte Verurteilung Marias zeigt. Auch ein Freispruch Marias durch eine moralische Instanz scheint undenkbar. Vor deren Rigorismus kann ihre Lebensführung nur verworfen werden. Melvil urteilt darum nicht nach menschlichen Kriterien, sondern in Ankündigung der Gnadeninstanz als „Diener des höchsten Gottes, und sein heilger Mund.“ Er stellt ihr göttliche Vergebung für ihre irdische Schuld in Aussicht. Marias Glaube, der sich in Reue beweist, nicht ihre Läuterung ist dabei Anknüpfungspunkt des Gnadenaktes. Werkgerechtes Denken wird hier distanziert: „Dem selgen Geiste folgen nicht die Schwächen Der Sterblichkeit in die Verklärung nach. Ich aber künde Dir, kraft der Gewalt zu lösen und zu binden, Erlassung an von allen deinen Sünden! Wie Du geglaubet so geschehe Dir.“ Mit dem Vollzug der Kommunion wird Maria nicht nur das ewige Leben und die Verklärung in Aussicht gestellt. Interessanter für Schillers Anthropologie und für die Darstellung der verschiedenen Motivationshorizonte der praktischen Vernunft ist die Darstellung des Freiheitsspielraums, der Maria aus dem Vollzug des Abendmahls erwächst. Mit dem Abendmahl verändert sich der Habitus der verurteilten Königin, sie verwandelt sich grundlegend und wird zu einem andern Menschen. Alle innerweltlich begründbaren Motivationshorizonte praktischer Vernunft werden transzendiert. Diese grundlegende Wandlung Marias zeigt sich in der Vergebung gegenüber Elisabeth. Maria ist nicht nur von
geschichtlicher Schuld freigesprochen. Sie verfällt dieser Schuld auch nicht wieder, sondern konkretisiert ihre neu gewonnene Freiheit, indem sie Elisabeth vergibt. „Der Königin von England Bringt meinen schwesterlichen Gruß – Sagt ihr, Daß ich ihr meinen Tod von ganzem Herzen vergebe, meine Heftigkeit von gestern Ihr reuevoll abbitte – Gott erhalte sie Und schenk ihr eine glückliche Regierung.“ Damit befindet sich Maria bereits innerweltlich in dem von Melvil angekündigten „Freudenreich“, in dem „keine Schuld mehr sein wird.“ Die Selbstbegründung aus einem aufgeklärten Glaubensverständnis zeigt sich damit allen andern Versuchen menschlicher Selbstbegründung überlegen. Auf das Todesurteil reagiert Maria mit der Vergebung gegenüber ihrer Richterin. Abschließend können wir uns mit der Frage beschäftigen, aus welchem Grund Schiller glaubt, seine Anthropologie nicht in philosophisch begrifflicher Systematik, sondern in der Form des Kunstwerks, d.h. in der dramatischen Dichtung darstellen zu sollen. Seinem Anspruch der Darstellung der „Freiheit in der Erscheinung“ gemäß ist Schiller der Auffassung, dass diese Aufgabe sich der Fixierung durch einen Begriff sperrt. Die Darstellung der Motivbildung und der Handlungsmöglichkeiten der menschlichen Praxis sieht Schiller am besten dort aufgehoben, wo dogmatische Festlegungen unterbleiben. Das Drama bietet ihm die Möglichkeit, seine Anthropologie zu konkretisieren, ohne die Selbstbestimmung aus Freiheit auf bestimmte Zwecke oder Lehren hin festzulegen. Ihm geht es nicht darum festzustellen, wie moralische, politische oder religiöse Freiheit in einer konkreten Situation gelebt werden sollten. Schiller ist es darum zu tun, die Handlungsmöglichkeiten aus diesen Instanzen der praktischen Vernunft zu zeigen, gegen einander abzugrenzen und für die konkrete Motivbildung des Einzelnen zu eröffnen. Er sieht seine Aufgabe darin, den Freiheitsspielraum des Menschen offen zu halten. Zur Darstellung dieses Spielraums erscheint ihm die Kunstdarstellung darum am besten geeignet. Um des Freiheitsspielraums der menschlichen Praxis Willen glaubt er sich eine dogmatische Festlegung auf eine im Begriff fixierte Lehre oder Lehrmeinung verbieten zu müssen. Denn die Darstellung menschlicher Freiheits- und Selbstbestimmungsspielräume wäre in Schillers Sinne gescheitert, wenn sie die menschliche Freiheit auf bestimmte Zwecke einschränken und damit den kritischen Diskurs vorab fixieren, beschränken und beenden würde. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
Sie können auch lesen