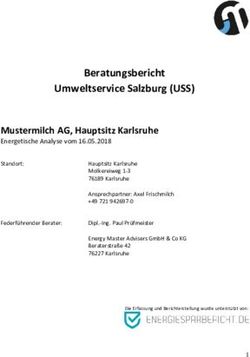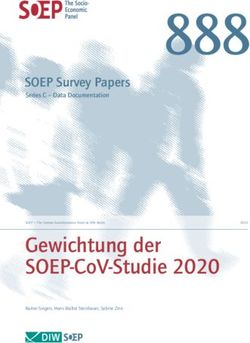SOLTHERMGO ANALYSEN UND CHANCE DER SOLARTHERMIE IM KONTEXT DER GEBÄUDESTANDARDS MINERGIE UND MUKEN
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Eidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt für Energie BFE
Energieforschung und Cleantech
Jahresbericht vom 31.01.2021
SolThermGo
Analysen und Chance der Solarthermie im
Kontext der Gebäudestandards Minergie und
MuKEnDatum: 31.01.2021
Ort: Rapperswil
Subventionsgeberin:
Bundesamt für Energie BFE
Sektion Energieforschung und Cleantech
CH-3003 Bern
www.bfe.admin.ch
Subventionsempfänger/innen:
SPF Institut für Solartechnik
OST Ostschweizer Fachhochschule
Oberseestrasse 10, CH-8640 Rapperswil SG
www.spf.ch
Minergie Schweiz
Bäumleingasse 22, CH-4051 Basel
www.minergie.ch
Sustech GmbH
Neuwiesenstrasse 8, CH-8610 User
www.sustech.ch
Autor/in:
Igor Bosshard-Mojic, SPF Institut für Solartechnik, igor.bosshard@ost.ch
Michel Haller, SPF Institut für Solartechnik
Angela Husi, Minergie, angela.husi@minergie.ch
BFE-Projektbegleitung:
Andreas Eckmanns, andreas.eckmanns@bfe.admin.ch
Elimar Frank, elimar.frank@frank-energy.com
BFE-Vertragsnummer: SI/501947-01
Für den Inhalt und die Schlussfolgerungen sind ausschliesslich die Autoren dieses Berichts
2/22 verantwortlich.Zusammenfassung
Minergie 2017 und MukEn 2014 legen Rahmenbedingungen fest, welche dazu führen, dass mehr
Sonnenkollektoren installiert werden oder auch nicht. Im Projekt wird abgeklärt, welche Faktoren für die
Wahl und den Einsatz von Sonnenkollektoren entscheidend sind. Aufbauend auf den bestehenden
Standards sollen Grundlagen und Tools dahingehend verbessert werden, dass eine vermehrte Nutzung
der Solarwärme stattfinden kann. In einem ersten Schritt werden mit umfangreichen Datensätzen von
Minergie, GEAKplus und der Kantone die Entwicklung der Solarthermie über mehrere Jahre untersucht.
Zusätzlich werden die Gründe für die geringe Nutzung der Solarthermie im Wohnbau mittels Umfragen
bei verschiedenen Akteuren (Planer, Bauherren, Architekten etc.) abgeklärt. In einem zweiten Schritt
werden Grundlagen erarbeitet für die Einbindung von neuartigen Solarkonzepten wie PVT, Eisspeicher
und Erdsondenregeneration in bestehende Berechnungshilfen wie WPesti oder PVopti, um diesen
Systemen eine vereinfachte Einbindung in die behördlichen Energienachweise zu ermöglichen. Die
Auswertung der umfangreichen Datensätze hat einige interessante Resultate ergeben. Die Annahme,
dass die PV die Solarthermie verdrängt, konnte im speziellen bei Neubauten bestätigt werden. Gerade
die Beliebtheit von Wärmepumpen in Kombination mit PV senkt die Nachfrage nach Solarthermie
deutlich. Leider musste auch festgestellt werden, dass auch bei Holzheizungen die Kombination mit
Solarthermie abnimmt. Die Auswertung der Umfragen von über 600 Fachplanern und Architekten
ergänzt die Ergebnisse der Datenbank Auswertung gut. Das Projektteam ist überzeugt, dass aus beiden
Analysen und den nun beginnenden Simulationen und Berechnungen, wichtige Erkenntnisse zur
Solarthermie am Ende des Projektes erlangt werden können.
3/22Inhaltsverzeichnis
Zusammenfassung ................................................................................................................................ 3
Inhaltsverzeichnis ................................................................................................................................. 4
1 Einleitung .................................................................................................................................. 5
1.1 Ausgangslage und Hintergrund .................................................................................................. 5
1.2 Motivation des Projektes ............................................................................................................ 5
1.3 Projektziele ................................................................................................................................. 6
2 Vorgehen und Methode............................................................................................................ 7
3 Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse ............................................................................... 9
3.1 Minergie-Datenbank ................................................................................................................. 10
3.2 GEAK-Datenbank ..................................................................................................................... 12
3.3 Umfrage .................................................................................................................................... 16
4 Bewertung der bisherigen Ergebnisse................................................................................. 21
5 Weiteres Vorgehen ................................................................................................................. 21
6 Nationale und internationale Zusammenarbeit ................................................................... 22
7 Publikationen .......................................................................................................................... 22
8 Literaturverzeichnis ............................................................................................................... 22
4/221 Einleitung
1.1 Ausgangslage und Hintergrund
Der Markt im Bereich der Solarthermie stagniert seit mehreren Jahren auf tiefem Niveau. Um jedoch die
Ziele der Energiestrategie 2050 des Bundes zu erreichen, bedarf es unterschiedlicher Technologien.
Der Wärmesektor ist für 50% des Endenergieverbrauchs verantwortlich, und trotzdem wird dieser im
Vergleich zum Stromsektor wenig thematisiert. Die Solarthermie kann einen wichtigen Beitrag zur
Erfüllung dieser Ziele beitragen und nebenbei auch die Industrie stärken, da diese nach wie vor in der
Schweiz gut vertreten ist und auch in der Schweiz produziert. Die Energieperspektiven 2050 [1] sehen
je nach Szenario für die Solarthermie einen Deckungsanteil des Raumwärme- und Warmwasserbedarfs
von 6% bis 19% (vorwiegend Warmwasser). Der Anteil im Jahr 2017 betrug ca. 0.6% [2]. Um das
Szenario "Weiter wie bisher" (6%) zu erreichen, wird bis 2050 eine Kollektorfläche von 7.3 Mio.m2
benötigt. Die Zubaurate von heute 53'000 m2 müsste bereits bei diesem Minimalziel um den Faktor 3.4
erhöht werden. Im Szenario "Neue Energiepolitik" sollen 19% des Heiz- und Warmwasserbedarfs solar
gedeckt werden. Dafür würde eine 8-fache Zubaurate benötigt. Die Studie energy [r]evolution [3] geht
sogar von einem noch grösseren Beitrag der Solarthermie aus. Betrachtet man aktuellere Studien die
sich mit der Energiewende in der Schweiz befassen [4–6], so kann festgestellt werden, dass in keiner
Studie die Solarthermie vorkommt. Der Fokus liegt überwiegend beim Strombedarf, und dies obwohl
50% der Energiewende im Wärmesektor erfolgen muss. In diesen Zukunftsszenarien wird die
Wärmeerzeugung für die Gebäude vorwiegend über Wärmepumpen bewerkstelligt. Damit wird deutlich,
dass der Solarwärme deutlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden muss. Mit dem Projekt
"SolThermGo" soll ein Beitrag geleistet werden, um die Gründe für dieses Aufmerksamkeits-Defizit zu
ermitteln und einen offensichtlichen Missstand zu beheben.
Die MuKEn (2014) und der Minergiestandard (2017) weisen ambitionierte Grenzwerte bezüglich dem
gewichteten Energiebedarf (ohne Anrechnung von PV Strom) auf. Ohne eine sehr gute Dämmung
können diese beispielsweise mit einer Luftwärmepumpe als Wärmeerzeuger nur schwer eingehalten
werden. Durch die Integration einer Solarthermieanlage können die Grenzwerte jedoch erreicht werden.
Je nach Dimensionierung kann durch den Einsatz einer Solarthermieanlage auch die Dämmung
reduziert werden, was an anderer Stelle Kosten und auch graue Energie einspart. Zudem ist die
Ergänzung mit einer solarthermischen Warmwasseranlage eines der einfachsten Standardkonzepte,
welches beim Heizungsersatz zu einer automatischen Einhaltung der Grenzwerte führt. Aus diesem
Grund wurde die Einführung der MuKEn 2014 und der darin erhaltenen Standardlösungen als grosse
Chance für die Solarwärme angesehen. Mittlerweile ist die MuKEn 2014 in einigen Kantonen eingeführt
und auch in die Vorgaben von Minergie integriert worden. Ob dies tatsächlich zu einer grösseren
Verbreitung von Solarwärmeanlagen geführt hat, ist (auch aufgrund von Einschätzungen zuständiger
Behörden) unsicher und wird in diesem Projekt systematisch analysiert.
1.2 Motivation des Projektes
Es wird vermutet, dass neben rein wirtschaftlichen Aspekten auch die bestehenden Berechnungstools
der Kantone und von Minergie eine Hürde für die Solarthermie darstellen. Es gibt kaum eine
Hilfestellung zur Ermittlung des Einflusses unterschiedlich dimensionierter Solarthermieanlagen auf das
Erreichen der Grenzwerte. In den verfügbaren Tools fehlen zudem oft einfache Abschätzungen zum
Nutzen neuerer Anlagenkonzepte wie PVT-Kollektoren, Eisspeicher, oder die Regeneration von
Erdsonden. Dabei kann auch hier die Solarwärme einen Beitrag leisten um die Jahresarbeitszahl (JAZ)
von Wärmepumpen zu erhöhen, oder eine grössere (Erdsonden)-Anlage überhaupt erst möglich zu
machen. Der Regeneration der Erdsonden wird in Zukunft auch vom SIA voraussichtlich mehr Gewicht
5/22gegeben durch die Revision der SIA 384-6 (Auslegung Erdwärmesonden)1, welche kurz vor der
Vernehmlassung steht.
1.3 Projektziele
In einem ersten Schritt, soll im Projekt ermittelt werden, welchen Einfluss die Einführung der MuKEn
2014 und die Anforderungen des Minergie-Standards auf die Verbreitung von Solarwärmeanlagen hat.
Weiter werden die Gründe, die zum Entscheid für oder gegen eine Solarwärmeanlage führen, eruiert,
und die Hemmschwellen unterschiedlicher Interessensgruppen aufgenommen und quantifiziert. Daraus
sollen einerseits sowohl die technischen als auch die ökonomischen Zielvorgaben für die Branche
definiert werden, anderseits sollen auch Empfehlungen für Behörden und Förderinstitutionen erarbeitet
werden.
Im zweiten Schritt, wird die Solarthermie in Kombination mit anderen Technologien bezüglich Steigerung
der Energieeffizienz sowohl im Neubau als auch im Umbau untersucht. Damit sollen Grundlagen und
Informationen erarbeitet werden, die eine Hilfestellung für die Praxis bieten, mit dem Ziel, die Akzeptanz
und damit auch die Zubaurate der Solarthermie zu steigern. Mit Hilfe eines Berechnungstools soll
ermöglicht werden "neue" Anwendungsfälle der Solarthermie wie PVT, Eisspeicher und
Erdsondenregeneration in die bestehenden Energienachweisberechnungen der Kantone und von
Minergie einzubinden. Das Projektteam erarbeitet Vorschläge, wie eine Integration der ermittelten
Kennzahlen in die Antragsformulare von Minergie und MuKEn vollzogen werden kann. Damit soll
erreicht werden, dass der Bewilligungsprozess von neuen Anwendungsgebieten der Solarwärme stark
vereinfacht wird.
1
Referat von Arthur Huber im Rahmen des energie-cluster Treffens "IG Wärmespeicher Wärmetauscher" am 7. Mai 2019
6/222 Vorgehen und Methode
Das Projekt gliedert sich in vier Phasen, welche nachfolgend im Detail beschrieben werden.
Phase 1: Datenerhebung und Auswertung
In einem ersten Schritt, werden von unterschiedlichen Quellen Daten zu Gebäudeparameter und
installierten Heizungssystem bezogen. Folgende Datenquellen werden im Projekt genutzt:
- Minergie-Datenbank: Diese enthält für ca. 1500 Objekte Nachweise welche die Anforderungen
der MuKEn 2014 erfüllen. Noch viel mehr Daten stehen für Objekte vor 2017 zur Verfügung.
Diese werden zu Vergleichszwecken verwendet.
- Kantonale Datenbanken: Der Kanton Basel-Land, einer der ersten Kanone welche die MuKEn
2014 (teilweise) umgesetzt hat, stellt umfangreiche Daten zur Verfügung. Weitere Kantone
werden angefragt. Dabei wird auf Kantone fokussiert, welche die neuen MuKEn umgesetzt
haben.
- GEAK-Datenbank: Es stehen ca. 3000 GEAK Plus Nachweise zur Verfügung. Über die GEAK+
Daten soll ausgewertet werden, wie oft Solarthermie in den Varianten vorgeschlagen, mit
welchen Wärmeerzeugern sie kombiniert, und welchen Systemen diese Kombination
gegenübergestellt wird.
In einem zweiten Schritt werden diese Daten idealerweise in Kombination ausgewertet. Dabei ist jedoch
zu berücksichtigen, dass gerade die kantonalen Daten sehr wahrscheinlich unterschiedliche Qualitäten
aufweisen. Es wird versucht zu ermitteln, ob die Gesetzgebung und die Bauvorschriften einen Einfluss
auf die Entwicklung der Solarthermie in den letzten Jahren hatten. Dabei sind ökonomische und
technische Einflussfaktoren, wie zum Beispiel die Zinsentwicklung oder die Förderung in den einzelnen
Kantonen zu berücksichtigen.
In einem dritten Schritt, werden Entscheidungsträger, die einen Einfluss darauf haben ob eine
Solaranlage gebaut wird oder nicht, mittels Umfragen und Interviews befragt. Damit sollen Bedürfnisse
und Beweggründe aus der Praxis erfasst und analysiert werden. Es ist vorgesehen folgende Akteure zu
befragen:
- Endkunden
- Planer / Energieberater / Architekten
- Installateure
Der Kontakt zu den einzelnen Akteuren wird hauptsächlich über Minergie gewährleistet und zusätzlich
wird versucht über den Verein GEAK und den SIA an Kontakte zu gelangen.
Phase 2: Analyse unterschiedlicher Solarthermiekonzepte
In der Phase 2 werden die am häufigsten verwendeten Solarthermiekonzepte (z.B.: Holzpellet & Solar,
Gas/Öl & Solar) zusammengefasst und beschrieben. Dabei wird auf die Arbeit von Perret et al [7]
aufgebaut. Die Konzepte mit Solarwärme werden den Konzepten ohne Solarwärme gegenübergestellt
und bezüglich Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit miteinander verglichen. Speziell zu erwähnen sind
zum Beispiel die stark boomenden Wärmepumpenboiler für die Warmwasserbereitstellung. Bei der
Analyse wird auch mitberücksichtig, ob dank der Solarwärme zum Beispiel auch die Dämmstärke
angepasst werden kann, was wiederum die Gesamtwirtschaftlichkeit eines Konzeptes mitbeeinflusst.
Auch kann die Solarthermie bei Sanierungen von denkmalgeschützten Gebäuden vorteilhaft sein, da in
solchen Fällen in der Regel keine Aussendämmung angebracht werden kann.
7/22Phase 3: Erarbeitung von Hilfestellungen
Für neue Technologien und Konzepte die sich am Markt etablieren sollen die Berechnungsgrundlagen
erarbeitet werden, damit diese in den Nachweistools verwendet werden können. Konkret handelt es
sich um folgende Technologien und Konzepte:
- Fassadenkollektoren: diese können dazu beitragen, dass der Konkurrenzkampf zwischen PV
und Solarthermie entschärft wird. Jedoch fehlt es an einfach Mitteln diese im Energienachweis
zu integrieren, respektive an einer einfachen Hilfestellung um die Erträge in den
Energienachweis zu übertragen. Beispielsweise sollte bei Fassadenkollektoren auch
berücksichtig werden, dass diese nicht von Schnee bedeckt sind im Winter.
- PVT-Kollektoren: diese können auch einen Beitrag zur Entschärfung der Flächenkonkurrenz
auf dem Dach beitragen.
- Eisspeicher dienen als Wärmequelle für Wärmepumpen und werden in der Regel mit
Solarwärmekollektoren regeneriert.
- Erdsondenregeneration kann mittels Solarwärme durchgeführt werden, damit kann die JAZ der
Wärmepumpe gesteigert und die Bohrung verkürzt werden. Es werden Projekte möglich, die
ohne Regeneration auf Grund einer mittelfristigen Auskühlung des Erdreichs gar nicht möglich
wären. Hier soll mit einem Tool dieser Effekt vereinfacht dargestellt werden und damit die
Möglichkeit geschaffen werden diesen Vorteil der Solarwärme für die Minergie und MuKEn
Nachweise zu quantifizieren.
Je nach Fragestellung und Komplexität werden unterschiedliche Simulationswerkzeuge verwendet um
die Grundlagen aufzuarbeiten.
Damit die Solarthermie eine höhere Akzeptanz bei den Planern und Architekten erhält, müssen die
Vorteile einer thermischen Solaranlage möglichst schnell und einfach (praxistauglich) ermittelt werden
können. Für einfache herkömmliche Solaranlagen werden dazu Mindestanforderungen an die
Kollektorfeldgrösse gestellt, welche automatisch zu einem Einhalten der Grenzwerte führen. Bei den
oben erwähnten neuen Anwendungen der Solarwärme ist dies ev. nicht mehr zielführend, weil diese
auch mit anderen Komponenten der Energieerzeugung zusammenspielen. So wird z.B. der elektrische
Ertrag von PVT Kollektoren durch die thermische Aktivierung gesteigert, oder die Arbeitszahl der
Wärmepumpe durch die Regeneration der Erdwärmesonde verbessert. Diese Effekte können die
Energieeffizienz eines Gebäudes verbessern und das Erreichen der Grenzwerte erleichtern und sollen
daher quantifiziert werden können. Aus diesem Grund werden einfache Berechnungshilfen nach dem
Vorbild bestehender Tools wie WPesti oder PVopti erstellt. Möglich ist eine eigenständige
Berechnungshilfe für Solarthermie oder die Erweiterung bestehender Tools, wobei diese Möglichkeit
noch genauerer Abklärungen bedarf. Der Entscheid für den einen oder anderen Weg wird in
Zusammenarbeit mit der Begleitgruppe und den Projektpartnern gefällt. Das Tool soll in jedem Fall frei
zugänglich sein und als Grundlage für MuKEn oder Minergie Nachweise akzeptiert werden.
Phase 4: Erarbeitung von Informationsgrundlagen und Anforderungen an die Branche
Die Ergebnisse werden in einem Schlussbericht zusammengefasst. Der Bericht dient als Grundlage für
die Erarbeitung von Aus- und Weiterbildungskursen zur Förderung der Solarkonzepte, oder der
Entwicklung von Merkblättern (EnergieSchweiz). Auch sollen aus den Resultaten konkrete
Anforderungen an die Solarwärme-Branche definiert werden, um die Verbreitung der
Solarwärmeanlagen zu erhöhen. Im Bericht werden auch konkrete Vorschläge und Anpassungen der
Kennzahlen in den Antragsformularen von Minergie und MuKEn beschrieben. Das Projektteam setzt
sich in Verbindung mit Vertretern der EnDK um die Ergebnisse dieses Projektes auch in den Kantonen
bekannt zu machen.
8/22Eine Begleitgruppe aus Vertretern der Kantone, Hersteller, Installateure, Architekten und Planer soll
helfen eine möglichst grosse Akzeptanz des Projektes zu gewährleisten. Es sind mehrere Workshops
vorgesehen um die Resultate und das weiter Vorgehen im Projekt zu besprechen.
Die Resultate aus dem Projekt werden sowohl in Fachzeitschriften als auch auf Konferenzen präsentiert.
Weiter ist vorgesehen, die erarbeiteten Berechnungshilfen in Form von Newslettern gezielt an die
Anwender zu verschicken.
3 Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse
Das Projekt ist am 1. Oktober 2019 gestartet. Das Kick-Off Meeting mit den Projektbeteiligten und dem
BFE wurde am 22. Oktober 2019 durchgeführt. Nachfolgend sind die wichtigsten Ergebnisse dieses
Meetings zusammengefasst.
- Bei der Auswertung der Daten soll berücksichtigt werden, dass Einflussfaktoren wie
Preisentwicklung von PV, Energiepreise, Zinsen etc. einen Einfluss auf die Entwicklung der
Solarthermie haben.
- Die Überarbeitung der MuKEn (2025) ist im Gange und sollte im Projekt mitberücksichtigt
werden. Es wird ein reger Austausch mit den Kantonen im Projekt angestrebt.
- Die aktuelle nationale Entwicklung (Vorstoss Ständerat bezüglich maximalen CO2-
Ausstosswerten für fossile Heizungen) würde einen wesentlichen Einfluss auf diese Studie
haben, da Solarthermie oft in Kombination mit fossilen Energieträgern eingesetzt wird.
- Die Erfahrung des Vereins Minergie zeigt, dass die grösste "Konkurrenz" zur Solarthermie die
PV ist, welche oft vollflächig auf dem Dach ausgeführt wird, obwohl eine kleinere Anlage zum
Erreichen der Grenzwerte reichen würde.
- Die Gebäudehüllzahl sollte im Projekt speziell berücksichtigt werden, da diese aktuell je nach
Gebäude einen Einfluss darauf haben kann, ob eine Solarthermieanlage benötigt wird um die
Grenzwerte einzuhalten. Dies ist vor allem bei der Wahl der Referenzgebäude zu
berücksichtigen.
Die Daten zu Gebäuden und den Heizungssystemen stammen vorwiegend aus drei Datenquellen.
Diese sind die Minergie-Datenbank, die GEAK-Datenbank und die Baugesucherfassung des Kantons
Basel-Land. Es wurden weitere zehn Kantone angefragt, jedoch waren die Daten aus diesen Kantonen,
falls überhaupt vorhanden, nur bedingt brauchbar für SolThermGo. Es zeigte sich auch, dass die
aktuelle Datenlage bei den Kantonen allgemein als sehr schwach zu beurteilen ist. Nachfolgend sind
die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst (Minergie- und GEAK-Datenbank), detaillierte Angaben
und die Resultate von Basel-Landschaft folgen im Schlussbericht. Die Ergebnisse zum Markt und zur
Fördersituation wurden ausführlich im Jahresbericht 2019 beschrieben und werden hier nicht erneut
aufgeführt.
9/223.1 Minergie-Datenbank
Der Verein Minergie stellte für die Analyse ihre schweizweit gesammelten Daten aus den Anträgen zur
Minergie-Zertifizierung zur Verfügung. Aus diesem Datenpool wurden für das Projekt ausschliesslich
Ein- und Mehrfamilienhausanträge über den Zertifizierungszeitraum von 1998 bis 2019 ausgewertet
(siehe Abbildung 1). Dabei stammt der Hauptteil (92%) der Zertifizierungsanträge aus dem Zeitraum
von 2005 bis 2019.
Abbildung 1 Verteilung der untersuchten Minergie Daten für Ein- und Mehrfamilienhäuser unterteilt nach Antragsjahr
Insgesamt handelt es sich um 19'910 Anträge für Einfamilienhäuser (EFH) und 16'834 Anträge für
Mehrfamilienhäuser (MFH), die für das Projekt auf den Einsatz von Solarthermie untersucht wurden.
Diese Anträge basieren fast ausschliesslich auf Neubauten (EFH 93%, MFH 95%) und nicht auf
Sanierungsobjekten.
Die Untersuchungen der installierten Wärmeerzeuger in Bezug auf den Heizwärmebedarf zeigen, dass
seit 2007 in neuen Ein- und Mehrfamilienhäuser hauptsächlich Wärmepumpen installiert wurden. Bei
nach Minergie Standard gebauten Wohnhäusern installierten 78% der Einfamilienhäuser und 66% der
Mehrfamilienhäuser eine Wärmepumpe. Nur ein kleiner Anteil der Minergie zertifizierten Wohnhäuser
setzen in der Wärmeerzeugung auf die alternativen Energieträger Holz (EFH: 8%, MFH: 9%),
Fernwärme (4%, 11%) oder Gas (4%, 7%). Ebenfalls nur wenige nach Minergie zertifizierten
Wohngebäude setzen auf eine Kombination aus zwei oder mehr Wärmeerzeuger.
Beim Einsatz von Wärmepumpen wird hauptsächlich auf Aussenluft oder Erdsonden als Wärmequelle
gesetzt. Während sich bei Einfamilienhäusern die Anzahl an Aussenluft und Erdsonden Wärmepumpen-
Systeme gleichmässig aufteilt, werden bei Mehrfamilienhäusern mit höherem Gesamtwärmebedarf
hauptsächlich Erdsonden Wärmepumpen-Systeme installiert. Der Anteil von Solarenergie (Solarwärme
und Solarstrom) bei Wärmepumpen–Systemen beträgt bei Einfamilienhäusern 33% und bei
Mehrfamilienhäusern 27%, wobei 23% der Einfamilienhäuser und 15% der Mehrfamilienhäuser eine
Solarthermieanlage installierten. Die Aufteilung der Anteile von Solarthermie, Photovoltaik oder der
Kombination beider Systeme für die häufig genutzten Energiequellen Aussenluft und Erdsonden ist in
Abbildung 2 (rechts) nach Antragsjahr aufgeführt.
10/22Einfamilienhaus Einfamilienhaus
2’500 100%
90%
2’000
80%
70%
Anzahl [‐]
1’500
60%
Anteil [%]
1’000 50%
40%
500
30%
0 20%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
10%
WP Aussenluft WP Aussenluft + Solarenergie 0%
WP Erdsonde WP Erdsonde + Solarenergie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
WP Grundwasser WP Grundwasser + Solarenergie WP Aussenluft + SolTh WP Aussenluft + SolTh + PV WP Aussenluft + PV
Minergie Anträge WP Erdsonde + SolTh WP Erdsonde + SolTh + PV WP Erdsonde + PV
Mehrfamilienhaus Mehrfamilienhaus
100%
2’500
90%
2’000 80%
70%
Anzahl [‐]
1’500
60%
Anteil [%]
1’000 50%
40%
500
30%
20%
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 10%
WP Aussenluft WP Aussenluft + Solarenergie 0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
WP Erdsonde WP Erdsonde + Solarenergie
WP Grundwasser WP Grundwasser + Solarenergie WP Aussenluft + SolTh WP Aussenluft + SolTh + PV WP Aussenluft + PV
Minergie Anträge WP Erdsonde + SolTh WP Erdsonde + SolTh + PV WP Erdsonde + PV
Abbildung 2 Links: Anzahl Wohngebäude mit installierter Wärmepumpe unterteilt nach Energiequelle der Wärmepumpen und Zertifizierungsjahr für Einfamilienhäuser im oberen Diagramm und
Mehrfamilienhäuser im unteren Diagramm. Rechts: Aufschlüsslung der Solarenergie in die Anteile Solarthermie, Photovoltaik und deren Kombination für die installierten Aussenluft- und Erdsonden-
Wärmepumpen.
11/22Die Anzahl installierte PV-Anlagen (siehe Abbildung 3) steigt bei den Ein- sowie Mehrfamilienhäuser
über die Jahre deutlich an. Dabei steigt sehr wahrscheinlich aufgrund der PV-Anlagenpflicht ab dem
Jahr 2018 der Anteil an Einfamilienhäuser mit einer PV Anlage von 11% im Jahr 2013 auf 93% im Jahr
2019 resp. für Mehrfamilienhäuser von 7% im Jahr 2013 auf 91% im Jahr 2019. Über diesen
Betrachtungszeitraum stieg bei den Mehrfamilienhäusern der Anteil an PV-Anlagen mit einer
spezifischen Leistung die grösser als 10 Wpeak/(m2 EBF) von 46% auf 92% deutlich an. Bei den
Einfamilienhäusern lag der Anteil bereits im Jahr 2013 bei 85% und stieg auf 95% im Jahr 2019 an.
Dieser hohe Anteil der installierten PV-Anlagen mit einer spezifischen Leistung von mehr als 10
Wpeak/(m2 EBF) lässt vermuten, dass bei Neubauten die verfügbare Dachfläche komplett für den Bau
von PV Anlage verwendet wird.
Einfamilienhaus Mehrfamilienhaus
500 100% 500 100%
Anteil Eigenstromproduktion >10 Wp/m2
450 90% Anteil Eigenstromproduktion >10 Wp/m2 450 90%
91%
400 80% 400 80%
Anzahl PV Anlagen [‐]
Anzahl PV Anlagen [‐]
350 70% 350 70%
60%
300 60% 300 60%
93%
250 50% 250 50%
74%
22%
25%
23%
34%
200 40% 200 40%
16%
30%
14%
11%
150 30% 150 30%
11%
100 20% 100 20%
7%
50 10% 50 10%
0 0% 0 0%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Anzahl PV Anlagen Anteil PV Anlagen spez. Leistung >10Wp/m² EBF Anzahl PV Anlagen Anteil PV Anlagen spez. Leistung >10Wp/m² EBF
Abbildung 3 Anzahl installierter PV-Anlagen (orange Balken, Primärachse) sowie der Anteil dieser Anlagen mit einer Leistung die
10Wp/m2 übersteigen (grüne Linie, Sekundärachse). Die Prozentangabe in den orangen Balken gibt den Anteil der neuerstellten
Gebäude mit einer installierten PV-Anlage an.
3.2 GEAK-Datenbank
Neben den mehrheitlich aus Neubauanträgen bestehenden Minergie-Daten wurden parallel vom Verein
GEAK die Gebäudebestandsdaten sowie die unterbreiteten Optimierungsvarianten aus GEAK-
Nachweisen untersucht. Für die Analyse wurden ausschliesslich Ein- und Mehrfamilienhäuser aus den
GEAK-Publikationsjahren 2012 bis 2019 ausgewertet. Dabei wurden 87% der ausgewerteten
Nachweise im Zeitraum 2017 bis 2019 publiziert. In die Auswertung flossen die Nachweise von
insgesamt 28'863 Einfamilienhäuser und 20'658 Mehrfamilienhäuser ein. Die regionale Verteilung der
bis 2019 durchgeführten GEAK-Nachweise ist in Abbildung 4 dargestellt.
12/22 Abbildung 4 Aufteilung der analysierten GEAK-Nachweise nach Kanton für Ein- und MehrfamilienhäuserDie Anzahl installierter Solarthermie Anlagen im Ist-Zustand belaufen sich auf 2'907 Anlagen in
Einfamilienhäuser und 2'220 Anlagen in Mehrfamilienhäuser. Diese Anzahl entspricht sowohl im Ein-
wie auch im Mehrfamilienhaus einem Anteil von 10% der GEAK Bestandesaufnahmen. In Abbildung 5
sind die unterschiedlichen Kombinationen von Heizung und Solarthermie aufgeführt. Dabei ist
ersichtlich, dass im EFH die Aufteilung gleichmässiger ist als im MFH. Im MFH dominiert die Gas-Solar-
Kombination mit fast 50%. Überraschend hoch mit 26% ist der Anteil an Wärmepumpen-Solar-
Systemen im EFH. Die Rubrik "Rest" beinhaltet alle Systeme die mehrere unterschiedliche
Wärmeerzeuger aufweisen und eher Spezialfälle sind und eine geringe Relevanz haben.
Abbildung 5 Aufteilung der unterschiedlichen Wärmeerzeugersysteme mit Solarthermie in Wohngebäuden
Neben der Nutzung von Solarthermie im Wohngebäudebestand können aus der GEAK-Datenbank auch
die Empfehlungen zur Gebäude- oder Heizungsmodernisierung des GEAK-Experten ausgewertet
werden. Die Auswertung der Optimierungsvorschläge soll zeigen, wie oft und in welcher Kombination
Solarthermie zur Wärmeerzeugung vorgeschlagen wird. Dazu wurde in Abbildung 6 die Anzahl der
ausgewählten Optimierungsmassnahmen der Gebäudehüllenoptimierung und der Wärmeerzeuger-
optimierung mit erneuerbaren Energien dargestellt.
Die Auswertung zeigt, dass in Ein- und Mehrfamilienhäusern am häufigsten eine Gebäudehüllen-
optimierung als Teil der Optimierungsvariante vorgeschlagen wurde. In Einfamilienhäusern stieg ab
dem Jahr 2017 mit vielen durchgeführten GEAK-Nachweisen neben der Gebäudehüllenoptimierung
auch die Empfehlung zur Installation einer Wärmepumpe. Auch bei den Mehrfamilienhäusern stieg, trotz
der sinkenden Anzahl an GEAK-Nachweisen ab dem Jahr 2018, die Anzahl der Empfehlungen von
Wärmepumpen-Systemen an. Der Anteil an Empfehlungen für eine neue Solarthermie Anlage für
Einfamilienhäuser lag 2013 bei einem Höchstwert von 30% und senkte sich mit steigender Anzahl an
GEAK-Varianten auf 10% in den Jahren 2017 bis 2019. Dieser Trend lässt sich auch bei den
Mehrfamilienhäusern in weniger deutlicher Form nachweisen. Der Höchstwert an Solarthermie-
Empfehlung liegt ebenfalls mit 22% im Jahr 2013, sinkt danach im Vergleich zu den Einfamilienhäusern
aber weniger stark auf einen Anteil von 14% der Empfehlungen in den Jahren 2017 bis 2019. Den
gegenteiligen Trend weist die Empfehlung zu Photovoltaik Anlagen (PV) bei Ein- und Mehrfamilien-
häuser auf. Die Empfehlung zur Installation einer PV Anlage erhöht sich bei Einfamilienhäusern von 5%
im Jahr 2013 auf 33% im Jahr 2019. Auch bei Mehrfamilienhäuser stieg der Anteil der Empfehlung für
eine PV Anlage von 3% im Jahr 2013 auf 25% im Jahr 2019. 13/22Abbildung 6 Anzahl unterbreitete Optimierungsvorschläge in den ausgearbeiteten GEAK-Varianten, unterteilt nach GEAK-
Publikationsjahr für Einfamilienhäuser im oberen Diagramm und für Mehrfamilienhäuser im unteren Diagramm. Die Gesamtanzahl
GEAK-Varianten ist die Summe aller Varianten.
In Abbildung 7 wird weiter untersucht, wie oft in den GEAK-Varianten die Installation eines
neuen Wärmeerzeugers in Kombination mit Solarthermie empfohlen wurde. Die Auswertung
weist bei Ein- und Mehrfamilienhäuser auf eine rückläufige Empfehlung der Kombination von
Wärmepumpen sowie Heizkesseln (Holz, Gas und Öl) mit Solarthermie hin. Dabei fällt in den
GEAK-Varianten der geringe Anteil von 20 - 30% der Empfehlung eines neuen Heizkessels in
Kombination mit einer Solarthermieanlage im Jahr 2019 auf. In 70 - 80% der Empfehlungen
zur Installation eines neuen Heizkessels wird auf die Kombination mit Solarthermie verzichtet.
Diese Erkenntnis ist ernüchternd, da hier von Seiten der Industrie ein grosses Marktpotenzial
für die Solarthermie erwartet wird, und die Kombination von Holzkesseln mit Solarthermie auch
aus technischer Sicht sinnvoll ist (Reduktion von Emissionen und Takten, bessere
Betriebszustände etc.).
14/22Einfamilienhaus
0.8
0.7
Anteil an Wärmeerzeuger [%]
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Publikationsjahr GEAK Nachweis
Mehrfamilienhaus
0.8
0.7
Anteil an Wärmeerzeuger [%]
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Publikationsjahr GEAK Nachweis
Abbildung 7 Anteil der Empfehlung zur Installation eines neuen Wärmeerzeugers in Kombination mit einer Solarthermieanlage für
Einfamilienhäuser im oberen Diagramm und für Mehrfamilienhäuser im unteren Diagramm.
Am 3. April 2020 wurde mit der Begleitgruppe ein erster Workshop durchgeführt. An diesem wurden die
Resultate aus der Analyse der Daten von Minergie, GEAK und Kanton Basel-Land besprochen.
Nachfolgend sind die wichtigsten Inputs der Begleitgruppe zusammengefasst (Protokoll wurde an den
Programmleiter versandt):
Der Einbruch der Solarthermie bei Minergie zertifizierten Gebäuden ist zum Teil auf folgende Gründe
zurückzuführen:
Vor Minergie 2017 wurde häufig Solarthermie benötigt, um die gewichtete Energiekennzahl
einzuhalten. Alternativ zur Solarthermie konnte auch die PV dafür verwendet werden, jedoch
waren in den Jahren (ca.) 2008-2014 die Preise für PV noch zu hoch, weshalb vorwiegend
Solarthermie eingesetzt wurde. Zwischen 2014-2017 sanken die Preise deutlich und die PV
ersetzte die Solarthermie.
15/22 Die Jahresarbeitszahl der Wärmepumpen hat sich laufend verbessert (inklusive Etablierung der
Invertertechnologie), was auch dazu geführt hat, dass die Energiekennzahlen ohne
Solarthermie eher erfüllt werden konnten.
Solarthermie wird nach wie vor benötigt, um die Anforderungen zu erfüllen bei Gebäuden, die
ein "ungünstiges" Verhältnis von Gebäudehülle zu EBF aufweisen.
Es häufen sich die Anfragen bei Minergie bezüglich PVT-Anlagen. Leider kann in der Datenbank aktuell
nicht unterschieden werden, ob es sich bei den Anlagen mit SolTh&PV um PVT Anlagen handelt oder
um parallele Installationen. Die Integration von "neuen" Technologien wie PVT, Eisspeicher und vor
allem Erdsondenregeneration in bestehende Tools, wie zum Beispiel WPesti, stösst auf Interesse bei
der Begleitgruppe. Die Begleitgruppe ist klar der Meinung, dass eine Integration möglichst in
bestehenden und etablierten Tools erfolgen soll (keine Entwicklung von neuen Tools).
Die Erdsondenregeneration soll auch im speziellen im städtischen Kontext betrachtet werden, wenn
beispielsweise nicht genügend Erdsonden erstellt werden können (Kosten/Nutzen der Solarthermie
aufzeigen in solchen Situationen).
3.3 Umfrage
Im Sommer 2020 wurde eine digitale Umfrage bei unterschiedlichen Bauprojekt-Beteiligten gemacht.
Ziel der Umfrage war die Ermittlung der Bekanntheit der Solarthermie, die Identifikation der wichtigsten
Entscheidungsträger sowie gängige Vorurteile oder Ansichten aufzudecken. Dabei waren die
Unterschiede zwischen den verschiedenen Zielgruppen ebenfalls von zentralem Interesse.
An der Umfrage haben im Zeitraum von Juni – September 2020 670 Personen teilgenommen. Nach
Bereinigung von frühzeitig abgebrochenen Rückmeldungen, wurden 602 Antworten in die Auswertung
miteinbezogen. Nachfolgend werden einige Resultate aus der Umfrage aufgeführt, die Gesamt-
auswertung wird im Schlussbericht im Detail beschrieben.
Die Charakterisierung der Umfrageteilnehmenden nach Zielgruppe zeigte sich wie folgt.
Abbildung 8 Aufteilung der Umfrageteilnehmenden anhand von Zielgruppen.
16/22Frage 1: "Mit welchem Typ von Solarthermie-Anlagen haben Sie persönlich Erfahrung gemacht
(Mehrfach-auswahl möglich)?"
Energieberater und HLK-Planer nennen am häufigsten MFH/EFH Warmwasser oder Kombi (Warmwas-
ser + Heizung). PVT, Erdsondenregeneration sowie nicht abgedeckte Kollektoren werden jeweils zu
einem Anteil von ca. 10% angegeben. Bei den Architekten zeigt sich ein etwas anderes Bild. Dort sind
die Anteile PVT, Erdsondenregeneration relativ ausgeglichen. Dafür werden nicht abgedeckte
Kollektoren kaum genannt (2.5%).
Abbildung 9 Antworten für alle drei Planergruppen zusammengefasst zur Erfahrung mit Solarthermie (HLK-Planer, Energieplaner und
Architekten).
Abbildung 10 Antworten der Bauherren zur Erfahrung mit Solarthermie.
17/22Frage 2: " Wer liefert den entscheidenden Input zur Wahl des Wärmeerzeugungssystems?"
Abbildung 11 Antworten über alle Gruppen hinweg inklusive Bauherren zur Frage 2.
Über alle Beantwortungen gesehen, werden die HLK-Planer und Energieberater als die wichtigste
Entscheidungshilfe angegeben. Spannend ist, dass jede Planergruppe sich selbst als die
ausschlaggebende Komponente betrachtet.
Wenn man die Bauherren betrachtet, ergibt sich ein ähnliches Bild wie bei der Gesamtbetrachtung. Da
dort nur wenige Rückmeldungen kamen, sind die Prozentzahlen aber mit Vorsicht zu geniessen.
Aufgrund der Rückmeldung der Bauherren scheinen die Installateure sowie das private Umfeld eher
eine kleinere Rolle zu spielen.
Frage 3: " Aus welchen Gründen wird aus Ihrer Sicht die Solarthermie nicht empfohlen?"
Abbildung 12 Zusammenfassung der Antworten über alle Planergruppen hinweg zur Frage 3.
Das Preis-Leistungs-Verhältnis scheint bei den Kontra-Punkten eine viel grössere Rolle zu spielen. Was
den Schluss zulässt, dass dieses insgesamt als ungenügend wahrgenommen wird. Komplexität,
Nutzen-Aufwand-Verhältnis sowie fehlendes Budget werden ungefähr gleich häufig als Gründe gegen
den Einsatz von Solarthermie genannt. Bei den Architekten scheint das Budget der Kunden eine
18/22grössere Rolle zu spielen. Sie sehen das Nutzen-Aufwand-Verhältnis ebenfalls kritischer. Die kantonale
Förderung wird eher untergeordnet als Problem genannt, bei den HLK-Planern fällt diese mehr ins
Gewicht.
Rund ein Viertel der Befragten hat andere Gründe gegen die Solarthermie angegeben. Mit Abstand am
stärksten ist dabei ins Gewicht gefallen, dass PV-Anlagen der Solarthermie gegenüber bevorzugt
werden. Am häufigsten wurde dabei die Kombination von PV und Wärmepumpen genannt.
Nachfolgend sind einige ausgewählte Antworten zu qualitativen Fragen zusammengefasst.
Frage: "Was müsste sich aus Ihrer Sicht ändern, damit eine Erhöhung der Zubaurate von Solarthermie
bewirkt werden kann?"
Die Antworten auf diese Frage, lassen sich in unterschiedlichen Clustern darstellen (geordnet nach
Grösse):
Finanzen
Konkurrenz PV
Technologie
Gesetze & Behörden
Information & Kommunikation
Knowhow
Finanzen (rund 200 Kommentare)
Aus finanzieller Sicht kristallisieren sich drei zentrale Argumente heraus.
1. Rund die Hälfte der Antworten in diesem Bereich sagen, dass die Kosten gesenkt werden
müssen. Einerseits die Investitionskosten und andererseits die Unterhaltskosten. Es wird
bemängelt, dass die Systeme zu komplex und entsprechend zu teuer sind. Lowtech-Lösungen
fehlen. Die Preise werden vor allem im Vergleich zu PV- und Wärmepumpen-Lösungen
betrachtet.
2. In dieselbe Richtung (mit ähnlich vielen Nennungen wie 1) geht die Forderung nach höheren
Förderbeiträgen. So könnten die Investitionskosten für den Bauherrn ebenfalls gesenkt werden.
Dabei wird auch immer wieder der Vergleich zur Förderung der PV-Anlagen gemacht, welche
aktuell höher ist wie bei der Solarthermie.
3. Mehrfach wurde ebenfalls genannt, dass der Energiepreis für fossile Brennstoffe (und/oder der
Strompreis) erhöht werden müsste, damit Solarthermie-Anlagen attraktiver werden.
Ebenfalls mehr als einmal wurde erwähnt, dass es bessere Berechnungsmodelle für die Erträge
braucht, damit eine bessere Wirtschaftlichkeitsbetrachtung möglich ist.
Konkurrenz durch PV (rund 120 Kommentare)
Die Konkurrenz zu PV-Anlagen wird als sehr gross eingestuft. PV-Anlagen werden als günstiger,
einfacher und bekannter eingeschätzt. Auch werden PV-Anlagen durch den Bund gefördert,
Solarthermie nicht. Insbesondere die Kombination PV und Wärmepumpen wird als aktuell beste Lösung
genannt. Solarthermie höchstens in Kombination mit Holz oder fossilen Energien.
Technologie (rund 100 Kommentare)
In Bezug auf die Verbesserungsmöglichkeiten bei der Technologie gab es vier Punkte, die sich
herauskristallisiert haben:
19/221. Es braucht bessere Speicherlösungen
2. Kluge Kombilösungen werden verlangt
3. Einfache Standardlösungen werden gefordert
4. Die Zuverlässigkeit muss erhöht werden bspw. mittels automatischer Funktionsüberwachung
Punktuell werden die Optik bzw. die optische Integration in Dach und Fassade erwähnt. Ebenfalls
wurden die Probleme bei den saisonalen Schwankungen sowie die Problematik der Überhitzung
mehrfach genannt.
Gesetze & Behörden (rund 50 Kommentare)
In Bezug auf die Gesetze und Behörden werden vier Forderungen gestellt (mehrfach genannt):
1. Es braucht eine gesetzliche Vorschrift für Solarthermie (analog zur PV-Pflicht)
2. Es braucht Erleichterungen im Baubewilligungsverfahren, welches aktuell als kompliziert
empfunden wird
3. Die Solarthermie muss den PV-Anlagen gleichgestellt werden (in Bezug auf Gesetze und
Förderung)
4. Die MuKEn müsste angepasst respektive MuKEn 2014 überall umgesetzt werden
Einzeln wurden Ideen genannt, dass Solarthermie einen höheren Einfluss auf die GEAK-
Effizienzklassen haben sollten, bei Minergie einen höheren Stellenwert haben sollte oder es einen
Bonus bei der Ausnützungsziffer geben müsste.
Information & Kommunikation (rund 45 Kommentare)
In diesem Zusammenhang wird viel Potenzial bei der Beratung der Bauherren ausgemacht.
Insbesondere eine bessere Aufklärung zum Kosten-Nutzen-Verhältnis sowie einen direkten Vergleich
zu PV-Anlagen wird vermisst. Ebenfalls wird allgemeine Öffentlichkeitsarbeit als essenziell betrachtet,
da viele Leute den Unterschied zwischen PV und Solarthermie nicht zu kennen scheinen, bzw. die
Solarthermie eher unbekannt ist. Hier wird einerseits der Verband Swissolar in die Pflicht genommen,
andererseits aber auch von Behörden/Gemeinden verlangt, mittels Best-Practice Beispielen mehr an
die Öffentlichkeit zu gehen.
Knowhow (rund 35 Kommentare)
Weniger häufig, aber doch mehrfach genannt, wurde das fehlende Knowhow bei den Installateuren.
Zudem kommt, dass spezialisierte Planungsbüros (teils aus Kostengründen) nicht hinzugezogen
werden und so qualitativ schlechte Anlagen installiert werden. Ebenfalls wird das Knowhow der
Architekten von verschiedenen Seiten als zu tief erachtet. Dies müsste verbessert werden, um die
Technologie attraktiver zu machen.
Dazu kommen mehrere Kommentare, dass Energieberater die Solarthermie nicht genügend in die
Beratung mit einbeziehen und sie nur im Zusammenhang mit dem Brauchwarmwasser erwähnt wird.
20/224 Bewertung der bisherigen Ergebnisse
Die Beschaffung der Daten konnte erfolgreich abgeschlossen werden, jedoch hätte sich das
Projektteam mehr kantonale Daten erhofft. Leider konnte nur der Kanton Basel-Landschaft umfang-
reiche Daten zur Verfügung stellen. Auch die Auswertung der Daten konnte erfolgreich abgeschlossen
werden. Ausgewählte Resultate sind im vorliegenden Jahresbericht zusammengefasst. Die Auswertung
zeigt, dass die gewählte Stossrichtung im Projekt (vorgegeben auch durch die BFE Ausschreibung und
der Begleitgruppe) richtig ist. Der starke Ausbau der PV scheint den grössten Einflussfaktor für den
Rückgang der Solarthermie zu sein. Dies wird auch durch die sehr umfangreiche Umfrage von 602
Fachplaner und Bauherren bestätigt. Die Umfrage ist aus Sicht des Projektteams ein grosser Erfolg, da
die Rückmeldung grösser ausgefallen ist als im Vorfeld erwartet. Bedauerlich ist jedoch, dass bei der
Umfrage die Installateure nicht beigezogen werden konnten. Diese stellen aus unserer Sicht eine
wichtige Gruppe dar in Bezug auf die Themen die im Projekt behandelt werden. Leider konnte Suisstec
keine Unterstützung hierzu bieten. Das Projektteam wird versuchen über Interviews auch die Meinung
der Installateure miteinfliessen zu lassen.
5 Weiteres Vorgehen
Aktuell werden die Interviewfragen fertiggestellt um mit den Interviews im Februar zu beginnen. Diese
sollen die Ergebnisse aus der Umfrage ergänzen und vertiefte Einblicke zu den Fragestellungen im
Projekt liefern. Von über 200 Personen wurden ihm Rahmen der Umfrage Kontaktangaben
bereitgestellt. Parallel dazu werden die Grundlagen zur Simulationsanalyse bereitgestellt (Definition der
Referenzgebäude und Heizungssysteme). Es ist ein weiterer Workshop mit der Begleitgruppe im März
2021 geplant, um letzte Inputs für die Simulationen und die Implementierung der Resultate in ein
bestehendes oder neues Berechnungsprogramm einzuholen.
Das Projekt ist bezüglich der gesetzten Milestones aktuell im Verzug, da durch die Corona Pandemie
Personen ausgefallen sind und durch die Umstellung auf digitale Angebote bei unterschiedlichen
Partnern die Auslastung sehr hoch war. Deshalb wird in Absprache mit dem BFE eine Projekt-
verlängerung bis Ende 2021 angestrebt. Wir erwarten aufgrund der Zeitverzögerung keine Qualitäts-
einbussen bei den Projektresultaten.
Das Vorgehen ist im nachfolgenden Zeitstrahl in Anlehnung an den eingereichten Projektantrag mit den
angepassten Zeiten zusammengefasst (vorausgesetzt die Projektverlängerung wird bewilligt).
Abbildung 13: Zeitstrahl mit Meilensteinen für das letzte Jahr mit Berücksichtigung einer Projektverlängerung. 21/226 Nationale und internationale Zusammenarbeit
Aktuell ist kein aktiver Austausch zu anderen Hochschulen geplant. Das Ziel ist es, die Resultate am
Ende des Projektes so aufzuarbeiten, dass diese einen Mehrwehrt für alle relevanten Schweizer Akteure
im Umfeld der Solarthermie haben. Durch die Teilnahme von Kantonsvertretern in der Begleitgruppe,
können die Ergebnisse auch in die Entwicklung der MuKEn 2025 miteinfliessen.
7 Publikationen
3. & 4. September 2020: brenet Status-Seminar im Kultur- und Kongresszentrum Aarau –
Vortrag zu: Auswirkungen der MuKEn auf die Wahl der Heizung in Sanierungen und Neubauten:
Detaillierte Analyse der Minergie und GEAK-Datenbank.
8 Literaturverzeichnis
[1] A. Kirchner, Die Energieperspektiven für die Schweiz bis 2050 - Energienachfrage und
Elektrizitätsangebot in der Schweiz 2000 - 2050, BFE, Basel, 2012.
[2] A. Kemmler, T. Spillmann, S. Koziel, Analyse des schweizerischen Energieverbrauchs 2000 -
2017 nach Verwendungszwecken, BFE, 2018.
[3] S. Teske, G.K. Heiligtag, energy [r]evolution - Eine nachhaltige Energieversorgung für die
Schweiz, Greenpeace Switzerland, Zürich, 2013.
[4] E. Panos, R. Kannan, Challenges and Opportunities for the Swiss Energy System in Meeting
Stringent Climate Mitigation Targets, in: Limiting Global Warming to Well Below 2°C: Energy
System Modelling and Policy Development. Lecture Notes in Energy, Vol 64, Springer, Cham,
2018.
[5] J. Rohrer, N. Sperr, Die Folgen der Dekarbonisierung des Energiesystems auf die Schweizer
Stromversorgung, ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, 2018.
[6] S. Bartlett, J. Dujardin, A. Kahl, B. Kruyt, P. Manso, M. Lehning, Charting the course: A possible
route to a fully renewable Swiss power system, Energy. 163 (2018) 942–955.
https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.08.018.
[7] L. Perret, J. Fahrni, Analyse der Auswirkungen der MuKEn 2014 auf die Märkte thermischer
Solaranlagen und Photovoltaikanlagen, BFE, Ittigen, 2015.
22/22Sie können auch lesen