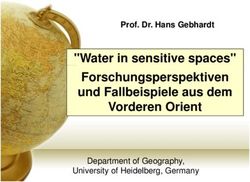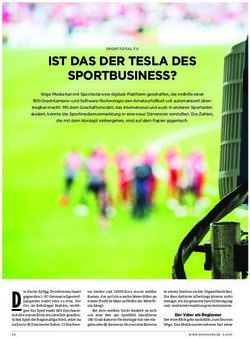Sprache ist mehr als ein Tool für die globale Arbeitswelt
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
// THEMA //
Sprache ist mehr als ein Tool
für die globale Arbeitswelt
Manches, das hierzulande als Standard gilt, ist in anderen Kontexten unbekannt,
weiß die Autorin aus eigener Forschungserfahrung. Internationalisierung deutscher
Hochschulen muss Sprachenvielfalt beinhalten | Von Raphaela Henze
S
o sehr der Wunsch nach einer Überwinden von Machtasymmetrien
Lingua franca aus Praktikabi-
litätsgründen einleuchtet, so Bei meinem aktuellen Forschungs-
sehr müssen wir uns vor Au- projekt geht es um die Bedeutung von
Foto: privat
gen halten, dass die Dominanz Kunst und Kultur für gesellschaftli-
des Englischen bestehende Ungleichhei- che und politische Zusammenhänge in
ten perpetuiert und intellektuelle Mo- Süd- und Mittelamerika. Mit Englisch-
Prof. Dr. Raphaela
nokulturen begünstigt (Jacobsen 2015, kenntnissen komme ich nicht weiter.
Henze
2018; Gehrmann 2015; Henze 2018, 2019). Kaum eine der südamerikanischen
ist Professorin für Kultur- Kolleginnen oder einer der Kollegen
management und Prodekanin Wo Sprache zum Stereotyp wird, stan- kommuniziert auf Englisch. In den
für Internationalisierung und
Forschung an der Fakultät dardisiert sie zwangsläufig unser Den- wissenschaftlichen Texten aus Brasi-
Technik und Wirtschaft der ken, schreibt der französische Soziologe lien, Argentinien, Chile oder Venezuela
Hochschule Heilbronn. |
raphaela.henze@
François Jullien in seinem Buch „Es gibt kommen die vermeintlichen und aus-
hs-heilbronn.de keine kulturelle Identität“ (Jullien 2018). schließlich westlichen Standardwerke
Seine Befürchtung, die Dominanz des- meiner Disziplin so gut wie nicht vor.
sen, was er „Globisch“ nennt, könnte uns Dies gilt allerdings auch vice versa. Nur
der Fähigkeit berauben, unterschiedli- sehr wenige europäische Kolleginnen
che Sprachen wechselseitig zu reflektie- und Kollegen nutzen Literatur aus dem
ren, kann man uneingeschränkt teilen. asiatischen, afrikanischen oder süd-
„Wir denken dann nur noch in standardi- amerikanischen Raum, obwohl diese
sierten Begriffen, die uns dazu verleiten, durchaus vorhanden ist. Dies macht
das für universell zu halten, was eigent- deutlich, wie ethnozentrisch unse-
lich nur Stereotype des Denkens sind.“ re Referenzrahmen sind (Henze 2019).
(Jullien 2018, S. 55) Was wir für Standard halten, ist es in
anderen Kontexten nicht und mit-
Wenn Narrative – insbesondere solche hin funktioniert das, was wir vermit-
aus Ländern des Globalen Südens – in teln, in ebendiesen Zusammenhängen
unserer Lehre und Forschung kaum bis möglicherweise schlecht bis gar nicht.
gar nicht vorkommen, machen wir uns Dies sollten wir uns insbesondere dann
eines gefährlichen Epistemizids schul- vor Augen halten, wenn wir uns vor-
dig (de Sousa Santos 2014; Hall, Tandon nehmen, Studierende auf Aufgaben in
2018), auf den uns Studierende weltweit einem internationalen Umfeld vorzu-
bereits seit mehreren Jahren, etwa mit bereiten. Ein größeres Augenmerk auf
der Kampagne „Why is my curriculum so eine breit gefächerte Übersetzungsför-
white?“, aufmerksam machen. derung, und zwar aus einer und in eine
30 DUZ Wissenschaft & Management 10 | 2020Foto: Sylvia Yang / unsplash.com
Vielzahl von Sprachen, würde zur Überwindung be- praktischen Aspekt meiner Ausführungen: dem Be-
stehender Machtasymmetrien beitragen. herrschen von Sprachen.
Sprachen sind Kulturgüter Die Auseinandersetzung mit Fremdsprachen fördert
nachweislich Empathie und Verständnis für bisher
Sprachen sind mehr als nur Werkzeuge zur Wis- fremde Kulturen (Rösler 2015; Rowntree, Neal, Fen-
sensvermittlung (Henze 2020). Jede einzelne ist kol- ton 2011). Schon aus diesem Grund sollte die Förde-
lektives Gedächtnis und als solche Ausdruck von rung der Fremdsprachenkompetenzen sowohl von
Tradition, Geschichte und Kreativität derjenigen Studierenden als auch von Lehrenden zentraler Be-
Kultur, die sie hervorgebracht hat. Sprache kann, standteil von Internationalisierungsbestrebungen
wenn man denn möchte, als Herrschafts- oder gar sein. Das Potenzial von Mehrsprachigkeit und insti-
Machtinstrument bezeichnet werden. In der Vergan- tutionellem Multilingualismus wird noch zu wenig
genheit war sie das sicher. Philipson (1992) spricht erkannt. Fremdsprachenkompetenz, insbesonde-
von einem linguistischen Imperialismus, der die re auch in Sprachen, die nicht zu den sogenannten
weltweite Verbreitung des Englischen, wie wir sie Weltsprachen gehören, kann einen wichtigen Vorteil
heute kennen und für weitgehend selbstverständ- für die Studierenden bedeuten – und mitnichten nur
lich erachten, überhaupt erst ermöglicht hat. Aber für diejenigen, die später tatsächlich international
auch heute noch werden Menschen wegen ihrer arbeiten (möchten). Auch in Transformationsgesell-
Sprache oder ihres Dialekts diskriminiert. schaften wie Deutschland werden Sprachkenntnisse
immer wichtiger (Henze 2019). Deutlich ist jedoch,
Wichtig wäre es, sich ins Bewusstsein zu rufen, dass dass diese gesellschaftliche Transformation den
das Beherrschen mehrerer Sprachen ein Privileg ist. Vorlesungssaal leider noch nicht erreicht. Zwar hält
Und mit Privilegien sollte man entsprechend verant- sich Deutschland die Durchlässigkeit seines Bil-
wortungsbewusst umgehen. Dies führt mich zu dem dungssystems zugute – und im Vergleich zu Groß-
10 | 2020 DUZ Wissenschaft & Management 31// THEMA //
britannien und Frankreich mag dieses tatsächlich nicht nur theoretisch zu verstehen, sondern ihnen
auch durchlässiger sein –, doch von einer Chancen- auch praktisch gerecht zu werden. Anders sieht das
gleichheit auf Bildung ist Deutschland noch viele jedoch aus, wenn Dozentinnen und Dozenten Lehr-
bildungspolitische Grundsatzentscheidungen und veranstaltungen in englischer Sprache anbieten,
vermutlich auch hohe Investitionen entfernt. weil dies möglicherweise in Akkreditierungsverfah-
ren mangels intensiverer Auseinandersetzung mit
Migrantinnen und Migranten, Geflüchteten und Stu- der Thematik gefordert oder von den für Internati-
dierenden mit Migrationsgeschichte Zugänge zu onalisierung Zuständigen an der Hochschule so ge-
ermöglichen, muss selbstverständlicher Teil von wünscht wird. Ich schließe nicht aus, dass etliche
Internationalisierung werden (Ergin, de Wit, Leask Studierende tatsächlich einen Mehrwert aus diesem
2019). Auch auf der Seite der Lehrenden findet sich Aktionismus ziehen, der Internationalisierung be-
nach wie vor Homo- statt Heterogenität. Professo- dauerlicherweise mit Anglophonisierung und nicht
rinnen und Professoren aus dem Ausland oder sol- mit Vielfalt gleichsetzt. Wichtig ist hierbei jedoch,
che mit Migrationsgeschichte gibt es in Deutschland nach Disziplinen und danach, was für das jeweili-
immer noch viel zu selten. ge Fach sinnstiftend ist, zu differenzieren und nicht
pauschal mit dem Englischen eine weitere Sprache
Sprache in der Lehre einzuführen.
Wir sollten beim wichtigen Erwerb von Fremdspra- Immer mehr Studierenden fällt es offenbar schwer,
chenkompetenz aber unterscheiden zwischen dem sich auf Deutsch fehlerfrei auszudrücken. Nach
pädagogisch untermauerten Fremdsprachenunter- vielen Jahren der Korrektur Hunderter Klausuren,
richt auf unterschiedlichen Sprachniveaustufen so- Hausarbeiten und Bachelor- und Masterarbeiten
wie den überaus sinnvollen Auslandsaufenthalten stelle ich fest, dass viele Studierende die grundle-
auf der einen und dem mitunter doch etwas zwang- genden Regeln der deutschen Grammatik und Or-
haft anmutendem Angebot von fachspezifischen In- thografie kaum noch beherrschen. Dies betrifft
halten auf Englisch durch Nichterstsprachlerinnen mitnichten nur Studierende, die mit einer anderen
und Nichterstsprachler auf der anderen Seite. als der deutschen Sprache aufgewachsen sind und
von denen es in unseren Institutionen aufgrund bil-
Das Argument „weil die Studierenden das später ein- dungspolitischer Verfehlungen gerade beim früh-
mal brauchen“ für Englisch in einzelnen Lehrveran- kindlichen Sprachunterricht leider viel zu wenige
staltungen auch in Studiengängen, die ansonsten gibt, sondern auch diejenigen mit Deutsch als ein-
auf Deutsch unterrichtet werden, ist in dieser Pau- ziger Erstsprache.
schalität unter akademischem Niveau (Rösch, Tol-
kiehn 2018). Damit sei aber keinesfalls gesagt, Die inhaltlich guten Arbeiten sind die, die auch
Lehrveranstaltungen von ausländischen Kollegin- sprachlich gelungen sind. Wer in der Lage ist, ver-
nen und Kollegen seien für Studierende nicht sinn- ständlich und korrekt zu formulieren, ordnet seine
voll oder das Beherrschen von Fremdsprachen und Gedanken und denkt über den Satz noch ein zweites
deren fachspezifischen Vokabularien sei für sie ver- oder drittes Mal nach. Ein schlüssiger oder gar geni-
zichtbar. Im Gegenteil, solche Veranstaltungen ha- aler Gedanke, so meine These, kommt selten gram-
ben viele fachliche Vorteile über den Spracherwerb matisch und/oder orthografisch fehlerhaft daher.
hinaus. Kurse zur fachspezifischen Fremdsprachen- Fast 70 Jahre nach Sapir und Whorf, die übrigens in
kompetenz, wie sie zahlreiche Universitäten bereits der Tradition Herders und Humboldts stehen, sind
seit Jahrzehnten anbieten, sind ebenso sinnvoll wie sich Linguisten, Hirnforscher und Psychologen in ei-
studiengangsimmanente Auslandsaufenthalte. Stu- nem weitgehend einig: Sprachgenauigkeit prägt und
diengänge, die Lehrende aus verschiedenen Ländern schärft das Denken. Warum widmen wir ihr dann
einbeziehen, deren entsprechend unterschiedliche nicht mehr Bedeutung, sondern reduzieren sie le-
Perspektiven, Lehrmethoden und Sprachkompeten- diglich zu einem Handwerkszeug, um Inhalte rüber-
zen dann in die Lehre einfließen, sind äußerst attrak- zubringen? Viel mehr als bisher müssen wir uns mit
tiv, denn sie bereiten auf etwas vor, was Studierende Fragen der Sprachlichkeit und ganz besonders mit
meines Erachtens später tatsächlich benötigen: die dem Verhältnis von Sprache, Erkenntnisfindung und
Fähigkeit, kulturell unterschiedliche Anforderungen -gewinnung auseinandersetzen (Gehrmann 2015).
32 DUZ Wissenschaft & Management 10 | 2020Defizite in Mathematik
einzugestehen, scheint uns
weniger schwerzufallen als
solche in der eigenen Sprache
An vielen Hochschulen und Universitäten werden vor ten mit mangelhaften Deutschkenntnissen auf dem
Semesterbeginn sogenannte Mathe-Brückenkurse Arbeitsmarkt schwer haben werden. Dieser Arbeits-
angeboten. Deutsch-Brückenkurse fehlen dagegen, markt hat sich insbesondere in den letzten Wochen
obwohl es dafür gute Argumente und durchaus unter- schlagartig verändert und er wird möglicherweise nie
haltsame sowie anschauliche Literatur etwa von Wolf- wieder der sein, der er noch in den sogenannten Vor-
gang Schneider gibt. Mein Doktorvater hat mir damals Corona-Zeiten war. Häufig werden Studiengänge mit
die ideologisch schwierige Stilfibel von Ludwig Reiners dem leicht abgeschmackten „wir bereiten unsere Stu-
auf den Tisch gelegt. Defizite in Mathematik einzuge- dierenden auf den globalen Arbeitsmarkt der Zukunft
stehen, scheint uns weniger schwerzufallen als solche vor“ beworben. Wird dieser Arbeitsmarkt tatsächlich
in der eigenen Sprache. Von dieser Schamhaftigkeit noch ein globaler sein? Und wenn ja, was zu vermuten
müssen wir uns dringend verabschieden. und auch zu hoffen ist: Wird man diese Globalisierung
nicht stärker als bisher im Sinne Bruno Latours vom
Wertschätzender Umgang mit Sprache Lokalen her denken müssen? Und werden es zukünftig
tatsächlich noch die anglophonen Staaten sein, die im
Der Wunsch nach einem wertschätzenden Umgang wahren Sinne des Wortes den Ton angeben?
mit Sprache – und zwar egal mit welcher Sprache –
entsteht vor dem Hintergrund, dass Sprache, wie ein- Internationalisierung von den Inhalten her denken
gangs erwähnt, eine kulturelle Errungenschaft ist und
dementsprechend gewürdigt und erhalten werden Die häufig gehörte Behauptung, Kompetenzen wie bei-
muss. Hier gilt es, im Rahmen des an der Hochschule spielsweise Medien- oder eben auch Fremdsprachen-
Möglichen zu unterstützen. Dazu gehört für Lehrende, kompetenz würden sprachliche Defizite im Deutschen
korrekt und präzise zu kommunizieren sowie deutlich schon irgendwie aufwiegen, überzeugt nicht. Meines
zu machen, dass flüssiger Stil und inhaltliche Präzi- Erachtens stehen all diese Kompetenzen gleichwertig
sion in E-Mails, Hausarbeiten, Referaten oder Thesen nebeneinander.
kein Selbstzweck sind, sondern deren Überzeugungs-
kraft entscheidend steigern können. Gefragt ist hier aber auch die Einsicht in die Notwen-
digkeit und das Eigenengagement der Studierenden.
Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie schwierig es ist, Im letzten Semester habe ich 40 Klausuren korrigiert.
den Studierenden entsprechende Defizite ins Bewusst- Leider war keine einzige davon sprachlich fehlerfrei,
sein zu heben. Manche reagieren mit Unverständnis mehrere ehrlich verheerend. Ich bezweifle, dass das
ob des Ansinnens, sich doch mit den Formulierungen Englisch dieser Studierenden besser ist als ihr Deutsch.
Mühe zu geben. Den Satz „Aber man versteht doch, Vor allem bezweifele ich aber, dass es das durch eng-
was gemeint ist!“ habe ich unzählige Male gehört. Mir lischsprachige Lehrveranstaltungen wird, die häu-
ist bewusst, dass Grammatikunterricht nicht Aufgabe fig nur ein Feigenblättchen für die allseits geforderte
von Hochschullehre sein kann. Mir ist aber auch be- Internationalisierung sind und bei denen das sprach-
wusst, dass es unsere Absolventinnen und Absolven- liche Niveau als Entgegenkommen für die Nichterst-
10 | 2020 DUZ Wissenschaft & Management 33// THEMA // sprachler möglicherweise noch weiter absinkt (Rösch, Soziale Aspekte einbeziehen Tolkiehn 2018). Häufig wird in diesem Kontext von Ser- vice-Englisch gesprochen, das nicht nur dem Spracher- Solche Fragen zur Erweiterung unseres Methoden- werb, sondern auch den zu vermittelnden Inhalten eher kanons, der Einbindung bisher marginalisierter Nar- abträglich als dienlich ist (Becker, Narvaja de Arnoux rative, zu neuen, transkulturellen Lehrformaten für 2020). Internationalisierung auf die Anzahl von Lehr- eine diverse Studierendenschaft sowie zu Demokrati- veranstaltungen in englischer Sprache zu reduzieren, sierungs- und Teilhabeprozessen, Bildungszugängen ist eine unzulässige Verkürzung und wird dem durch- und der Sicherung der Wissenschaftsfreiheit sollten aus richtigen Bestreben, wettbewerbs- und vor allem uns bewegen (Henze 2019). Die soziale Verantwortung, zukunftsfähige Studiengänge anzubieten, nicht ge- die mit Internationalisierung einhergeht, wird eben- recht. Im Zentrum der Überlegungen muss neben dem falls noch zu selten thematisiert (Brandenburg, de Wit, Wie der Vermittlung vor allem das Was stehen. Und hier Jones, Leask 2019). Forschung auf diesem Gebiet wür- wäre, insbesondere auch in Akkreditierungsverfahren, de eine wichtige, wissenschaftliche Ergänzung zum eine deutliche Fokussierung auf internationale Inhalte durchaus üppig vorhandenen Fundus der Literatur zur wichtig. Welche Literatur legen wir zugrunde? Welche Internationalisierung von Hochschulen darstellen und Methoden und Narrative nutzen wir? Welche internati- der Attraktivität des Hochschulstandorts Deutschland onalen Netzwerke haben wir uns aufgebaut, von denen nachhaltig dienen – möglicherweise sogar nachhalti- auch unsere Studierenden profitieren können? ger als die teilweise etwas verzweifelt anmutende Su- Literatur Altbach, Philip; de Wit, Hans (2017): Global higher education might turn upside down as West turns inward, in: Times Higher Education, 16. Februar 2017. https://www.timeshighereducation.com/comment/global-higher-education-might-turn-upside- down-west-turns-inward (19. Juni 2017) Becker, Lidia; Narvaja de Arnoux, Elvira (2020): Wissenschaft: Es muss nicht immer Englisch sein, in: Süddeutsche Zeitung vom 10. Februar 2020 Brandenburg, Uwe; de Wit, Hans; Jones, Elspeth; Leask, Betty (2019): Defining internationalisation in HE for society, in: Uni- versity World News, 29. Juni 2019. https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20190626135618704 (1. Mai 2020) de Sousa Santos, Boaventura (2014): Epistemologies of the South. Justice against Epistemicide. London: Routledge Ergin, Hakan; de Wit, Hans; Leask, Betty (2019): Forced Internationalisation of Higher Education, in: Higher Education, Spring, Number 97, 2019, S. 9–10 Gehrmann, Siegfried (2015): Die Kontrolle des Fluiden. Die Sprachlichkeit von Wissenschaft als Teil einer neuen Welt- ordnung, in: Gehrmann, S.; Helmchen, J.; Krüger-Potratz, M.; Ragutt, F. (Hrsg.): Bildungskonzepte und Lehrerbildung in europäischer Perspektive. Münster: Waxmann, S. 117–156 Hall, Budd L.; Tandon, Rajesh (2017): Decolonization of knowledge, epistemicide, participatory research and higher educa- tion, in: Research for All, 1 (1), S. 6–19 Henze, Raphaela (2018): The master’s tool will never dismantle the master’s house, in: Arts Management Quarterly, Leaving Comfort Zones. Cultural Inequalities, No. 129, June 2018, S. 29–35 Henze, Raphaela (2019): Vom Lokalen zum Globalen, in: Die Neue Hochschule DNH Ausgabe 6, 2019, S. 20–21 34 DUZ Wissenschaft & Management 10 | 2020
che nach Studiengangsmodellen, die für (zahlende) aufenthalten, laden wir ausländische Kolleginnen
ausländische Studierende attraktiv sein sollen. Mit so- und Kollegen ein, suchen wir Literatur von Kollegin-
zialen Aspekten zu punkten, würde eine neue Varian- nen und Kollegen auch außerhalb der westlichen He-
te in den Wettbewerb um kluge Köpfe bringen, die ein misphäre – künstliche Intelligenz (wie beispielsweise
Alleinstellungsmerkmal unseres Hochschulstandorts deepl.com) kann bei Übersetzungen durchaus hilf-
darstellen könnte. reich sein. Nehmen wir uns die Zeit und machen wir
uns die Mühe, Studierenden die kulturellen, integra-
Fazit torischen, sozialen, intellektuellen und kommunika-
torischen Dimensionen des Phänomens Sprache zu
Nehmen wir Sprache(n) und auch die landessprach- verdeutlichen. Wir tun unseren Studierenden kei-
liche Lehre bitte ernst. Sensibilisieren wir Studieren- nen Gefallen, wenn wir über zu viele Fehler einfach
de nicht nur für die Wichtigkeit, sondern auch für die hinwegsehen und damit implizit vermitteln, dass es
Schönheit von Sprache(n). Das wird ihnen in vielfa- auf Genauigkeit des Ausdrucks und sprachliche Kor-
cher Hinsicht dienlich sein. Überlassen wir die Ver- rektheit nicht ankommt. Auch oder gerade in Zeiten,
mittlung von Fremdsprachenkompetenzen vielleicht in denen wichtige Mitteilungen auf 140 Zeichen re-
eher Profis in entsprechenden Kursen und unterstüt- duziert werden, werden sich diejenigen von anderen
zen wir unsere Studierenden bei der Organisation von abheben, die korrekt sowie verständlich Sinnvolles
(über den Spracherwerb hinaus) wichtigen Auslands- kommunizieren – egal in welcher Sprache. //
Henze, Raphaela (2020): More than just lost in translation. The ethnocentrism of our frames of reference, in: Durrer, V. &
Henze, R. (Hrsg.), Managing Culture: Reflecting on Exchange in Global Times, Palgrave Macmillan, S. 51–80
Jacobsen, Ushma Chuan (2015): Cosmopolitan sensitivities, vulnerability, and Global Englishes, in: Language and Intercul-
tural Communication, 15(4), S. 459–474
Jacobsen, Ushma Chuan (2018): Language in arts and cultural management. In Arts Management Quarterly, Leaving com-
fort zones. Cultural Inequalities, No. 129, June 2018, S. 17–23
Jones, Elspeth; Coelen, Robert; Beelen, Jos; de Wit, Hans (2015): Global and Local Internationalisation. Sense Publishers
Jullien, François (2018): Es gibt keine kulturelle Identität. Berlin: edition suhrkamp
Leask, Betty (2015): Internationalizing the Curriculum. London: Routledge
Philipson, Robert (1992): Linguistic Imperialism. New York: Oxford University Press
Rösch, Olga; Tolkiehn, Günter-Ulrich (2018): Zum Diskurs über die Sprache in der Wissenschaftskommunikation, in: Die
Neue Hochschule DNH, Heft 4, Jahrgang 2018, Zwischen Mission und Versuchung: Die Wissenschaft und die „gute Sache“,
S. 26–29
Rösler, Bettina (2015): The case of the Asialink’s arts residency program: towards a critical cosmopolitan approach to cultu-
ral diplomacy, in: International Journal of Cultural Policy, Vol. 21, No. 4, S. 463–477
Rowntree, Julia; Neal, Lucy; Fenton, Rose (2011): International Cultural Leadership: Reflections, Competencies and Interviews.
British Council. https://creativeconomy.britishcouncil.org/media/uploads/files/International_Cultural_Leadership_report.pdf
10 | 2020 DUZ Wissenschaft & Management 35Sie können auch lesen