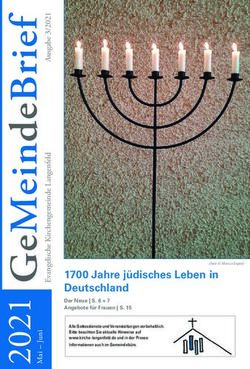"Vergangenheit ist etwas, das plötzlich vor uns liegt." - Transgenerational Memory', literarischer Raum und kulturelle Fiktion in Anne Webers ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
„Vergangenheit ist etwas, das plötzlich vor
uns liegt.“ – ‚Transgenerational Memory‘,
literarischer Raum und kulturelle Fiktion in
Anne Webers Zeitreisetagebuch Ahnen (2015)
Stephan Wolting
1. Zur Mehrdeutigkeit von Zeitreisetagebuch im Zusammenhang
mit der Konzeption von transgenerational memory
„Sonst kriegen sie uns … Nichts wie weiter…Sonst kriegt uns die Geschichte…
Sonst holt sie uns ein und bringt uns um…“ Jaroslav Rudiš: Winterbegs letzte Reise (2019: 202)
Im vorliegenden Beitrag geht es um das Werk Ahnen von Anne Weber (2015),
der Gewinnerin des Deutschen Buchpreises 2020. Neben weiteren biogra-
phisch-familiären Bezügen wird zu großen Teilen die Tätigkeit ihres Urgroß-
vaters als preußischer Beamter, als Jurist, später als protestantischer Pastor,
von 1890 bis 1904 im Posener Land thematisiert. Die Autorin treibt vor allem
die Frage um, inwieweit sich innerhalb der unterschiedlichen Familiengenera-
tionen (schwerpunktmäßig deren männlicher Vertreter) ein geistig-mentales
Kontinuum in einem biographischen wie kulturpolitischen Sinne feststellen
lässt, das bei der Geschichte ihres Urgroßvaters beginnt und sich bis zu je-
ner der Autorin fortsetzt.1 Weber benutzt dazu die schöne Metapher, „sich von
einer verschwundenen Generation zur nächsten wie auf den aneinanderge-
knüpften Brettern einer morschen Hängebrücke vor- und zurückbewegen zu
können“ (Weber 2015: 203). Die deutsch-amerikanische Komparatistin Helga
Druxes (2015) bezeichnet diese Verfahrensweise im Gespräch mit der Autorin
als „transgenerational Holocaust memory“2: Dies drückt sich über den inhalt-
lichen Rahmen hinaus nicht zuletzt in der Form des Prosastücks aus, deren
Betrachtung im Fokus dieser Untersuchung steht.
Wie in dem jüngst prämierten Werk, dem Versepos Annette. Eine Heldin-
nenepos (Weber 2020)3, hat die Autorin nach eigener Aussage auch in Hinblick
1 Das Werk ist in drei (Zeit-) Abschnitte unterteilt: die Zeit des Urgroßvaters im Posener Land,
die Beschreibung des Lebens des Vaters mit der Verbindung zum Großvater sowie die Zeit von
Webers Recherche.
2 Bei dem Begriff sei aber Vorsicht geboten, denn im gleichen Interview betont Weber, dass „sie
mit Menschen, nicht mit Generationen“ verkehre. Das Zitat geht sinngemäß auf Gustav Landauer
zurück, wie die Autorin betont (Winter 2015: 179).
3 Sie erhielt den Preis für dieses Werk über die französische Widerstandskämpferin Anne
Schnittstelle Germanistik, Jahrgang 1 (2021), Ausgabe 1
© 2021 Universitätsverlag WINTER GmbH Heidelberg
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)138 Stephan Wolting
auf Ahnen sehr um die gattungsästhetische Form des Oeuvres gerungen4, das
sie schließlich Zeitreisetagebuch nannte. An anderer Stelle wird von einer „poe-
tisch-autobiografische[n] Meditation über Herkunft und Identität“ (Pfohlmann
2015) gesprochen. Damit ist ein Stichwort für die Betrachtung einer „Poetik des
Raums“ im Sinne Bachelards (1987) gegeben. Weber gebraucht den Terminus
Reise hier in einem doppelten Sinne: einmal in einem lokalen, als Reise zu den
Orten ihrer Recherche, und darüber hinaus in einem temporalen, als Reise in
„die zeitliche Fremde ihrer Vorfahren“ (Weber 2015: 37). Unter Zugrundele-
for personal use only / no unauthorized distribution
gung von letzterem stellt sie einen Bezug zum Titel her, wo sie von ihrer Reise
in die Vergangenheit als in ein eigentlich „unzugängliches Totenreich“ (Weber
2015: 20), jenes Land ihrer Ahnen, spricht.5
Innerhalb dieser Überlegungen wird der oben beschriebenen Vorgabe der
Autorin Rechnung getragen und die Frage zu beantworten versucht, welche
Winter Journals
besonderen Implikationen wie etwa metanarrative Kommentierungen o.ä. in
Hinblick auf die Darstellungsweise und intendierte Lesart damit verbunden
sind. Für Weber bedeutet Form zugleich Aussage und Zeitreisetagebuch eine
poetisch imaginierte Form einer Reise in Raum und Zeit. Der Schwerpunkt
dieser Betrachtung liegt trotz des im Kompositum vorkommenden Begriffs
der Zeit hier stärker auf der kantianisch gesprochen Anschauungsform des
Raums.6 Allerdings lassen sich beide Formen im erzähltechnischen Sinne
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
eines von Bachtin (1973) herausgestellten Chronotopos oder der von Böhme
betonten Raumzeitlichkeit7 nicht scharf trennen, was in Übereinstimmung zu
Webers Konzeption steht. Nicht allein zwischen den Zeilen lässt sich die Ab-
sicht der Autorin herauslesen, dass „Zeitreisetagebuch“ bedeutet, Vergangen-
heit, und damit Zeit, räumlich zu machen, etwa wo sie schreibt, dass sie sich
eaumanoir. Es soll hier keinesfalls als ‚politische Stellungnahme‘ bzw. als Analogieschluss
B
missverstanden werden, aber im Zusammenhang des ‚Rauswurfs‘ von Monika Maron bei S.
Fischer, ging es fast unter, dass der Fischer Verlag Webers Werk als ‚Versepos‘ nicht heraus-
geben wollte. Stattdessen erschien es bei Matthes & Seitz, der damit als relativ kleiner Verlag
innerhalb weniger Jahre zum zweiten Mal den Deutschen Buchpreis erhielt, nach 2015 Frank
Witzels Die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager
im Sommer 1969.
4 Wie die Autorin in einem Gespräch mit dem Verfasser anlässlich einer Lesung (spotkanie au-
torskie) am Germanistischen Institut der UAM Poznań am 24.11.2016 selbst betonte.
5 Der Begriff Ahnen taucht an verschiedenen Stellen auf, auch bei der Klimax des Werks, als sie
zuletzt am 1. November zwei Friedhöfe in Poznań, Myłostowo und Jezicki, besucht und nach
einer Reflexion über die Ahnen der Opfer und der Täter sich einen Ort wünscht, „an dem alle
Toten ungeteilt, meine Ahnen sind.“ (Weber 2015: 268)
6 Vgl. die Kritik der reinen Vernunft, vor allem die Transzendentale Elementarlehre. Erster Teil.
Die transzendentale Ästhetik § 1. 1. Abschnitt. Von dem Raum (Kant 1982: 69ff.) Bitte Seiten
zahlen von – bis angeben, 2. Abschnitt: Von der Zeit (Kant 1982; 78ff.) Bitte Seitenzahlen
von – bis angeben.
7 Eine Idee, die im Übrigen schon Lessing (1974) in seinem Laokoon in Abgrenzung der Literatur
von der Bildenden Kunst umtrieb (Böhme 2005: XII).
Schnittstelle Germanistik, Jahrgang 1 (2021), Ausgabe 1
© 2021 Universitätsverlag WINTER GmbH Heidelberg
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)„Vergangenheit ist etwas, das plötzlich vor uns liegt.“ 139
„die zeitliche Differenz zwischen sich und dem Urgroßvater als eine Strecke“
vorstellt (Weber 2015: 67).8 Somit wird für sie in diesem Fall besonders der
Begriff des Raums virulent, der etwas anderes meint als der konkretere Begriff
des Orts9, was sich wiederum auf Interpretation oder Lesart auswirkt: Es geht
um die Darstellung eines künstlerischen oder literarischen Raums, nicht um
die Beschreibung eines geographischen oder historischen Orts.
Von hierher wird an die Konzeptionen Blanchots (2012) vom „literari-
schen“ und Lotmans (2009) vom „künstlerischen Raum“ angeknüpft10, und
wie angedeutet darüber hinaus sich dem Werk gattungs- und formalästhetisch
genähert, wie es in literaturwissenschaftlichen Regionalstudien – zumindest
innerhalb germanistischer Publikationen – eher unterrepräsentiert scheint.
Auf diese Weise ergibt sich zugleich ein neuer, anderer Zugang zu einer Re-
gion als ‚kultureller Fiktion‘ innerhalb derer, im Zusammenspiel von Biografie,
Historie und Regionalität und qua literarisch-ästhetischer Konstruktion sowie
performativer Erinnerungsarbeit, „Vergangenheit plötzlich vor uns liegt“11.
Bevor in diesem Zusammenhang konkreter auf die ästhetische Struktur ein-
gegangen wird, seien einige Bemerkungen zur historischen Figur von Webers
Urgroßvater am Leitfaden der Frage nach einem geistigen Kontinuum sowie zu
dessen Einbindung in Webers Familiengeschichte vorweggenommen. Eher als
Exkurs schließen sich einige Bemerkungen zur historisch-politischen Situation
des Posener Lands sowie zur Literatur des Posener Landes an. Beide For-
schungsbereiche sind wissenschaftlich gut dokumentiert (Greser 2016; Mache
2021), sodass sich hier anschlussoperativ auf nur einige wenige konkrete Fix-
punkte beschränkt werden kann. In diesem Zusammenhang sei festgehalten,
dass Weber weder aus der Erfahrung einer Region heraus schreibt, noch sich
speziell für die Region interessiert, sondern diese nur im Zusammenhang mit
der Lebensgeschichte ihres Urgroßvaters behandelt. Insofern liegt hier ein
völlig anderer Impetus als bei jeder anderen Form eines Schreibens aus re-
gionaler Erfahrung (Gössmann/Hollender 1996) vor. Zugleich sei darauf ver-
wiesen, dass Weber stark individuelles Erinnern (auch das eigene) akzentuiert,
also die Singularität12 jeder Lebensgeschichte (nicht zuletzt jener ihres Groß-
vaters) betont und sich im phänomenologischen Sinne deutlich von jeglicher
8 In diesem Kontext ließe sich assoziativ an Schlögels (2003) Diktum denken, wonach „wir im
Raume die Zeit lesen“, wenngleich in einem anderen Kontext geäußert.
9 Oftmals als Unterscheidung von space und place verdeutlicht.
10 Man hätte in dem Zusammenhang auch Ernst Cassirer (1985) als Zeugen aufrufen können.
11 Nicht zuletzt als eine noch einzulösende Verpflichtung. Dieses Motiv taucht mehrere Male im
Werk auf, u.a. auch im Zusammenhang mit der Konzeption Gustav Landauers, mit dem der Ur-
großvater später befreundet und von ihm geistig stark beeinflusst war: „Die Vergangenheit liegt
vor uns wie ein Weg […].“ (Winter 2015: 233)
12 Hier als eher heuristischer Begriff anders benutzt als bei Reckwitz (2017), der dies in einem
soziologischen Sinn als im weitesten Sinne Lifestyle oder Habitusform versteht.
Schnittstelle Germanistik, Jahrgang 1 (2021), Ausgabe 1
© 2021 Universitätsverlag WINTER GmbH Heidelberg
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)140 Stephan Wolting
Verallgemeinerung distanziert, selbst jener eines kollektiven (Halbwachs
1985)13, eines kommunikativen (Welzer 2002)14 oder eines kulturellen Ge-
dächtnisses (Assmann 1992):15
[…] dass es in Wirklichkeit nur einzelne gibt mit ihren einzelnen Gesinnungen oder Gesinnungs-
losigkeiten, und in diesen Einzelnen, in den meisten von ihnen, die leisen oder dröhnenden
Stimmen ihres Gewissens. Die Bücher irren, es gibt keine Massen, es gibt nur einen Vater und
einen Sohn oder eine Mutter und einen Sohn oder eine Tochter und zwischen ihnen gibt es
Wege, die weiterführen oder abbrechen. Die Erklärung in den Büchern erklären das Leben und
Denken und Handeln dieser Einzelnen nicht. (Winter 2015: 256)16
2. Die ‚fiktiv-historische‘ Figur des Urgroßvaters in Webers Werk
Die ‚fiktiv-historisch‘ literarisierte Figur des Urgroßvaters wird im Werk als ein
„hochgebildeter Mann“ charakterisiert, der sich bei den Griechen, Klassikern
wie Goethe, Shakespeare und Dante gut auskannte. Darüber hinaus wird er
wie folgt beschrieben:
Viele Eigenschaftswörter würden auf ihn passen: der Suchende, der Wahnsinnige, der Haltlose,
der Radikale, der Unbändige [...]. Das Erste, was mich für den Mann erwärmte, war, dass sein
nur in Fragmenten überliefertes Hauptwerk den Titel „Abrechnung mit Gott“ tragen sollte.
(Weber 2015: 7)17
Weber führt dazu weiter aus, dass es nicht zuletzt seine „Abrechnung mit
Gott“18 war, was sie von Anfang an für ihn einnahm und ihr zum Anlass des
13 Vgl. auch die frühe Kritik Kosellecks (2004). Es gilt inzwischen als in der Forschung allseits
bekannt, dass Halbwachs die Schrift nie selbst veröffentlichte, sondern diese als Kompendium
später von seinem Sohn herausgegeben wurde. Für viele Kritiker dieser Konzeption bleibt ‚kol-
lektives Gedächtnis‘ eine contradictio in adjecto.
14 Welzers Ansatz geht noch am ehesten in die Richtung Webers oder umgekehrt, weil bei ihm
auch das Familiengedächtnis im Sinne der Tradierung ein Teil des kommunikativen Gedächt-
nisses ist.
15 Erwähnt sei in diesem Zusammenhang auch Aleida Assmann (2013), die einzelne Positionen
noch einmal kritisch und konfrontativ einander gegenüberstellt. Natürlich sind sich beide
Assmanns auch der formalästhetischen Komponente literarischer Werke bewusst.
16 Auch in Bezug auf den „Germanisierungsprozess“ betont Weber die Rolle des Einzelnen: „Ab
1871 sollten Gesetze nach und nach nicht nur dir Scholle, sondern auch die Sprache von allem
Slawischen reinigen [im Original kursiv; St.W.]. Dieser Germanisierungsprozess wird allge-
mein als Vorstufe des Späteren beschrieben, als eine Art Vorgebirge des Riesengebirges. Und
für einen, der den Blick vor dem einzelnen Leben verschließt und nur größere Strömungen
wahrnimmt, mag das auch stimmen. Aber das Leben eines Einzelnen ist reicher, widersprüch-
licher, schwankender als das der Gemeinschaft, es lässt sich nicht mit den anderen Leben zu
einem Trend verschmelzen.“ (Weber 2015: 223)
17 An einer anderen Stelle nennt sie ihn eine „Kippfigur“, bei dem „die zwei Hälften seines Wesens
weiter auseinanderklaffen, als es gemeinhin vorkommt“ (Weber 2015: 178).
18 Wie sein nur in Fragmenten erhaltenes „Hauptwerk“ heißen sollte (Weber 2015: 7).
Schnittstelle Germanistik, Jahrgang 1 (2021), Ausgabe 1
© 2021 Universitätsverlag WINTER GmbH Heidelberg
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)„Vergangenheit ist etwas, das plötzlich vor uns liegt.“ 141
Werks wurde. Der aus Kassel stammende Florens Christian Rang (1864-1924)19
macht sich nach seiner Posener Zeit auch publizistisch, literarisch, theologisch
und philosophisch einen Namen und wird von seinem späteren Freund Walter
Benjamin20 als der „größte Kritiker des Deutschtums seit Nietzsche“ (Weber
2015: 162) bezeichnet. Dessen Zeit im Posener Land erscheint nicht zuletzt
deshalb besonders aufschlussreich, weil diese in dem Wikipedia-Artikel über
ihn komplett ausgespart ist, so als würde sein Leben erst mit der Berliner Zeit,
u. a. als Vorstandsvorsitzender und 2. Direktor der Raiffeisenbank ab 1917
(Weber 2015: 183) beginnen21, weil er erst nach seiner Posener Zeit neben
Benjamin22 mit prominenten Geistesgrößen deutschsprachiger Kulturge-
schichte wie Martin Buber, Hugo von Hofmannsthal oder Gustav Landauer in
Kontakt stand. Etwas despektierlich könnte man ihn einen B-Promi innerhalb
der deutschen Geistesgeschichte nennen. Die Autorin spricht in diesem Zu-
sammenhang u. a. von einer „Fußnote“ oder einem „Randvermerk“ der Ge-
schichte (Weber 2015: 29).
Nicht allein die Posener Zeit bleibt von der Lebensgeschichte Rangs ausge-
spart, sondern damit verbunden auch zugleich seine von Weber zumindest als
Frage formulierte Aspiration, dem Deutschtum im Posener Land Vorschub zu
leisten und an der damaligen preußisch-protestantischen „Germanisierung“
mitzuarbeiten (Weber 2015: 37).23 Denn um mit Weber zu fragen: Was hätte ei-
nen deutschen Geistesmenschen aus dem Westen Deutschlands dazu gebracht,
sich in der Posener Provinz24 und ‚protestantischen Diaspora‘ niederzulassen?
19 Der im Werk Sanderling genannt wird, nach einem Wattvogel aus der Gattung der Strandläufer.
Die phonetische Anspielung auf Sonderling liegt nahe. Weber stellt die Beziehung im Werk wie
folgt her: „Sanderling ist den Strömungen ausgesetzt, das stimmt; wie der Vogel, dessen Namen
er trägt, läuft er immer naher am Wassersaum seiner Zeit.“ (Weber 2015: 223)
20 Sie trafen sich noch 1924 kurz vor Rangs Tod auf Capri, wo Benjamin kurze Zeit später auch die
Nachricht vom Tode Rangs erhielt.
21 Zu Lebzeiten veröffentlichte Rang mehrere Aufsätze und Werke (Wołkowicz: 2007). Wołkowicz
nennt Rang dort einen „militanten Nationalisten“, was einen wesentlichen Gegensatz zu den
Recherchen Webers markiert (Wołkowicz 2007: 27).
22 Im Werk heißt es dazu: „Dass er nicht gänzlich in Vergessenheit geraten ist, hat Sanderling
wohl weniger dem Eifer seiner Nachkommen, als seiner Freundschaft mit Benjamin zu ver-
danken.“ (Weber 2015: 80).
23 Dazu muss man wissen, dass Beamter in Preußen etwas ganz Anderes als heute bedeutete, was
die gesellschaftliche Anerkennung betraf. Das Thema der Germanisierung wird an verschie-
denen Stellen von der Autorin selbst angesprochen: „Ich bin von Anfang an geneigt gewesen,
Sanderling ebenfalls für einen Germanisator zu halten. Wäre er, den nichts mit Polen verband,
sonst ausgerechnet in jenen Jahren aggressiver Germanisierung in den Osten gegangen? (Weber
2015: 222), Allerdings findet sie auch eine Tagebucheintragung, worin er schreibt, dass „die
Regierung kein Recht hat, einem Volke seine Sprache zu nehmen […].“ (Weber 2015: 222f.)
24 Es werden die beiden Dörfer Wiłkowice/Wolfskirch und Połajewo/Güldenau (etwa 50 km
nördlich von Poznań/Posen) genannt, die größere Gemeinde, wo Sanderling Pastor war und
weitere zwölf Dörfer der Umgehung betreute.
Schnittstelle Germanistik, Jahrgang 1 (2021), Ausgabe 1
© 2021 Universitätsverlag WINTER GmbH Heidelberg
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)142 Stephan Wolting
Warum zieht es den jungen Beamten in diese östliche, seit 1815 Preußen zugeschlagene, eigent-
lich aber polnische und mehrheitlich weiter von Polen bewohnte Provinz des Kaiserreichs, wo die
deutsche Sprache nur von wenigen gesprochen wird und wo nur wenige – mehr oder weniger
dieselben – seinem, dem evangelischen Glauben anhängen? Aus freien Stücken sei er in den
Osten gegangen lese ich. Aber aus welchen Gründen? Sicher war er keiner, der den gangbarsten
Weg gesucht hätte. Und warum der Osten? In einem Brief an Richard Dehmel schreibt sein Ju-
gendfreund Franz Servaes, Sanderling sei mehrere Jahre als Germanisator in partibus infidelium
im Posen‘schen gewesen, als einer also, der ausgezogen ist in von Andersgläubigen besiedelten
Gegenden das Deutschtum zu verbreiten. Mit Andersgläubigen sind in diesem Fall nicht so sehr
religiöse Abweichler gemeint als solche, die nicht dem Glauben an das Deutschtum anhängen. Es
scheint demnach, so jedenfalls sieht es sein engster Jugendfreund, als habe Sanderling sich nach
Posen begeben, um sich tatkräftig an der von Bismarck und den nachfolgenden preußischen
Regierungen betriebenen Stärkung des Deutschtums zu beteiligen. (Weber 2015: 35)
Um diese Problematik weiter zu vertiefen, bedient sich Weber der ‚Technik‘
einer herantastenden Infragestellung25, gerade was die eigenen Recherchen26
anbelangt. Sie betreibt auf diese Weise nicht allein eine Art von literarischer
transgenerationeller Vergangenheitsbewältigung (Druxes 2015), sondern
stellt gleichzeitig das damalige Umfeld dar, das Bild einer Region, die zu dieser
Zeit vor allem durch den Versuch einer deutschen kulturellen Inbesitznahme
gekennzeichnet war.
Isoliert betrachtet wäre dieser Umstand für den hiesigen Kontext eher zu
vernachlässigen, fiele nicht in diesem Zusammenhang auch jener Satz, den
Webers Werk leitmotivisch durchzieht bzw. von der Autorin immer wieder von
neuem zitiert wird. Bei einem Besuch einer ‚Irrenanstalt‘ oder „Idiotenanstalt“
(O-Ton Rang) Owińska im Posener Land rutscht ihrem Urgroßvater die Frage
heraus: „Warum vergiftet ihr diese Menschen nicht?“ (Weber 2015: 67, 113,
135, 143, 225 u. a.)
Einschränkend muss allerdings erwähnt werden, dass dieser Satz in Rich-
tung Eugenik der einzige Hinweis auf eine solche Einstellung ist. An anderen
Stellen sind allerdings, wenngleich kryptischer, d.h. impliziter, auch polen-
feindliche Äußerungen im Sinne eines ‚zivilisatorischen Rückstands‘ der Be-
völkerung in den Schriften zu finden, wie Weber bemerkt, ohne diese explizit
zu zitieren. Eine zivilisatorische Abwertung des ‚Ostens‘ durchzieht im Übrigen
die Familiengeschichte bis zu ihrem Vater hin.27
Gleichsam deutet sich damit der Horizont eines Werks an, innerhalb des-
sen versucht wird, eine Entwicklung aufzuzeigen, wie jemand zum einen dazu
25 Anlehnend an die Begründung der Jury des deutschen Buchpreises 2020 für ihr letztes Werk,
wo innerhalb der Begründung der Jury das Prinzip der „tastenden Annäherung“ an Identitäts-
und Kulturräume hervorgehoben wird (in Ahnen das Posener Land, in Annette die Region der
Bretagne).
26 So fragt sie sich beispielsweise bei Ihrer Recherche im Bundesarchiv Koblenz auf den Spuren
ihres Nazi-Großvaters, ob sie nicht selbst zur Denunziantin geworden sei (Winter 2015: 104f.).
27 Weber selbst natürlich ausgenommen.
Schnittstelle Germanistik, Jahrgang 1 (2021), Ausgabe 1
© 2021 Universitätsverlag WINTER GmbH Heidelberg
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)„Vergangenheit ist etwas, das plötzlich vor uns liegt.“ 143
kommen kann, eine solche Frage zu äußern und zum anderen, ob sich eine
solche Einstellung in der Familiengeschichte fortsetzt. Dass die Autorin im Ge-
spräch mit Schriftstellerkollegen klug genug und zudem gut beraten gewesen
ist, diese Aussage nicht mit unhistorischen bzw. heutigen Kriterien zu betrach-
ten, legt wiederum der Untertitel des Werks nahe: Ein Zeitreisetagebuch. In
diesem Sinne vollzieht Weber – und in diesem Fall ist die Autorin ganz entge-
gen dem narratologischem Paradigma wirklich mit der Erzählerin gleichzu-
setzen – eine doppelte Reise: zum einen in die Zeit vom Ende des 19., Anfang
des 20. Jahrhunderts, zum anderen in den Raum zu unterschiedlichen Orten,
nicht nur nach Posen und ins Posener Land28, sondern auch etwa ins Benja-
min-Archiv nach Berlin29, wieder zurück in ihre Wahlheimat Paris30, in die
Bretagne31 oder in die hessische ‚Irrenanstalt‘ Hadamar32 in der Nähe von
Braunfels an der Lahn.33 Ein weiterer Umstand dürfte in diesem Kontext von
nicht unerheblicher Bedeutung gewesen sein: dass der Sohn des Urgroßvaters,
also ihr Großvater, selbst nach Angaben seines Sohns ein „überzeugter Nazi“
war (Weber 2015: 75), zu dem sie aber keinerlei Kontakt unterhielt, was sie im
Nachhinein als „glücklichen Umstand“ bezeichnet, vor allem deshalb, weil er
sie als uneheliches Kind nicht anerkannte (Weber 2015: 232).
3. Die Reise in die Vergangenheit als Familienkontinuum?
Rangs Nachlass befindet sich im Benjamin-Archiv als Einrichtung der Aka-
demie der Künste auf der Luisenstraße in Berlin-Mitte, wozu Weber die Er-
laubnis erhält, Einblick zu nehmen. Weber thematisiert an vielen Stellen ihre
eigene Recherche und berührt somit immer wieder ihre eigene Familienge-
schichte, etwa wie sie als uneheliches Kind auf die Welt kommt und von ihrer
28 Zu den Orten ihres Urgroßvaters, etwa zur ehemaligen ‚Irrenanstalt‘ Owińska oder in das ehe-
malige Konzentrationslager Posen/Fort VII Colomb bzw. zu dessen Überresten.
29 Außerdem ins Bundesarchiv Koblenz und ins Landesarchiv Nordrhein-Westfalens in Duisburg.
Dabei wundert sich die Autorin nicht über die klischeehafte Sachlichkeit und Effizienz des Per-
sonals, wie sie schreibt, allerdings schon darüber, wie problemlos man die Erlaubnis bekommt,
über NS-Repräsentanten zu recherchieren.
30 Weber lebt seit ihrem 18. Lebensjahr in Paris und bezeichnet sich als „eine Deutsche, die von
außen“. Es wäre interessant, diese dritte (fremdkulturelle) Perspektive als Tertium comparatio-
nis noch weiter zu untersuchen. In Ahnen beschreibt sie in Paris die Treffen mit ihrer Freundin
Cecile Wajsbrot, der bekannten jüdischen, früher in Paris, heute in Berlin lebenden Schriftstel-
lerin, die Weber auch übersetzt hat.
31 Wo sie mit dem Künstler Pierre Apatschevsky zusammentrifft, der sonst ebenfalls in Paris lebt
und dessen jüdische Familie aus Odessa stammt.
32 In Hadamar wurde das Euthanasie-Programm der Nationalsozialisten für angeblich geistes-
kranke Patienten umgesetzt und mindestens 15.000 Menschen in der Gaskammer umgebracht
( [18.01.2021]).
33 Etwas kalauerhaft wäre hier ‚der Name ist Programm‘ festzustellen.
Schnittstelle Germanistik, Jahrgang 1 (2021), Ausgabe 1
© 2021 Universitätsverlag WINTER GmbH Heidelberg
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)144 Stephan Wolting
lleinerziehenden Mutter großgezogen wird. Von ihrem biologischen Vater,
a
dem Pädagogikprofessor Adalbert Rang34, wird ihr bezüglich ihrer Recherchen
vorgeworfen, sich auf diese Weise in die Familiengeschichte „einschreiben zu
wollen“ (Weber 2015: 153).
Bis zuletzt will der Vater die NS-Vergangenheit seines Vaters verschweigen,
des Großvaters Webers und Sohns von Florens Christian Rang, wie zudem We-
bers Recherchen ergeben oder eigene schriftliche Äußerungen des Großvaters
belegen. Außerdem existieren Dokumente in Form von Fragmenten und An-
fängen geschriebener Texte darüber, wonach der Großvater begann, eine Bio-
grafie über seinen Vater zu schreiben35. Die Autorin entrüstet sich über ein
Manuskript des Großvaters, das sie findet, unter dem Titel Der Pfarrer von
Połajewo:
Ein Kapitel des Manuskripts […] ist überschrieben mit Das sündige Dorf. Eine grauenhafte,
kaninchenhafte Unzucht habe geherrscht unter den menschenähnlichen Geschöpfen, die das
Dorf bewohnten, ein einziger elender, verdeckter Sündenpfuhl sei das gewesen. Sodom und
Gomorra konnten nicht schlimmer verderbt sein. [Im Original kursiv gedruckt; St.W.] […] Der
Pfarrer von Połajewo ist der Versuch des Sohnes, den Vater zu sich runterzuziehen, einen bie-
deren, verlogenen Bildungsbürger aus ihm zu machen, wie er selbst einer ist, schreie ich in
meiner Wut. Ich verfluche keinen Gott, ich schreie nicht zum Himmel, aber es schreit zum
Himmel, das einem, der mit Mördern paktierte, Unzucht das schlimmste und widerwärtigste
aller Übel ist. (Weber 2015: 323f.)
Aufgrund der Bekanntschaft seines Vaters mit Martin Buber erhält dieser
Großvater nach dem Krieg, als es um die Bestrafung von NS-Verbrechern geht,
einen ‚Persilschein‘. Vor diesem Hintergrund lässt sich dann in der Tat im
wortwörtlichen Sinne von einem die Generationen transzendierenden Erin-
nern sprechen (Druxes 2015). Diese Verbindung stellt Weber selbst ganz ex-
plizit her, wenn sie fragt: „Wie hat es geschehen können, dass aus dem Sohn
eines Sanderlings, eines Mannes also, der von Juden umgeben war und in ih-
nen seine, des Christen ältere Brüder sah, ein Nazi wurde?“ (Weber 2015: 53)
Im Gegensatz zu seinem Sohn wie seinem Enkel legt Florian Christian Rang
in Tagebüchern, die Weber im Benjamin-Archiv konsultiert, allerdings ein
durchaus selbstkritisches Geständnis in Form einer protestantisch eingefärb-
ten ‚seelischen Innenschau‘ (und später unter dem starken Einfluss der Schrif-
ten Nietzsches ein Ringen mit Gott bis hin zur späteren Ungläubigkeit) ab,
34 Er war Professor an der Pädagogischen Hochschule Berlin (1968-1982, die Anfang der 1980er
Jahre aufgelöst und in schon bestehende andere Hochschulen wie die FU etc. integriert wurde)
und wurde später Professor an der Universität Amsterdam (von 1982 bis zu seiner Emeritie-
rung 1993).
35 Der Großvater war Direktor der Stadtbibliothek Bielefeld (später jener in Köln) war. Übrigens
plante auch Webers Vater eine ganze Biografie über ihn zu schreiben, es blieb bei einem Porträt
für die Neue Rundschau 1959. 2008 übergab er die Dokumente an das Benjamin-Archiv. Von
ihm liegt ein einziges veröffentlichtes Dokument vor mit dem Titel Der Roman.
Schnittstelle Germanistik, Jahrgang 1 (2021), Ausgabe 1
© 2021 Universitätsverlag WINTER GmbH Heidelberg
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)„Vergangenheit ist etwas, das plötzlich vor uns liegt.“ 145
verschweigt im Gegensatz zu den Vertretern der späteren Generationen nichts
explizit, sondern versucht, sich Rechenschaft über Dinge seines Lebens abzu-
legen, dessen biographische Eckdaten wie folgt lauten: in Kassel geboren, ka-
tholisch getauft, Konvertierung der Familie zum protestantischen Glauben,
Jurastudium in Köln (wo er auch zum Dr. jur. promoviert), Verwaltungsjob in
Halberstadt. zunächst Leben eines „Lebemanns“36, Umzug ins Posener Land,
zu dieser Zeit Aufnahme eines Theologiestudiums in Greifswald. Direktor der
Raiffeisenbank in Berlin sowie Abfassen theoretischer Schriften.37
4. Zur kulturhistorischen Situation des Posener Landes in
literarischen Werken
Vom Jahre 1815 an wurde Poznań der Provinz Preußen einverleibt. Nach der
dritten polnischen Teilung gehörte Posen mehr als 100 Jahre zum Königreich
Preußen. Das Gebiet war mit relativ wenigen Deutschen besiedelt. Es gab eine
große polnische Mehrheit sowie eine jüdische und deutsche Minderheit. Die
Provinz galt von deutscher Seite als einigermaßen „ungeliebt“ (Neubach 2019),
von polnischer Seite wurde es als ihr Land angesehen, worauf Weber an meh-
reren Stellen ihres Werks eingeht (u.a. Weber 2015: 241f.).
Bismarck spricht in dem Zusammenhang nicht von Provinz, sondern von
Schutzgebiet (Wiss. Dienst Deutscher Bundestag 2021; Broszat 1963: 129-172;
Wehler 1968: 297-316) und stellt die Provinz damit afrikanischen Kolonien
gleich.38 Bei den meisten Werken innerhalb der deutschsprachigen Literatur
handelt es sich vorwiegend um Versuche einer kulturellen wie literarischen
Inbesitznahme, etwa innerhalb der sogenannten Ostmarkliteratur, die wis-
senschaftlich hinreichend bearbeitet ist.
Darüber hinaus ist zu Recht behauptet worden, dass Posen und die Umge-
bung weder in der deutschen, jüdischen noch in der polnischen Literatur eine
ähnlich starke Resonanz gefunden hat wie Schlesien, Danzig und Umgebung,
36 Weber geht auch darauf in ihrem Werk ein, wo sie etwa die Beziehung zu der Polin Pelagia
Kruszszyńska, genannt Pela, beschreibt, die für ihn wohl die „große Liebe“ war und an die er
selbst noch am Tag seiner Hochzeit mit Agnes denkt. (Weber 2015: 45f.)
37 Als seine Hauptwerke gelten (das erstgenannte Werk haben u.a. Benjamin und Buber unter-
stützt): Deutsche Bauhütte. Ein Wort an uns Deutsche über mögliche Gerechtigkeit gegen
Belgien und Frankreich und zur Philosophie der Politik. Mit Zuschriften von Alfons Paquet,
Ernst Michel, Martin Buber, Karl Hildebrandt, Walter Benjamin, Theodor Spira, Otto Erdmann.
Leipzig: Sannerz 1924 sowie Historische Psychologie des Karnevals, erschienen in: Die Kreatur
II/2 (1927/28); Neuausgabe herausgegeben von Lorenz Jäger, Berlin 1983, die Weber beide
kommentiert.
38 Shared history ist ein Begriff, der der postkolonialistischen Debatte (bzw. dem Diskurs) ent-
stammt, und wird oft in Zusammenhang mit dem Dependenzdiskus benutzt. Der Versuch ana-
log dazu, eine shared literary landscape festzumachen, erwies sich als unhaltbar.
Schnittstelle Germanistik, Jahrgang 1 (2021), Ausgabe 1
© 2021 Universitätsverlag WINTER GmbH Heidelberg
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)146 Stephan Wolting
Masuren respektive Ostpreußen o. ä. (Greser 2016; Wojtczak 1998). Einen lite-
rarischen Mythos dieser Region hat es in diesem Sinne nicht gegeben. Ebenfalls
ist richtig, dass die wenigen Zeugnisse anspruchsvoller Literatur insbesondere
von Autoren stammen, die auf der Durchreise waren, wie etwa Heinrich Heine39
oder Clara Viebig, die zu Sommeraufenthalten die Gegend besuchte und diese
in ihrem Werk Das schlafende Heer beschrieb.40
Webers Werk weist keinerlei Referenz zu diesen früheren Werken von Be-
schreibungen des Posener Landes – auch nicht in Absetzung oder Entgeg-
nung – auf, und schon gar nicht zu der Ostmarkliteratur o. ä. Sie stellt von
daher hierzu bewusst und intentional keinerlei literarische Intertextualität
her.41 Dazu lässt sich eine ganz andere literarische Qualität beobachten. An-
näherung besteht in Webers Fall in einem völlig anderen Ansatz von Singula-
rität, den man eine poetische Inbesitznahme einer kulturellen Fiktion nennen
kann, die den Begriff der historischen Wahrheit durch den einer literarisch-
künstlerischen Wahrhaftigkeit ersetzt, innerhalb derer die Autorin sich immer
wieder auf den einzelnen Wegstrecken Rechenschaft über ihr Vorgehen ablegt.
Durch den Einbezug und die Problematisierung des eigenen Standpunkts
wie Standorts (Wierlacher 2020: 357-359) unterscheidet sich Webers Ansatz
39 In seiner ihm eigenen Art betrachtet Heine auch Posen und das Posener Land in einer Mi-
schung aus Identifikation und Ironie, sprich Distanz, Heines wohlbekannte Strategie, wenn er
etwa davon spricht: „Posen, die Hauptstadt des Großherzogtums, hat ein trübsinniges, uner-
freuliches Ansehen. Das einzige Anziehende ist, daß sie eine große Menge katholischer Kirchen
hat. Aber keine einzige ist schön. […] Als wenn die unglückliche Stadt nicht genug hätte an dem
bloßen Theater!! ( [25.01.2021]).
40 Als das zweite relativ prominente Beispiel fungiert Clara Viebig, die von Wojtczak (1998: 66ff.)
zur „Ostmarkliteratur gezählt wird und die in ihrem Werk Das schlafende Heer“ diese Gegend
beschreibt, die sie von häufigen Sommerferienbesuchen auf einem Gut bei Verwandten im Pose-
ner Land, woher ihre Eltern stammten, kannte. Clara Viebig schreibt: „Meine Heimaten. Meine
Eltern stammen beide aus der Provinz Posen, daher, wo sich, wie man in dem von der Natur so
bevorzugten Rheinland denkt, Hasen und Füchse Gutenacht sagen. Da kam ich nun hin. Eisen-
bahn gab es nicht bis zum Gut der Verwandten, der Wagen wartete auf der kleinen Station;
endlos ging‘s durch Sand und Korn und Rübenfelder, und weiter durch Rübenfelder, Korn und
Sand. Rebhühner schwirrten auf, wenige Dörfer zeigten sich, die Räder holperten in ausgefah-
renen Landweggeleisen, und der Himmel stülpte sich über das flache Land, wie eine Glasglocke
über den Teller.“ (Viebig 1998: 6; Michalska 1968)
41 Obwohl in dem Werk häufig Intertextualität hergestellt wird, vielfach auch zu Texten polnischer
Schriftsteller, wie z.B. Mickiewicz‘ Dziady [Totenfeier] (Weber 2015: 240) oder Miłosz‘ Das
verführte Denken (Weber 2015: 98). Zudem erwähnt sie vor allem jene historischen Werke, bei
denen sie davon ausgehen konnte, dass sie der Urgroßvater gelesen hatte wie Alfred Knobloch
oder des damaligen preußischen Kultusministers Graf Zedlitz (Weber 2015: 222, 225, 235),
aber auch historische Werke über den „Deutschen Ostmarkenverein“, eine „nationalistische
Propagandaorganisation“ (Weber 2015: 41) oder Die Stadt Posen unter preußischer Herrschaft
von Moritz Jaffé von 1909 (Weber 2015: 42), wo es unter anderem heißt. „In der Tat gehen
Deutsche und Polen im engen Raume des heutigen Posen wie Fremde aneinander vorüber.“
Schnittstelle Germanistik, Jahrgang 1 (2021), Ausgabe 1
© 2021 Universitätsverlag WINTER GmbH Heidelberg
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)„Vergangenheit ist etwas, das plötzlich vor uns liegt.“ 147
iametral von jeder anderen Literatur über diese Region, im Übrigen auch von
d
den Beschreibungen Heines, der als bekannterweise großer Spötter und letz-
ter Vertreter wie Überwinder der ‚romantischen Schule‘ zugleich zwar eine
Distanz zu dem Beschriebenen, sprich der Region, entwickelt, den eigenen
Standpunkt allerdings ebenfalls nicht hinterfragt. Insofern erscheint es nur
konsequent, wenn Weber sich intertextuell keinesfalls mit der Literatur des
Posener Lands beschäftigt, dagegen aber mit bekannten polnischen Autoren
wie Stasiuk etc., wobei sie in dieser Beziehung das erste und einzige Mal im
Werk die Kontenance verliert und ihm dabei auf den Leim geht. Nicht zuletzt
hielt Weber von daher die ästhetische Form des Zeitreisetagebuchs für die an-
gemessene Form, die abschließend genauer beleuchtet werden soll.
5. Reisen in die Fremde von Raum und Zeit: Zeitreisetagebuch als
literarisch-kulturelle Fiktion
Auf den ersten Blick scheint es vermessen, mit der Textform des Zeitreisetage-
buchs als neuer Gattung zu operieren, da diese Form literaturwissenschaftlich
weder näher definiert ist, noch sich allgemeiner Akzeptanz erfreut. Wenn man
im Sinne der Autorin dennoch von einer solchen Annahme ausgehen mag, so
sei paradoxerweise auf Arbeiten zur Gedächtnisforschung (Schacter 1996)
bzw. zum Erinnerungsdiskurs (Markowitsch 2005; Welzer 2002; Roth 2001)
verwiesen, die Vorarbeiten zu Konzepten einer „biographischen“ bzw. „histori-
schen Fiktion“ geleistet haben (Wolting 2015). Innerhalb dieser Studie wurde
der Fokus insbesondere auf die Kategorie der Fiktion gelegt, um „räumliche
Fiktion“ bzw. um den „literarischen Raum“ im Sinne Blanchots (2012) erwei-
tert. Grundvoraussetzung bleibt dabei, dass der literarische Raum nicht mit
einem wie auch immer angenommenen historischen oder geographischen
Raum gleichgesetzt werden kann.42 Der Hanser-Lektor Wolfgang Matz hat dies
im Gespräch mit dem Verfasser in einem anderen Kontext einmal leicht iro-
nisch so beschrieben: „In einem literarischen Raum kann man nicht wohnen.“
(zit. n. Wolting 2020: 53)
Der Begriff der räumlichen Fiktion legt also nahe, dass es sich im Sinne von
Lotman (2009) nicht um reale, sondern um künstlerisch gestaltete Räume han-
delt (Lotman 2009: 261-279; Wolting 2020: 47-53). Mag dies auf den ersten
42 Es sind also mehrere Differenzierungen hierbei nötig, die oft nicht streng eingehalten werden:
Der Ort ist kein Raum, der künstlerische bzw. literarische Ort bzw. Raum kein geographischer
respektive historischer etc. Nimmt man diese Grenzziehungen nicht vor, werden Untersuchun-
gen oft in der Argumentation nicht sauber. Das Problem der Vereinnahmung eines konkreten
geographischen Orts als künstlerischer Raum würde sich damit von allein lösen. Eine ‚literari-
sche Region‘ kann niemals mit einer ‚geographischen Region‘ kongruent sein.
Schnittstelle Germanistik, Jahrgang 1 (2021), Ausgabe 1
© 2021 Universitätsverlag WINTER GmbH Heidelberg
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)148 Stephan Wolting
Blick selbstevident erscheinen, so zeigen doch zahlreiche, auch jüngere Publi-
kationen, dass der reale historische Raum nach wie vor nicht selten mit dem
künstlerisch gestalteten Raum gleichgesetzt wird. Daraus resultiert eine zum
Teil rein inhaltsfixierte oder ‚historische‘ Annäherung respektive eine Darstel-
lung mit von außen an das Werk herangetragenen Kategorien, selbst dort, wo
von hybridem Kulturraum oder von kulturellem Gedächtnis gehandelt wird.
Nach Überzeugung des Verfassers würde eine solche Betrachtungsweise dem
Werk Webers zumindest nicht angemessen gerecht werden. Denn die Autorin
selbst besteht geradezu auf der ästhetischen Autonomie des literarischen
Kunstwerks, eine Position, wie sie im Übrigen generell von einer überwiegenden
Mehrheit von Autorinnen und Autoren vertreten wird.43
Weber lehnt sich mit einer gewissen Radikalität an die Literaturkonzeption
Maurice Blanchots (2012) an44,wonach schon „der Schriftsteller […] nicht beim
Werk verbleiben“ kann. In diesem Zusammenhang mahnt Blanchot die Schrift-
stellerin/den Schriftsteller, zu jener „Entferntheit“ zurückzukehren, „durch die
er zunächst eintrat, um das Vernehmen dessen zu werden, was er schreiben
musste“ (Blanchot 2012: 87). Genau diese von Blanchot geforderte Position
der „Entferntheit“ nimmt Weber in der Beschreibung ein bzw. geht noch darü-
ber hinaus: Nicht nur die Autorin verschwindet im Sinne Blanchots hinter ihrem
Werk, sondern sie transzendiert zugleich jede Form biographischer Bezüge
über die Beschreibung einer Region bzw. einem historischen Bezug hinaus
(Blanchot 2012: 16).
Von daher und daran anknüpfend kommt man mit Weber nicht umhin, die
Singularität biographischer Beschreibungen in einem ästhetisch phänomeno-
logischen Sinne herauszustellen. Sie setzt sich damit deutlich von oben erwähn-
ten Positionen wie einem „kulturellen Gedächtnis“ o.ä. ab, nicht zuletzt dadurch,
dass sie die „Singularität“ (Reckwitz 2017) von Biografien betont,
[…] dass es in Wirklichkeit nur einzelne gibt mit ihren einzelnen Gesinnungen oder Gesin-
nungslosigkeiten, und in diesen Einzelnen, in den meisten von ihnen, die leisen oder dröhnen-
den Stimmen ihres Gewissens. Die Bücher irren, es gibt keine Massen, es gibt nur einen Vater
und einen Sohn oder eine Mutter und einen Sohn oder eine Tochter und zwischen ihnen gibt es
Wege, die weiterführen oder abbrechen. Die Erklärung in den Büchern erklären das Leben und
Denken und Handeln dieser Einzelnen nicht. (Winter 2015: 256)
43 Etwas überpointiert formuliert: Niemand schreibt ein Werk, um sich in ‚ein kollektives oder
kulturelles Gedächtnis‘ respektive dem ‚Gedächtnis einer Region‘ etc. einzuschreiben, eine Dis-
kussion, die in der Gedächtnisforschung, im Übrigen seit Jahren ‚geklärt‘ erscheint. Vor allem
der Neurowissenschaftler Markowitsch (2005) gilt als literaturaffin und benutzt Kategorien der
Literaturwissenschaft, um Gedächtnisphänomene zu markieren.
44 Etwa auch im Verhältnis zu ihren Übersetzungen (übrigens ins Französische wie ins Deutsche),
sie übersetzte u.a. einen der besten, einen stark ästhetischen Literaturbegriff vertretenden fran-
zösischen Schriftsteller Pierre Michon.
Schnittstelle Germanistik, Jahrgang 1 (2021), Ausgabe 1
© 2021 Universitätsverlag WINTER GmbH Heidelberg
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)„Vergangenheit ist etwas, das plötzlich vor uns liegt.“ 149
Insbesondere die Form des Zeitreisetagebuchs erlaubt nun jenen neuen, ganz
anderen, besonderen Zugang, was als ein ästhetisches Transzendieren etwa
auch von Regionalität (aber auch des Erinnerungsdiskurses) bezeichnet wer-
den kann. Diese Konzeption ist nicht mit Positionen zur Transregionalität zu
verwechseln, wie sie etwa in der Kunstgeschichte, aber auch innerhalb der Lite-
ratur- und Kulturwissenschaft, vertreten werden (Bogade 2016).
6. Zusammenfassung: Zeitreisetagebuch als ‚Journal einer
(Selbst-)Erkundungsreise‘
Die Autorin selbst verweist darauf, dass diese neue Art einer „literarischer Re-
flexion“ im Sinne des „Sich-auf-den-Weg-Machens“ es ihr erlaubt, „Vergangen-
heit als etwas zu begreifen, was vor uns liegt“, als etwas nicht fest Fixiertes
(Druxes 2015: 6). Sie knüpft dabei an Konzepte innerhalb des Erinnerungsdis-
kurses an, wonach individuelles wie kulturelles Erinnern mehr mit Gegenwart
als mit Vergangenheit zu tun habe (Welzer 2002; Schacter 1996). In Webers
Werk erhält Erinnerung darüber hinaus sogar ein zukunftweisendes, utopi-
sches Moment, und hierin scheint ihr Ansatz äußerst innovativ.45
Insofern wird eine zukünftige Funktion der Zeitreise manifest, die wieder-
um eng mit der formalästhetischen Vorgehensweise Webers verknüpft ist, in
die sie biographische und metabiographische Bemerkungen einbettet. Über-
haupt scheint Weber immer wieder von neuem nach der angemessenen litera-
rischen Form ihrer Werke zu suchen, worin sich z.B. auch ihr letztes Werk von
dem hier zugrundeliegenden unterscheidet: Bei dem jüngsten Werk handelt es
sich um ein Versepos. Gemeinsam ist beiden Werken eine meta-narrative Er-
zählhaltung, wie es hier heuristisch genannt werden soll: Die eigene Schreib-
weise oder Narration wird mit zum Thema des Werks gemacht. Abschließend
seien die zentralen Punkte der hier vorgenommenen Reflexionen noch einmal
kurz zusammengefasst:
Anne Webers Zeitreisetagebuch stellt, einen innovatorischen gattungs
ästhetischen Versuch dar, sich auf die Spur einer ihr familiär nahestehenden
Person (ihres Urgroßvaters), mehreren Zeiten (im Sinne von transgeneratio-
nal memory) und einer spezifischen Region, des Posener Landes, zu begeben.
Auf diese Weise gelingt es ihr, sich dem einen Zeitkolorit, der Spezifik eines
Ortes sowie einer historischen Person zu nähern. Die Autorin geht dabei vor
allem formalästhetisch mit der Form des Zeitreisetagebuchs einen neuen,
anderen Weg. Durch dessen Doppelbedeutung und vielfältigen Bezüglichkeit
45 Dieser Ansatz ist nicht mit ‚zukünftigen Erinnerungen‘ zu verwechseln, wie er beispielsweise
von Markowitsch (2015) zum prospektiven Gedächtnis vertreten wird.
Schnittstelle Germanistik, Jahrgang 1 (2021), Ausgabe 1
© 2021 Universitätsverlag WINTER GmbH Heidelberg
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)150 Stephan Wolting
‚erschafft‘ die Autorin künstlerisch-literarisch eine Phase der Lebensgeschichte
des Urgroßvaters neu, die nicht mit allgemeinen (epistemologischen) Katego-
rien, sondern durch diese Art der literarischen Darstellung nur individuell zu
erfassen ist. Insofern erscheint es nur konsequent, wenn am Ende das beson-
dere Einzelschicksal eines Mannes ‚fiktiv‘ überdauert. Durch die Vorgehens-
weise sowie die Qualität ihrer Darstellung gelingt es der Autorin zugleich, sich
aus der Familiengeschichte herauszuschreiben46, vor allem durch ihre künst-
lerische Vorgehensweise, jenen Wechsel von Identifikation und Distanz, was
den eigenen Standpunkt wie Standort nicht ausnimmt. Insofern kann die Dar-
stellung eines literarischen Orts wie der ‚Konstruktion einer Region‘ nicht nur
für die Vergangenheit etwas Zukünftiges bedeuten, sondern schafft zugleich
eine neue Verbindung von ästhetischer, historischer (temporaler) wie kultu-
reller (lokaler) Annäherungsweise.
Hinsichtlich der ästhetischen Funktion entsteht so zugleich literarischer
Raum wie kulturelle Fiktion. Als Ergebnis einer literarischen Reise (in die in-
dividuelle Lebensgeschichte wie in die Geschichte der Region) erteilt Weber
der Fiktion eines familiären Kontinuums wie jener eines kulturell-historisch
authentischen Raums eine endgültige Absage.
Literatur
Assmann, Jan (1992): Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in
frühen Hochkulturen. München: Beck.
Assmann, Aleida (2013): Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur. Eine Intervention. Mün-
chen: Beck.
Bachelard, Gaston (1987 [1957]): Poetik des Raumes. Frankfurt/M.: Fischer.
Bachtin, Michail (1973): Chronotopos. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Blanchot, Maurice (2012): Der literarische Raum, Die wesentliche Einsamkeit. Zürich, Berlin:
Diaphanes
Böhme, Hartmut (2005): Einleitung: Raum – Bewegung – Topographie. – In: Ders. (Hg.), Topogra-
phien der Literatur: Deutsche Literatur im transnationalen Kontext. Stuttgart: Metzler.
Bogade, Marco (Hg.) (2016.): Transregionalität in Kult und Kultur. Bayern, Böhmen und Schlesien
zur Zeit der Gegenreformation. Köln, Weimar, Wien: Böhlau.
Broszat, Martin (1963). Zweihundert Jahre deutsche Polenpolitik. München: Ehrenwirth.
Cassirer, Ernst (1985 [1931]): Mythischer, ästhetischer und theoretischer Raum. – In: Ders., Symbol,
Technik, Sprache. Aufsätze aus den Jahren 1927–1933. Hamburg: Meiner.
Druxes, Helga (2015): Glossen. Plötzlich liegt die Vergangenheit vor uns (dickinson.edu) (dickinson.edu) [23.01.2021].
46 Spätestens durch die künstlerische Bestätigung des Buchpreises (allerdings für das andere
Werk), hat sie sich auf andere Weise aus ihrer ‚mediokren‘ männlichen Familiengeschichte ‚he-
rausgeschrieben‘.
Schnittstelle Germanistik, Jahrgang 1 (2021), Ausgabe 1
© 2021 Universitätsverlag WINTER GmbH Heidelberg
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)„Vergangenheit ist etwas, das plötzlich vor uns liegt.“ 151
Druxes, Helga (2018): Transgenerational Holocaust Memory in Anne Weber’s Ahnen and Esther
Kinsky’s Am Fluß < Project MUSE - Transgenerational Holocaust Memory in Anne Weber‘s
Ahnen and Esther Kinsky‘s Am Fluß (jhu.edu)>[21.02.2021].
Greser, Ewa (2016): Die Stadt Posen in der deutschsprachigen Literatur (1772–1918). Poznań:
Nauk. UAM Poznań.
Gössmann, Wilhelm/Hollender, Christoph (1996) (Hgg.): Literarisches Schreiben aus regionaler
Erfahrung: Westfalen – Rheinland – Oberschlesien und darüber hinaus. Paderborn: Schöningh.
Halbwachs, Maurice (1985 [1925]): Das kollektive Gedächtnis. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Heine, Heinrich, Reisebilder [25.01.2021].
Kant, Immanuel (61982): Kritik der reinen Vernunft (Werkausgabe Bd. III u IV). Hrsg. v. Wilhelm
Weischedel. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Koselleck, Reinhart (2004): Gibt es ein kollektives Gedächtnis? Sofia: Maison des Sciences de
l’ Homme et de la Société.
Lessing, Gotthold Ephraim (1974 [1766]): Laokoon oder Über die Grenzen der Malerei und Poesie.
– In: Werke, Bd. 6. München: Hanser, 7-187.
Lotman, Jurij (2009): Zum künstlerischen Raum und zum Problem des Sujets. – In: Schmid,
Wolf (Hg.), Russische Proto-Narratologie. Texte in kommentierten Übersetzungen. Berlin: de
Gruyter, 261–279.
Mache, Beata (2021): Provinz Posen in jüdischer Heimatliteratur [07.01.2021].
Markowitsch, Hans (2005): Das autobiographische Gedächtnis. Stuttgart: Klett-Cotta.
Michalska, Urszula (1968): Clara Viebig – Versuch einer Monographie. Poznań: UAM.
Neubach, Helmut (2019): Posen – Preußens ungeliebte Provinz: Beiträge zur Geschichte des
deutsch-polnischen Verhältnisses 1815-1918. Herne: Freunde der Martin-Opitz-Bibliothek.
Nowikiewicz, Elżbieta (2014): Die Provinz Posen in Autobiographien und autobiographischen Auf-
zeichnungen. Eine literaturgeographische Lektüre. – In: Dies. (Hg.), Literarische Topogra-
phien in Ostmitteleuropa bis 1945. Frankfurt/M.: Lang, 187-207.
Pfohlmann, Oliver (2015): Ein literarisches Lehrstück. Mit ‚Ahnen‘ begibt sich Anne Weber auf die
Suche nach ihrem Urgroßvater, dem Walter-Benjamin-Freund Florens Christian Rang
[02.01.2021].
Połczyńska, Edyta (1988): Im polnischen Wind. Beiträge zum deutschen Zeitungswesen, Theater-
leben und zur deutschen Literatur im Großherzogtum Posen 1815–1918. Poznań: Nauk. UAM.
Połczyńska, Edyta/Wojtczak, Maria (1996): Die Provinz Posen in der deutschen Literatur um die
Jahrhundertwende. – In: Convivium. Germanistisches Jahrbuch. Polen. Bonn, 83–106.
Reckwitz, Andreas (2017): Die Gesellschaft der Singularitäten. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Roth, Gerhard (2001): Fühlen, Denken, Handeln. Wie das Gehirn unser Verhalten steuert. Frank-
furt/M.: Suhrkamp.
Rudiš, Jaroslav (22019): Winterbergs letzte Reise. München: Luchterhand.
Schacter, Daniel (1996): Searching for memory: The Brain, the Mind and the Past. London: Basic
Books.
Thum, Gregor (2006): Mythische Landschaften. Das Bild vom ‚deutschen Osten‘ und die Zäsuren
des 20. Jahrhunderts. – In: Ders. (Hg.), Traumland Osten. Deutsche Bilder vom östlichen Eu-
ropa im 20. Jahrhundert. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 181-212.
Schnittstelle Germanistik, Jahrgang 1 (2021), Ausgabe 1
© 2021 Universitätsverlag WINTER GmbH Heidelberg
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)152 Stephan Wolting
Viebig, Clara (1998): West und Ost – Novellen. – In: Dies., Leben und Werk. – Posen/Westpreußen
[25.01.2021].
Weber, Anne (2015): Ahnen. Ein Zeitreisetagebuch. Frankfurt/M.: Fischer.
Weber, Anne (2020): Annette. Ein Heldinnenepos. Berlin: Matthes & Seitz.
Wehler, Hans-Ulrich (1968): Die Polenpolitik im deutschen Kaiserreich 1871-1918. – In: Kluxen,
Kurt/Mommsen, Wolfgang J. (Hgg.), Politische Ideologien und Nationalstaatliche Ordnung.
Festschrift für Theodor Schieder. München, Wien: Oldenbourg, 297-316.
Welzer, Harald (2002): Das kommunikative Gedächtnis. Eine Theorie der Erinnerung. München:
Beck.
Wierlacher, Alois (2020): Hingabe und Vertragsstiftung. Lessings Emilia Galotti und Goethes
Iphigenie auf Tauris als Dramen bibelkritischer bzw. rechtspolitischer Sicherung menschli-
chen Lebens und Zusammenlebens. Mit einem fachstrategischen Beitrag über die Weiterent-
wicklung der im globalen Kontext unterschiedlich aufgestellten und standortbewusst agieren-
den Germanistik(en) zu einer multilateralen Regionalistik der deutschsprachigen Welt.
Heidelberg: Winter.
Wissenschaftlicher Dienst des Deutschen Bundestages (2021): Dokumentation Staatliche Maßnah-
men gegenüber der polnischen Minderheit und den Bevölkerungen in den überseeischen Ge-
bieten des Deutschen Reichs 1871 bis 1918 [25.01.2021].
Wojtczak. Maria (1998): Literatur der Ostmark – Posener Heimatliteratur – Literatur der Ostmark
– Posener Heimatliteratur (1890-1918). Poznań: Nauk. UAM.
Wołkowicz, Anna (2007): Mystiker der Revolution. Der utopische Diskurs um die Jahrhun
dertwende: Gustav Landauer – Frederik van Eeden – Erich Gutkind – Florens Christian
Rang – Georg Lukács – Ernst Bloch. Warschau: Uniwersytetu Warszawskiego.
Wolting, Stephan (2015): Fiktion und Fremde in Hans-Josef Ortheils Romanen ‚Die Erfindung des
Lebens‘ und ‚Die Moselreise‘. – In: Gansel, Carsten u.a. (Hgg.), Zwischen Fremdheit und Erin-
nerung. Entwicklungen in der deutschen und polnischen Literatur nach 1989. Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht, 43-55.
Wolting, Stephan (2020): Undine Gruenter. Deutsche Schriftstellerin mit Ziel Paris. Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht.
Schnittstelle Germanistik, Jahrgang 1 (2021), Ausgabe 1
© 2021 Universitätsverlag WINTER GmbH Heidelberg
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Sie können auch lesen