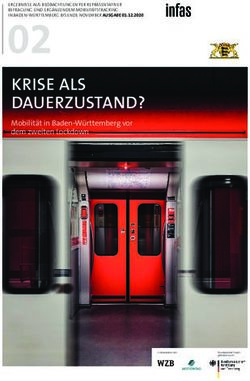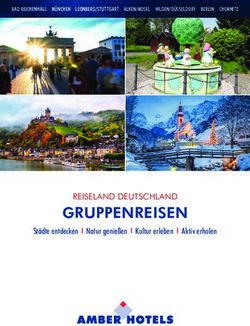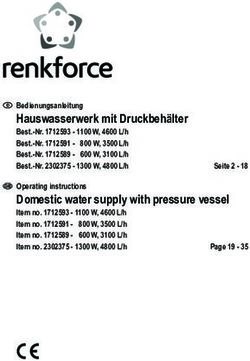Vitale Gewässer in Baden-Württemberg - Leben im und am Gewässer - Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Landesanstalt für Umwelt
Baden-Württemberg
Vitale Gewässer in
Baden-Württemberg
Leben im und am GewässerIMPRESSUM
HERAUSGEBER: LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg
Postfach 100163, 76231 Karlsruhe
www.lubw.baden-wuerttemberg.de
WBW Fortbildungsgesellschaft für Gewässerentwicklung mbH
Karlstraße 91, 76137 Karlsruhe
www.wbw-fortbildung.de
BEARBEITUNG: AG Vitale Gewässer in Baden-Württemberg
Thorsten Kowalke, Dietmar Klopfer – Ministerium für Umwelt, Klima
und Energiewirtschaft Baden-Württemberg
Bernd Karolus – LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg
Harald Miksch, Dr. Sandra Röck – WBW Fortbildungsgesellschaft
für Gewässerentwicklung
Johannes Reiss, Kathrin Bross – Büro am Fluss e.V.
TEXTBEITRÄGE: LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, Abteilung Nachhaltigkeit
und Naturschutz
Fischereiforschungstelle Baden-Württemberg
GESTALTUNG UND
TEXTREDAKTION: xx Design Partner, Stuttgart
LEKTORAT: Sigrid Englert, StuttgartINHALTSVERZEICHNIS
IMPRESSUM 2
1 DER KLEINE MÄRCHENDRACHE – KAMMMOLCH (TRITURUS CRISTATUS) 4
2 DER LURCH IN DEN LANDESFARBEN – FEUERSALAMANDER (SALAMANDRA SALAMANDRA) 6
3 DIE SCHIMMERNDE SCHÖNHEIT – BLAUFLÜGEL-PRACHTLIBELLE (CALOPTERYX VIRGO) 8
4 DER BEGNADETE BAUMEISTER – EUROPÄISCHER BIBER (CASTOR FIBER) 10
5 DIE WANDERNDE RIESIN – SEEFORELLE (SALMO TRUTTA) 12
6 DIE ANSPRUCHSVOLLE SCHMAROTZERIN – BACHMUSCHEL (UNIO CRASSUS) 14
7 DIE FISCHERIN DER NACHT – WASSERFLEDERMAUS (MYOTIS DAUBENTONII) 16
8 DER RITTER MIT DEN SCHERENHÄNDEN – STEINKREBS (AUSTROPOTAMOBIUS TORRENTIUM) 18
9 DER KIESLIEBENDE CHARAKTERVOGEL – FLUSSREGENPFEIFER (CHARADRIUS DUBIUS) 20
10 DIE FLOTTIERENDE FILIGRANE – ZIERLICHE TELLERSCHNECKE (ANISUS VORTICULUS) 22
11 DAS LEBENDE FOSSIL – BACHNEUNAUGE (LAMPETRA PLANERI) 24
12 DIE BETÄUBENDE TAUCHERIN – WASSERSPITZMAUS (NEOMYS FODIENS) 26
13 DER FLIEGENDE EDELSTEIN – EISVOGEL (ALCEDO ATTHIS) 28
LEGENDE PIKTOGRAMME 30
© LUBW Vitale Gewässer in Baden-Württemberg 31 Der kleine Märchendrache
Kammmolch (Triturus cristatus)
Foto: Tümpel beim Nüstenbach im Neckar-Odenwald-Kreis, Jürgen Gerhardt; Kammmolch, Torsten Bittner
Der ideale Lebensraum
für den Kammmolch
M it seinem auffälligen Rückenkamm, seiner präch-
tigen Färbung und dem silbrigen Band an
den Schwanzseiten, dem sogenannten „Milchstreifen“,
Der Kammmolch braucht
besonnte und fischfreie Stillgewässer. Dazu erinnert das Männchen des Kammmolchs im Hoch-
zählen beispielsweise Altarme, Kiesgruben, zeitskleid an einen Märchendrachen. Wenn sich die
Weiher, Tümpel und Gräben, die eine gut
zersetzte, lehmige Schlammschicht an der Lurche zur Überwinterung gegen Ende des Sommers
Gewässersohle besitzen und mit Wasserpflanzen
bewachsen sind. Im nahen Umfeld des Laich in ihre Landlebensräume zurückziehen, bilden sich
gewässers sollten sich Feucht- und Nass
wiesen, Brachen oder lichte Wälder befinden, die Hautsäume des Rückenkamms zurück. Bei Gefahr
wo Totholz, Steinhaufen und Holzstapel
dem Kammmolch gute Versteck- und Über
kann der Kammmolch ein milchiges Hautsekret ab-
winterungsmöglichkeiten bieten. sondern, das beim Menschen Hautreizungen hervor-
rufen kann. Sobald die Witterung nachts frostfrei
bleibt, wandert der Kammmolch aus seinem Winter-
quartier in die Laichgewässer. Einige Tiere überwin-
tern auch direkt im Gewässer. In der Laichzeit zwi-
schen April und Mai werben die Männchen mit einem
4 Vitale Gewässer in Baden-Württemberg © LUBWBalztanz um die Gunst der Weibchen und tragen ihr Krebse, Würmer, Egel und Schnecken. Auch die Eier
auffälliges Hochzeitskleid. Ist eine Partnerin gefun- und Larven anderer Amphibien verschmäht er nicht.
den, legt das Männchen ein Samenpacket ab, das vom An Land werden Regenwürmer, Schnecken, Insek-
Weibchen aufgenommen wird. Nach circa einer ten und ihre Larven gejagt. Die Molche werden
Woche beginnt die Eiablage. Dafür faltet das Weib- ihrerseits von Vögeln, Schlangen und Raubfischen
chen eine Tasche in den Blättern von Wasserpflanzen. gefressen.
Über mehrere Wochen werden darin insgesamt bis zu
400 Eier abgelegt. GEFÄHRDUNG UND SCHUTZ
VERBREITUNGSGEBIET In Baden-Württemberg ist der Kammmolch stark
gefährdet. Er ist durch das Bundesnaturschutzgesetz
In Deutschland ist der Kammmolch weit, aber lücken- besonders und streng geschützt und wird im Anhang
haft verbreitet. Er fehlt vor allem in höheren Lagen und II und IV der Fauna-Flora-Habitat-Richtline (FFH-
in stark landwirtschaftlich geprägten Gebieten. Richtlinie) geführt. Zu den wichtigsten Gefährdungs-
ursachen zählen die Zerstückelung der Habitate und
NAHRUNG das Erschweren der Wanderungen etwa durch den
Bau von Straßen. Außerdem spielt der Verlust von
Bei der Nahrungsaufnahme ist der Kammmolch nicht wertvollen Habitaten durch die Zerstörung oder Ent-
wählerisch. Gerade während der Paarungszeit sind die wertung von Kleingewässern durch Verfüllung oder
Molche auf ein reichhaltiges Nahrungsangebot ange- Trockenlegung eine große Rolle. Schutzmaßnahmen
wiesen. Sie fressen allerlei Wassertiere wie kleine sind daher der Erhalt und die Neuanlage von geeig
neten Laichgewässern und Wanderkorridoren, die
Offenhaltung der Laichgewässer und die Verhinde-
rung von Fischbesatz.
Foto: Torsten Bittner
Männlicher
Kammmolch
im Hochzeits
kleid
Larve eines
Kammmolchs
Foto: Piet Spaans, eigenes Werk, CC BY-SA 2.5,
https://commons.wikimedia.org
Foto: Piet Spaans, eigenes Werk, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org
Embryo
eines Kamm
molchs
in seiner
Eihülle; für
das Foto
wurde das
zusammen
gefaltete
Blatt aufge
klappt
© LUBW Vitale Gewässer in Baden-Württemberg 52 Der Lurch in den Landesfarben
Feuersalamander (Salamandra salamandra)
Foto: Monbach im Landkreis Calw und Feuersalamander, Torsten Bittner
D er Feuersalamander ist mit einer Körperlänge
von rund 20 Zentimeter unser größter heimi-
scher Schwanzlurch und die einzige einheimische
Der ideale Lebensraum Amphibienart, die fertig entwickelte Larven gebärt.
für den Feuersalamander
Erwachsene Tiere sind durch ihre variable schwarz-
Der Feuersalamander ist die einzige heimische
Amphibienart, die zur Fortpflanzung Fließ gelbe Zeichnung unverwechselbar. Feuersalamander
gewässer bevorzugt. Geeignete Gewässer für gehören zu den besonders geschützten Arten.
seine Larven sind naturnahe Waldbäche und
Quellen. Aber auch stehende Kleingewässer
können Salamanderlarven enthalten. Der typi
sche Lebensraum der erwachsenen Feuer Der Feuersalamander kommt in der kalten Jahreszeit
salamander sind feuchte Laub- und Mischwälder
in der Umgebung der Fortpflanzungsgewässer. nur an besonders warmen und windstillen Tagen gele-
Tagsüber dienen Erdlöcher, Baumstümpfe,
Steine und Moos den dämmerungs- und nacht
gentlich aus seinem Versteck. Besonders aktiv ist die
aktiven Tieren als ideales Versteck. Art bei Regen und bei Temperaturen über acht Grad
Celsius und bei Windstille, dem sogenannten „Sala-
manderwetter“. Bei Frost zieht er sich in sein Winter-
quartier zurück. Die Paarung findet zwischen April
6 Vitale Gewässer in Baden-Württemberg © LUBWund September ausschließlich an Land statt. Nach der GEFÄHRDUNG UND SCHUTZ
Paarung trägt das Weibchen die Embryonen etwa acht
bis neun Monate aus, bevor es die kiementragenden Alle einheimischen Amphibienarten stehen gemäß
Larven dann im Frühjahr in möglichst ruhigen Berei- Bundesnaturschutzgesetz unter besonderem Schutz.
chen kleiner Bäche absetzt. Als charakteristisches Hierzu gehört auch der Alpensalamander, der als
Merkmal des Feuersalamanders gelten die leuchtend alpine Art nur im äußersten Südosten Baden-Würt-
gelben Flecken. Diese Warntracht soll anderen Tieren tembergs im Bereich der Adelegg vorkommt. Der
signalisieren: Vorsicht giftig! Normalerweise verursa- Alpensalamander ist als Art des Anhangs IV der Fauna-
chen seine giftigen Sekrete beim Menschen – wenn Flora-Habitat-Richtlinie zusätzlich „streng g eschützt“
überhaupt – nur ein leichtes Brennen auf der Haut. und bringt voll entwickelte Jungtiere zur Welt.
VERBREITUNGSGEBIET In der App „Meine Umwelt“ oder über www.feuer
salamander-bw.de können Feuersalamanderfunde ge-
Der Feuersalamander ist in Deutschland vor allem in meldet werden. Jede Meldung hilft der LUBW, einen
bewaldeten Landschaften beheimatet. Dies sind vor aktuellen Überblick über die Verbreitung der ver-
allem Hügel- und Berglandschaften. Verbreitungs- steckt lebenden Art zu erhalten und dient somit als
schwerpunkte gibt es im westlichen, mittleren und Grundlage für erfolgreiche Schutzmaßnahmen.
südwestlichen Deutschland. In Baden-Württemberg
ist der Feuersalamander relativ weit verbreitet. Natür- Im Frühjahr
setzt das
liche Verbreitungslücken bestehen im Bereich des Weibchen die
Oberrhein-Tieflandes, auf der Schwäbischen Alb und Larven in
kleine Bäche
im Alpenvorland. und Flüsse ab.
NAHRUNG
Jeder Feuer-
salamander
Erwachsene Salamander ernähren sich weitgehend hat eine indivi
duelle Farb-
von wirbellosen Organismen wie Asseln, kleinen wei- zeichnung,
Foto: Torsten Bittner
deren Farb-
chen Käfern sowie Wegschnecken. Daneben stehen intensität auch
auch Regenwürmer, Spinnen und Insekten auf dem von der Umge
bung beein
Speiseplan. Die im Wasser lebenden Salamanderlar- flusst wird.
ven verlassen im Dunkeln ihr Versteck und machen
Jagd auf Insektenlarven, Bachflohkrebse, Wasseras-
seln und Würmer.
Larve des
Foto: André Chatroux/Luna04, FreeArt Licence 1.3, https://commons.wikimedia.org
Feuer
salamanders
Foto: Torsten Bittner
© LUBW Vitale Gewässer in Baden-Württemberg 73 Die schimmernde Schönheit
Blauflügel-Prachtlibelle (Calopteryx virgo)
Fotos: Kurzach im Landkreis Ludwigsburg, Jürgen Gerhardt; Blauflügel-Prachtlibelle, Torsten Bittner, und TessarTheTegu, shutterstock.com
Der ideale Lebensraum
für die Blauflügel-Prachtlibelle
Während viele Libellenarten an
D as Männchen der Blauflügel-Prachtlibelle ist
leicht an der metallisch blauen Farbe und den
flächig blau gefärbten Flügeln zu erkennen. Das Weib-
Stillgewässern leben, bevorzugt die
Blauflügel-Prachtlibelle nährstoff chen trägt eine unscheinbarere bronzene bis kupferne
arme, kalte Fließgewässer. Ein hoher
Sauerstoffgehalt des Wassers ist dabei Färbung. Die Blauflügel-Prachtlibelle ist auf kalte,
für die Larven überlebenswichtig, denn
warmes und sauerstoffarmes Wasser sauerstoffreiche Bäche und Flüsse angewiesen. Dank
kann die Libellenlarven schädigen. Die
Larven der Blauflügel-Prachtlibelle leben ein oder der Verbesserung der Wasserqualität hat sich ihr Be-
zwei Jahre am Gewässergrund und halten sich
dabei überwiegend zwischen Wasserpflanzen
stand in Baden-Württemberg deutlich erholt. Inzwi-
und Wurzeln auf. Darüber hinaus werden schen zählt sie nicht mehr zu den gefährdeten Arten.
auchTreibgut, Totholz, Steine und unterspülte
Ufer von den Larven besiedelt.
Die Blauflügel-Prachtlibelle hat ein außergewöhnli-
ches Paarungsverhalten. Die Männchen erobern und
verteidigen Reviere, die sich gut zur Eiablage eignen.
Erreicht ein Weibchen die Reviergrenze, fliegt ihm
das Männchen in einem Schwirrflug entgegen, wobei
8 Vitale Gewässer in Baden-Württemberg © LUBWes die rötliche Unterseite seiner letzten drei Hinter- NAHRUNG
leibsegmente („Laterne“) präsentiert. Die Flügel des
Männchens bewegen sich dabei so schnell, dass man Wie alle Libellenlarven leben auch die Larven der
nur einen breiten blauen Streifen sieht. Schwirrend Blauflügel-Prachtlibelle räuberisch. Sie ernähren sich
zeigt das Männchen dem Weibchen geeignete Ei von Insektenlarven wie denen der Kriebel- und Zuck-
ablageplätze auf. Ist das Weibchen überzeugt, zeigt es mücke, Stein- und Eintagsfliege sowie von Flohkreb-
kein Abwehrverhalten mehr, sondern bleibt ruhig sen. Sie verteidigen ihren Sitzplatz gegenüber anderen
sitzen, sodass die Paarung beginnen kann. Nach der Libellenlarven, vor allem vor denen der eigenen Art.
Paarung macht sich das Weibchen an die Eiablage.
Dazu fliegt es über geeignete Wasserpflanzen im Re- GEFÄHRDUNG UND SCHUTZ
vier und sticht seine Eier im Bereich des Wasserspie-
gels und darunter in den Stängel der Pflanze. Das Vor allem die Larven der Blauflügel-Prachtlibelle lei-
Weibchen klettert dabei auch kopfabwärts am Stängel den unter Verschmutzung, Verbauung und fehlender
hinab und kann – dank einer Luftblasenhülle – bis zu Beschattung von Gewässern. In Baden-Württemberg
einer Stunde unter Wasser bleiben. Während der Ei- hat sich der Bestand der Blauflügel-Prachtlibelle
ablage wird das Weibchen vom Männchen b eobachtet aufgrund der verbesserten Gewässerqualität in den
und gegen andere Männchen verteidigt. Die aus den letzten Jahren gut erholt. Eine Verminderung der
Eiern geschlüpften Larven leben ein oder zwei Jahre Nährstoffbelastung und der Erhalt bzw. die Wieder-
im Gewässer und häuten sich in dieser Zeit zehn herstellung von vitalen Fließgewässerabschnitten mit
bis zwölf Mal, bis sie rund 23 Millimeter groß sind. abschnittsweiser Uferbepflanzung sind wirksame Maß-
Danach beginnen sie ihr Leben als ausgewachsene nahmen zum Erhalt dieser Art.
Libelle oberhalb der Wasseroberfläche.
Detailauf
nahme des
VERBREITUNGSGEBIET Kopfes der
Foto: Maciej Olszewski, shutterstock.com
Blauflügel-
Prachtlibelle
Die Blauflügel-Prachtlibelle findet man bis in Höhen
von 900 Meter überall dort, wo sauerstoffreiches Was-
ser und eine entsprechende Gewässervegetation vor-
handen sind.
Larve der
Blauflügel-
Prachtlibelle
Foto: Robert Mertl, shutterstock.com
Foto: Calopteryx virgo 19, Bosbeekjuffer, larva, Saxifraga-Frits Bink, www.saxifraga.nl
Ein Männchen
und ein Weibchen
der Blauflügel-
Prachtlibelle bei
der Paarung
© LUBW Vitale Gewässer in Baden-Württemberg 94 Der begnadete Baumeister
Europäischer Biber (Castor fiber)
Fotos: Lippach im Landkreis Tuttlingen, Jürgen Gerhardt; Biber, Podolnaya Elena, shutterstock.com
D er Biber hat die Fähigkeit, als „geborener Was-
serbaumeister“ seinen Lebensraum nach seinen
Bedürfnissen zu gestalten. Durch seine Dammbau-
Der ideale Lebensraum werke formt er sich und auch vielen Pflanzen und
für den Europäischen Biber
anderen Tieren einen geeigneten Lebensraum aus
Der Biber bevorzugt langsam fließende und
stehende Gewässer mit einem guten Angebot Bach- und Seenlandschaft. Der Biber ist der größte
an Weichholzarten, wie zum Beispiel Weiden heimische Nager und unverkennbar durch seinen
und Pappeln in Ufernähe. Wo diese nicht
mehr vorhanden sind, zeigt sich der Biber aber Schwanz, die Biberkelle. Er ist ein Säugetier und kann
sehr anpassungsfähig und siedelt sich auch
an anderen Gewässern an. in Gefangenschaft bis zu 20 Jahre alt sowie bis zu
30 Kilogramm schwer werden. Nach dem Bundesnatur
schutzgesetz ist der Biber eine streng geschützte Art.
Der Körper des Bibers ist perfekt an seine Lebensweise
im Wasser angepasst. So besitzt er Schwimmhäute an
den Hinterpfoten. Beim Tauchen kann er Nase und
10 Vitale Gewässer in Baden-Württemberg © LUBWOhren wasserdicht verschließen und seine Augen nagen die Tiere die Rinde der Bäume ab. Zweige
durch ein zusätzliches durchsichtiges Augenlid schüt- und Äste dienen darüber hinaus als Baumaterial für
zen. 23.000 Fellhaare pro Quadratzentimeter erzeugen Dämme und für die Biberburg.
eine wärmeisolierende Luftschicht, die gleichzeitig
beim Schwimmen Auftrieb verleiht. Der breite, schup- GEFÄHRDUNG UND SCHUTZ
pige Schwanz des Bibers ist ein ideales Steuerruder.
Bei Gefahr warnt er damit auch seine Artgenossen, Der Europäische Biber steht auf der Vornwarnliste der
indem er ihn klatschend auf das Wasser schlägt. Roten Liste der gefährdeten Säugetiere in Deutschland
und ist über die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie eine in
Biber leben monogam und können im Jahr ein bis Europa streng geschützte Art.
vier Junge zur Welt bringen. In der Regel besteht eine
Biberfamilie aus den Elterntieren und den letzten bei- Der Biber ist vor allem durch die Zerstörung seines
den Jungtieren. Als Rückzugsort dient ihr ein Wohn- Lebensraumes, etwa durch den Gewässerausbau und
bau, der Ergebnis einer umfangreichen Bautätigkeit die Fragmentierung der Landschaft, sowie durch den
ist. Solche Biberbauten bestehen aus Wohnbauten Verkehrstod auf Straßen und Bahngleisen gefährdet.
und Dämmen, die aus losen Ästen, Zweigen, Steinen,
Schlamm und durch den Biber gefällte B äume errich- Die Ansprüche des Bibers an sein Habitat kollidieren
tet werden. Als Wohnbau gräbt der Biber entweder oftmals mit gewässernahen Nutzungen von Men-
ein Höhlensystem in Uferböschungen oder er schich- schen. Konflikte sind daher vorprogrammiert und es
tet Äste, Zweige und anderes Baumaterial zu einer müssen Kompromisse für ein Miteinander erarbeitet
Biberburg aufeinander, in deren Innerem sich ein werden. Da die meisten Biberaktivitäten in einem
Wohnkessel befindet und die vollständig von Wasser schmalen Streifen beiderseits des Gewässers stattfin-
umgeben ist. Der Zugang zu den Wohnbauten liegt den, kann bereits ein zehn Meter breiter gewässer
zum Schutz vor Eindringlingen immer unter der typischer Gewässerrandstreifen vielfach helfen, das
Wasseroberfläche; der Wohnraum selbst befindet sich Gefährdungspotenzial zu vermeiden.
über der Wasseroberfläche.
VERBREITUNGSGEBIET
Aufgrund von Schutzmaßnahmen und der natürlichen
Ausbreitung leben aktuell wieder mehrere tausend Auch das
Fällen dicker
Biber in Baden-Württemberg. Es ist zu erwarten, dass Bäume stellt
für den Biber
der Biber bald wieder flächendeckend an den Bächen mit seinen
und Flüssen des Landes vorkommt. eisenoxid
Foto: Procy, shutterstock.com
haltigen Nage-
zähnen kein
Problem dar.
NAHRUNG
Als reiner Pflanzenfresser besteht die bevorzugte
Nahrung des Bibers aus weichem Ufergehölz, Gräsern Schwimm
häute an den
und krautigen Pflanzen. Sofern gewässernah, werden Hinterpfoten
und ein
Foto: Podolnaya Elena, shutterstock.com
auch Nutzpflanzen wie Mais und Zuckerrüben oder abgeflachter
Obstbäume nicht verschmäht. Mit ihren durch eine Schwanz
machen den
eisenoxidhaltige Schmelzschicht geschützten Nage- Biber zu
einem perfek-
zähnen können Biber auch dickere Bäume fällen, um ten Schwim
mer.
an junge Triebe und Knospen zu kommen. Im Win-
ter, wenn keine Knospen und Triebe zu finden sind,
© LUBW Vitale Gewässer in Baden-Württemberg 115 Die wandernde Riesin
Seeforelle (Salmo trutta)
Fotos: Rotach im Bodenseekreis , Jürgen Gerhardt; Seeforelle, Peter Rey, Büro Hydra
Der ideale Lebensraum
D ie Seeforelle bewohnt größere Seen und wan-
dert zum Laichen in die Zuflüsse bis in die
Oberläufe auf. In der Regel bevorzugt sie dabei das
für die Seeforelle
Gewässer, in dem sie selbst aufgewachsen ist.
Der Bodensee ist in Baden-Württemberg
der Lebensraum der Seeforelle. Von hier aus
wandert sie zu ihren Laichgebieten in die Ihre Laichgrube legt sie auf sauberen, überströmten
Zuflüsse des Sees. Saubere, überströmte, gut
mit Sauerstoff versorgte Kiessubstrate sind und gut mit Sauerstoff versorgten Kiessubstraten an.
ideale Gewässerabschnitte zum Laichen.
Diese können von den Seeforellen allerdings Im Bodensee und seinen Zuflüssen ist sie heimisch.
nur erreicht werden, wenn die Durchgängigkeit
der Gewässer gewährleistet ist. Um den Bestand zu sichern, sind durchgängige Laich
gewässer Grundvoraussetzung.
Die Seeforelle ist die größte Forellenart in Deutsch-
land. Sie kann über einen Meter lang werden und
15 Kilogramm wiegen. Sie hat einen langestreckten,
seitlich leicht abgeflachten Körper. Die meist sehr
12 Vitale Gewässer in Baden-Württemberg © LUBWhellen Flanken sind mit unregelmäßigen schwärz NAHRUNG
lichen, gelegentlich auch braunen oder rötlichen
Punkten oder Ringen gemustert. Bei der Seeforelle Seeforellen ernähren sich überwiegend von Kleintie-
handelt es sich im zoologischen Sinn nicht um eine ren, größere Seeforellen auch von kleineren Fischen
eigenständige Art, sondern um eine großwüchsige, und Krebstieren.
weit wandernde Bachforelle.
GEFÄHRDUNG UND SCHUTZ
Seeforellen nutzen dieselben Laichgewässer wie die
Bachforellen. Die Jungfische verbleiben zunächst Aufgrund ihrer Laichwanderungen ist die fortpflan-
im Geburtsgewässer und wandern meist im zweiten zungswillige Seeforelle auf durchwanderbare Bäche
Lebensjahr in den Bodensee ab, um dort binnen
und Flüsse angewiesen. In der Vergangenheit wurden
weniger Jahre zu stattlichen Seeforellen heranzu
zahlreiche Laichgewässer wieder zugänglich gestaltet.
wachsen. Nach wie vor verhindert jedoch eine hohe Anzahl
an Querbauwerken ein erfolgreiches Einwandern in
VERBREITUNGSGEBIET geeignete Laichhabitate. Die Durchgängigkeit der
Gewässer für den zügigen Auf- und Abstieg hat für
Die wichtigsten baden-württembergischen Laichge- die Seeforelle daher höchste Priorität. Nur so können
wässer der Seeforelle sind die Argen, die Schussen, zusammen mit Artenschutzmaßnahmen, wie zum Bei-
die Rotach, die Seefelder Aach und die Stockacher spiel der gezielte Besatz mit erbrüteten Jungfischen,
Aach sowie ihre Zuflüsse. die Seeforellenbestände dauerhaft gesichert werden.
Junge
Bachforelle
über Kies
substrat
Foto: Angel L, shutterstock.com
Bis zu 15 Kilo
gramm
schwer kann
Foto: Rostislav Stefanek, shutterstock.com
eine See
forelle werden.
Die Seeforelle
ist keine
eigenständige
Art, sondern
eine sehr
große Bach
forelle.
Foto: Peter Rey, Büro Hydra
© LUBW Vitale Gewässer in Baden-Württemberg 136 Die anspruchsvolle Schmarotzerin
Bachmuschel (Unio crassus)
Fotos: Schwarzbach im Landkreis Waldshut, Jürgen Gerhardt; Bachmuschel, Michael Pfeiffer
Der ideale Lebensraum
D ie Bachmuschel ist zur Fortpflanzung auf Wirts-
fische angewiesen. Die durch die weiblichen
Muscheln ins Wasser ausgestoßenen Larven nisten
für die Bachmuschel
sich in den Kiemen einiger Fischarten ein und schma-
Die Bachmuschel benötigt als Lebensraum
saubere, sauerstoffreiche Bäche und kleine rotzen dort. Nach der Entwicklung zur Jungmuschel
Flüsse. Um sich in der Gewässersohle eingraben leben sie in sandigem bis feinkiesigem Substrat in sau-
zu können, ist die Bachmuschel zudem auf
lockeres Substrat und als Filtriererin auf beren, sauerstoffreichen Fließgewässern. Sie gehören
fließendes Wasser angewiesen. Darüber hinaus
setzt eine erfolgreiche Fortpflanzung der zu den streng geschützten FFH-Arten.
Bachmuschel einen ausreichenden Bestand an
Wirtsfischen voraus. Deshalb muss das
Gewässer auch diesen ausgewählten Fischarten
ideale Lebensbedingen bieten. Dazu zählen
Die Bachmuschel gehört zu den Weichtieren und hat
zum Beispiel ein entsprechender Struktur eine Lebenserwartung von bis zu 30 Jahren. Wie alle
reichtum, Durchgängigkeit des Bachlaufs und
ein Kieslückensystem für die Laichablage. Muscheln besitzt sie eine Schale mit zwei Klappen
und einem kräftigen Schließmuskel. Die Schale kann
bis zu zehn Zentimeter lang sein. Die Kiemen dienen
der Atmung und der Aufnahme von Schwebstoffen im
14 Vitale Gewässer in Baden-Württemberg © LUBWWasser. Der kräftige Fuß der Bachmuschel dient GEFÄHRDUNG UND SCHUTZ
zur Fortbewegung und zum Eingraben. Bachmuscheln
sind getrenntgeschlechtlich. Zur Fortpflanzung gibt Die Belastung der Gewässer mit Nährstoffen und
die männliche Bachmuschel Samen ins freie Wasser Feinsedimenten wird als wichtigste Ursache für den
ab, die die weibliche einstrudelt. Die Spermien gelan- Rückgang der Bachmuschel angesehen. Diese ver
gen über das Atemwasser des Weibchens zu den ein- stopfen das Lückensystem der Gewässersohle und
gelagerten Eiern und befruchten diese. Die sich aus schaden damit nicht nur der Bachmuschel direkt, son-
den Eiern entwickelnden Muschellarven werden von dern auch ihren Wirtsfischen, die unter einem Mangel
den Muttertieren ins Wasser abgestoßen. Die Larven geeigneter Laichplätze leiden. Bachmuscheln sind aber
haben nun maximal drei Tage, um sich an einen Wirts- auch auf eine naturschonende Gewässerunterhaltung
fisch anzuheften, sonst sterben sie ab. Am Wirtsfisch angewiesen, um eine Störung ihrer Lebensräume und
ernähren sich die Larven parasitär an dessen Kiemen. direkte Schädigung der Tiere durch Entnahme aus
Bekannte Wirtsfischarten sind Döbel, Flussbarsch, dem Gewässer zu vermeiden. Weitere Informationen
Elritze, Rotfeder, Kaulbarsch, dreistachliger Stich-
findet man im LUBW-Artensteckbrief „Bachmuschel“.
ling und Groppe. Nur ein sehr geringer Anteil der
Muschellarven findet rechtzeitig einen Wirt. Dies
schränkt den Fortpflanzungserfolg der Bachmuschel
zwar ein, bietet der Art aber den Vorteil, sich über
Unter idealen
die Fische im Gewässer gut verbreiten zu können. Lebens
bedingungen
Der Bitterling ist die einzige Fischart, die den Spieß können Bach-
umdreht und ihre Eier zum Schutz vor Fressfeinden in muscheln bis
zu 30 Jahre alt
Großmuscheln ablegt. Die Muscheln werden dabei werden.
nicht beschädigt.
VERBREITUNGSGEBIET
Foto: Jiri Prochazka, shutterstock.com
Die verbleibenden Vorkommen der Bachmuschel in
Baden-Württemberg konzentrieren sich auf die mitt- Kiemen
lere Oberrheinebene, die Einzugsgebiete von Jagst öffnung einer
eingegrabenen
und Kocher sowie Teile von Oberschwaben. Bachmuschel
NAHRUNG
Bachmuscheln filtrieren Plankton, Bakterien, Kiesel-
algen und organische Schwebstoffe aus dem Gewäs-
ser. Auf diese Weise reinigt ein erwachsenes Tier bis
zu vier Liter Wasser pro Stunde.
Foto: Kuttelvaserova Stuchelova, shutterstock.com
Der Döbel –
Foto: Michael Pfeiffer
ein typischer
Wirtsfisch für
die Fortpflan
zung der
Bachmuschel
© LUBW Vitale Gewässer in Baden-Württemberg 157 Die Fischerin der Nacht
Wasserfledermaus (Myotis daubentonii)
Fotos: Neckarwasen im Landkreis Esslingen, Jürgen Gerhardt; Wasserfledermaus, Dietmar Nill
Der ideale Lebensraum
D ie Wasserfledermaus verdankt ihren Namen
ihrem Jagdrevier. Deshalb wird sie auch als
Fischerin unter den Fledermäusen bezeichnet. Sobald
für die Wasserfledermaus
es dämmert, zieht sie im Tiefflug ihre Bahnen über
Die Wasserfledermaus jagt im Tiefflug über
langsam fließende Flüsse und Bäche sowie über der Wasseroberfläche von ruhigen Gewässern. Dort
Stillgewässer. Im Sommer schläft sie während findet sie einen reich gedeckten Tisch mit wirbellosen
des Tages in Baumhöhlen, Stammrissen,
Fledermauskästen oder in Spalten von Brücken Beutetieren. Sie gehört zu den besonders und streng
in Gewässernähe. Als Winterquartiere dienen
Höhlen, Bunker, Stollen, Brunnen sowie geschützten Arten.
Felsspalten. Dort verschläft sie etwa die Hälfte
des Jahres.
Die Wasserfledermaus gehört zur Familie der Glatt
nasen. Sie hat kurze Ohren mit einem für Myotis-
Arten ungewöhnlich kurzen, abgerundeten Ohrdeckel
(Tragus) sowie auffallend große Füße. Ihr Rückenfell
ist mittel- bis dunkelgraubraun und ihr Bauchfell
grauweißlich getönt.
16 Vitale Gewässer in Baden-Württemberg © LUBWDie Paarung erfolgt während der Winterschlafphase. GEFÄHRDUNG UND SCHUTZ
Vor der Begattung wecken die Männchen die Weib-
chen mit Bissen ins Genick auf. Ein Balzen um die Fledermäuse haben zwar kaum natürliche Feinde,
Weibchen ist nicht vonnöten, da diese in der Auf- aber sie kämpfen mit den negativen Folgen einer in-
wachphase noch geschwächt sind. Nach dem Paa- tensiven Land- und Forstwirtschaft. Die Belastung der
rungsakt setzen beide Geschlechter den Winterschlaf Landschaft mit Pestiziden führt zu einem Rückgang
fort. Im Mai finden sich dann die trächtigen Weibchen der Insekten und damit der Nahrungsgrundlage der
zu Kolonien zusammen – den sogenannten Wochen- Fledermäuse. Zusätzlich wurden und werden viele
stuben, wo sie in Baumhöhlen nur ein einziges Junges Fledermausquartiere, vor allem alte Bäume mit Höh-
zur Welt bringen. len und Spalten an Gewässern, im Zuge von Gewäs-
serausbau und -unterhaltung durch Gehölzpflege und
VERBREITUNGSGEBIET Rodungsarbeiten zerstört.
Die Wasserfledermaus lebt in ganz Baden-Württem- Die Fledermaus-Bestände sind in den letzten 50 Jah-
berg überall dort, wo ein geeignetes Lebensraumange- ren dramatisch zurückgegangen. Wie alle 21 in Baden-
bot besteht. Württemberg heimischen Fledermausarten steht auch
die Wasserfledermaus auf der Roten Liste sowie auf
NAHRUNG der FFH-Artenliste und ist nach dem Bundesnatur-
schutzgesetz besonders und streng geschützt.
Während der Sommernächte lassen sich Wasserfleder-
mäuse an ruhigen Gewässern beim Jagen von Insek-
ten beobachten. Mücken, Fliegen oder kleine Falter
kann die Wasserfledermaus direkt von der Wasser-
oberfläche mit dem Mund wegfangen. Oft nutzt sie
aber ihre großen Füße oder die Schwanzflughaut
als Kescher. Eine Pause gönnt sie sich nach einem
erfolgreichen Beutefang nicht: Noch im Flug wird die
Beute verspeist und wenige Sekunden später schon
der nächste Fang eingeleitet. Beobachtungen ergaben,
dass eine Wasserfledermaus durchschnittlich alle vier
Sekunden einem Insekt nachjagt. Dies bedeutet mehr
als 2.000 erbeutete Insekten pro Nacht.
Foto: Dietmar Nill
Wasserfleder
maus bei der
Jagd
Kopf der
Foto: D. Kucharski K. Kucharska, shutterstock.com
Foto: D. Kucharski K. Kucharska, shutterstock.com
Wasserfleder
maus
Flügeldetail
© LUBW Vitale Gewässer in Baden-Württemberg 178 Der Ritter mit den Scherenhänden
Steinkrebs (Austropotamobius torrentium)
Fotos: Nüstenbach im Neckar-Odenwald-Kreis, Jürgen Gerhardt; Steinkrebs, Nenad Djordjevic, shutterstock.com
D er Steinkrebs gehört neben seinen beiden engen
Verwandten, dem Dohlenkrebs (Austropotamo
bius pallipes) und dem Edelkrebs (Astacus astacus) zu den
Der ideale Lebensraum mitteleuropäischen Flusskrebsarten. Mit einer maxi-
für den Steinkrebs
malen Körperlänge von acht Zentimeter ist er der
Kleine, kalte Bäche, die
auf kleinstem Raum kleinste heimische Flusskrebs. Sein Bestand ist – wie
verschiedene naturnahe der seiner beiden Verwandten – stark gefährdet. Da-
Strukturen bieten, sind das
Habitat des Steinkrebses. Damit sich dieser her sind alle heimischen Flusskrebse streng geschützt.
wohlfühlt, sind eine gute bis sehr gute Wasser
qualität und – um das Eindringen fremder Krebs-
arten zu verhindern – ein möglichst isolierter
Bachoberlauf Voraussetzung. Idealerweise Der dornenlose, glatte Körper des Steinkrebses ist
bedeckt ein steiniges Substrat das Bachbett.
Tagsüber verkriecht sich der nachtaktive Stein
meist beige-grau bis olivgrün-braun marmoriert. Auch
krebs in Höhlen, die er ins Ufer gräbt, un blaue Exemplare kommen vor. Im Gegensatz zum
ter Steinblöcken oder zwischen Baumwurzeln.
Edelkrebs besitzt er nur eine statt zwei Augenleisten,
das Rostrum ist auffallend stumpf. Die Steinkrebs-
Männchen sind mit kräftigeren Scheren ausgestat-
18 Vitale Gewässer in Baden-Württemberg © LUBWtet als die Weibchen. Die Unterseite der Scheren ist dem übertragen die nordamerikanischen Arten den
immer hell gefärbt. Um wachsen zu können, muss sich pilzähnlichen Krebspesterreger (Aphanomyces astaci).
der Steinkrebs regelmäßig seines Panzers entledigen Dieser führt bei heimischen Krebsarten nach ein bis
und häuten. Während der Edelkrebs in Seen, Wei- zwei Wochen ausnahmslos zum Tod und kann in kür-
hern und größeren Bächen oder Flüssen anzutreffen zester Zeit ganze Populationen auslöschen. Das Aus-
ist, findet man den Stein- und den Dohlenkrebs in setzen nicht heimischer Flusskrebse in unsere Gewäs-
kleineren Fließgewässern. ser ist daher unbedingt zu vermeiden. Darüber hinaus
können Wanderbarrieren verhindern, dass exotische
VERBREITUNGSGEBIET Krebsarten die Lebensräume heimischer Flusskrebs-
arten erreichen können.
Baden-Württemberg ist das einzige Bundesland, in
dem alle drei mitteleuropäischen Flusskrebsarten In Baden-Württemberg sind der Edel- und der Stein-
anzutreffen sind. Die Verunreinigung und der natur- krebs stark gefährdet, der Dohlenkrebs gilt als vom
ferne Ausbau zahlreicher Gewässer haben die ehe- Aussterben bedroht. Edel- und Steinkrebs sind nach
mals flächendeckend vorkommenden heimischen der Bundesartenschutzverordnung streng beziehungs-
Flusskrebse massiv dezimiert. Die Restvorkommen weise besonders geschützt und gehören zu den FFH-
des Steinkrebses beschränken sich auf kleine, oft iso- Arten (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie).
lierte Gewässeroberläufe.
NAHRUNG Ein Steinkrebs
kriecht aus
seinem
Der Steinkrebs ernährt sich von pflanzlichem Mate Versteck.
rial, Wasserinsekten, kleinen Mollusken und von Aas.
GEFÄHRDUNG UND SCHUTZ
Ein blaues
Die Einschleppung und Ausbreitung vieler nicht hei-
Foto: Christoph Chucholl
Exemplar des
in der Regel
mischer Flusskrebsarten – wie zum Beispiel der Gali- beige-grau bis
zierkrebs (Pontastacus Ieptodactylus), der Kamberkrebs olivgrün-braun
marmorierten
(Faxonius limosus), der Signalkrebs (Pacifastacus leniuscu Steinkrebses
lus) oder der Kalikokrebs (Faxonius immunis) – gefähr-
den massiv die heimischen Flusskrebse. Vor allem der
Signalkrebs verdrängt aufgrund seines aggressiven
Verhaltens, seiner schnelleren Vermehrung und seiner
überlegenen Größe die heimischen Flusskrebse. Zu-
Foto: Christoph Chucholl
Foto: Christoph Chucholl
Eier an der
Schwanz
unterseite
eines Stein
krebs-Weib
chens
© LUBW Vitale Gewässer in Baden-Württemberg 199 Der kiesliebende Charaktervogel
Flussregenpfeifer (Charadrius dubius)
Fotos: Murg im Landkreis Rastatt, Jürgen Gerhardt; Flussregenpfeifer, aaltair, shutterstock.com
Der ideale Lebensraum
für den Flussregenpfeifer
D er Flussregenpfeifer ist der Charaktervogel ur-
sprünglicher dynamischer Flusslandschaften. Er
ist der kleinste bei uns brütende Watvogel. Im Früh-
Vor allem nach der
Schneeschmelze jahr, nach seiner Rückkehr aus den warmen Gefilden,
und nach Hoch sucht er vom Hochwasser frisch angelegte flache Kies-
wasser formen wilde, dynamische, unverbaute
Flüsse und Bäche immer wieder neue unbe bänke und Schotterinseln auf. Dort brütet er und
wachsene Kiesbänke oder Rohböden, die
der Flussregenpfeifer als eine der ersten Arten tarnt seine Eier, die er ohne Nest auf den Boden legt.
besiedelt. Flache Mulden in den Kies- und
Schotterinseln nutzt er zur Ablage der Eier, Die Brutflächen sind in Baden-Württemberg nur noch
die perfekt der Umgebung angepasst sind. Ein
seichter, schlammiger Uferbereich mit zahl
selten vorhanden. Er gehört zu den streng geschützten
reichen Würmern, Insekten und Mollusken dient Arten.
ihm als Nahrungsquelle.
Im Frühjahr, nach der Rückkehr von der langen Reise
aus den Winterquartieren in Afrika, baut sich der
Flussregenpfeifer sein Nest in Windeseile. Eine flache
Mulde im Kies, allenfalls „ausgepolstert“ mit einigen
20 Vitale Gewässer in Baden-Württemberg © LUBWKieselsteinchen, reicht für das Gelege. Ein brütender GEFÄHRDUNG UND SCHUTZ
Flussregenpfeifer ist aufgrund seines Gefieders, eben-
so seine wie Kieselsteine gefärbten Eier, auf einer Durch naturfernen Ausbau, Aufstau oder Schiffbar
Kiesbank für seine Feinde kaum auszumachen. Nähert machung der Flüsse ging deren natürliche Dynamik
sich dennoch ein Nesträuber, beispielsweise ein Fuchs verloren. Bestehende Kiesbänke verschwanden oder
oder Marder, dann gibt der Flussregenpfeifer seine wurden mit der Zeit von der Vegetation überwuchert.
Tarnung auf und läuft vom Nest weg. Damit zieht er Neue unbewachsene Kiesbänke oder Schotterinseln
die Aufmerksamkeit des Räubers auf sich. Gelingt das konnten nicht entstehen. Der natürliche Lebensraum
nicht, ruft er laut und mimt den flügellahmen, schwer des Flussregenpfeifers ging mehr und mehr verloren.
verletzten Vogel. Der Nesträuber wittert leichte Beute Allein seine Fähigkeit, auf Ersatzlebensräume – etwa
und stürzt sich auf den vermeintlich einfach zu fan- Kiesabbaugebiete an Baggerseen oder große Baustel-
genden Vogel, der jedoch auffliegt und sicher ent- len – auszuweichen, bewahrte den Flussregenpfeifer
kommt. Da die Kiesbank beim nächsten Hochwasser vor dem Aussterben. Langfristig profitiert die Art
wieder überschwemmt wird, verlässt das Küken nach allerdings nur von einer Wiederherstellung der natür-
dem Ausschlüpfen schnell seine Brutstelle. lichen Flussdynamik.
VERBREITUNGSGEBIET Flussregenpfeifer sind an ständig wechselnde Flussland-
schaften gewöhnt. Daher gehören sie meist zu den ers-
Das Vorkommen des Flussregenpfeifers variiert regio- ten Arten, die revitalisierte Flussabschnitte mit neuen
nal recht stark, da die aufgesuchten Pionierstandorte Kiesbänken wieder besiedeln.
oft nur kurzzeitig zur Brut geeignet sind. In Baden-
Württemberg brüten ca. 250 Flussregenpfeiferpaare,
davon mehr als die Hälfte in der Oberrheinebene. Flussregen
pfeiferpärchen
Dort besiedelt er oft Ersatzbiotope in Kiesgruben und bei der Balz
auf Deponien.
Foto: Erni, shutterstock.com
NAHRUNG
Die Flussregenpfeifer sind meist zu Fuß am Ufer
des Flusses unterwegs und ernähren sich dort von
Insekten, Spinnen, Würmern, Mollusken und kleinen
Krebstieren. Diese suchen sie dicht unter der Boden-
oberfläche im Uferschlamm.
Flussregen
pfeiferküken
Perfekt der
Umgebung
angepasst:
Foto: francesco de marco, shutterstock.com
das Gelege
des Fluss
regenpfeifers
Foto: FJAH, shutterstock.com
© LUBW Vitale Gewässer in Baden-Württemberg 2110 Die flottierende Filigrane
Zierliche Tellerschnecke (Anisus vorticulus)
Fotos: Rheinauen im Landkreis Rastatt, Jürgen Gerhardt; Zierliche Tellerschnecke, Ira Richling
D ie Zierliche Tellerschnecke lebt im Wasser. Sie
hat im Gegensatz zu anderen Wasserschnecken
jedoch keine Kiemen. Um Luft zu holen, kommt die
Tellerschnecke daher in regelmäßigen Abständen an
Der ideale Lebensraum die Wasseroberfläche. Sie lebt zwischen dichten Was-
für die Zierliche Tellerschnecke
serpflanzenbeständen in der Verlandungszone vegeta-
Die Zierliche Tellerschnecke liebt klares, kalk-
haltiges und basenreiches Wasser, das reich an tionsreicher Stillgewässer sowie in langsam fließenden
Sauerstoff und relativ arm an Nährstoffen ist. Wiesengräben. Die zierliche Tellerschnecke gehört zu
Darüber hinaus ist ein üppiger Bewuchs
mit Wasserpflanzen Voraussetzung für eine den besonders und streng geschützten Arten.
Besiedelung des Gewässers durch die Zierliche
Tellerschnecke. Bevorzugte Habitate sind
Stillgewässer, langsam fließende Wiesengräben,
die im Regelfall unter Grundwassereinfluss Die Zierliche Tellerschnecke zählt zu den kleinsten
stehen,und dynamische Auen. Süßwasserschnecken Mitteleuropas. Sie besitzt ein
scheibenförmiges Gehäuse, das einen Durchmesser
von fünf bis sechs Milllimeter und eine Höhe von
0,8 Millimeter erreichen kann. Es weist fünf Umgänge
22 Vitale Gewässer in Baden-Württemberg © LUBWauf, die sowohl auf der Ober- als auch auf der Unter- NAHRUNG
seite konvex gewölbt sind. Das Gehäuse ist dünnwan-
dig und glänzend bräunlich oder gelblich gefärbt. Die Während des Flottierens können die Tiere nicht nur
Zierliche Tellerschnecke ist zwittrig mit der Fähigkeit Luft holen, sondern die Wasseroberfläche auch zur
zur Selbstbefruchtung. Aber auch wechselseitige Nahrungsaufnahme nutzen. Denn an der Unterseite
Befruchtung tritt auf. Die Lebensdauer beträgt etwa der Wasseroberfläche bilden sich große Algenbestände,
ein Jahr. Tellerschnecken können an der Unterseite die die Schnecken abweiden.
der Wasseroberfläche entlangkriechen. Diese Fortbe-
wegungsweise ist durch die Oberflächenspannung des GEFÄHRDUNG UND SCHUTZ
Wassers möglich und wird „flottieren“ genannt. Um
Luft zu holen, kommt die Tellerschnecke in regel Die Zierliche Tellerschnecke gilt in Deutschland als
mäßigen Abständen an die Wasseroberfläche. Ist der vom Aussterben bedroht. Die Verfüllung oder die
Zugang zu Luftsauerstoff verwehrt – zum Beispiel Trockenlegung von Gewässern, aber auch unsach
bei zugefrorenem Gewässer – können die Tiere den gemäße Gewässerunterhaltung wie zum Beispiel das
Sauerstoff auch noch über die Haut aufnehmen. Als Entfernen der Wasservegetation bedrohen den Lebens-
Anpassung an das Leben im Wasser hat sich hierfür raum der Art. Sie ist auf eine naturschonende Gewäs-
eine besonders gut durchblutete Hautfalte nahe dem serunterhaltung angewiesen.
Gehäuserand gebildet, die als Kiemenersatz dient.
Algen – die
Aquatische Schnecken sind in ihrem Lebensraum bevorzugte
ständig wechselnden Bedingungen ausgesetzt, an die Nahrung der
Zierlichen
sich zahlreiche Arten mit den unterschiedlichsten Tellerschnecke
Strategien angepasst haben. Die Artenvielfalt der
Schnecken kann daher als Indikator für die Qualität
eines Gewässers benutzt werden.
VERBREITUNGSGEBIET
Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen befindet
sich der Verbreitungsschwerpunkt in Deutschland in
der norddeutschen Tiefebene. In Baden-Württemberg
liegen mehrere Nachweise für die Oberrheinniede-
Foto: Peter Pfeiffer, Aquatic Photography
rung (zum Beispiel Rußheimer Altrhein, Rheinauen
bei Illingen und Au am Rhein) vor. Vereinzelte Nach-
weise stammen darüber hinaus aus dem Donautal
oberhalb von Ulm und bei Langenau, Oberschwaben
und aus dem Bodenseebecken.
Bei einem
Gehäuse
durchmesser
von fünf bis
sechs Milli
meter zählt
die Zierliche
Foto: Matthias Klemm
Tellerschnecke
Foto: Ira Richling
Zierliche Teller zu den kleins
schnecken in ten Süßwas
einem Auen serschnecken
gewässer Mitteleuropas
© LUBW Vitale Gewässer in Baden-Württemberg 2311 Das lebende Fossil
Bachneunauge (Lampetra planeri)
Fotos: Wutach im Landreis Waldshut, Jürgen Gerhardt; Bachneunauge, Rostislav Stefanek, shutterstock.com
D as Bachneunauge, ein Fisch mit neun Augen?
Nein. Bachneunaugen sind biologisch betrach-
tet keine Fische. Sie gehören zu den Rundmäulern.
Der ideale Lebensraum Sieben Kiemenöffnungen, eine Nasenöffnung und ein
für das Bachneunauge
Auge – und somit neun „Augen“ in der Seitenansicht –
Bachneunaugen bevorzugen saubere, struktur
reiche Bäche und Flüsse der Mittelgebirge. gaben ihm seinen Namen. Bachneunaugen wandern im
Die Querder genannten Larven sind auf ruhig Gegensatz zu Flussneunaugen nicht in das Meer ab,
fließende Gewässerabschnitte angewiesen.
Dort leben sie verborgen im Sand und Fein sondern bleiben in der Nähe ihrer Aufwuchshabitate.
sediment der Gewässersohle – meist im Flach
wasserbereich. Erwachsene Tiere benötigen Sie gehören zu den geschützten FFH-Arten. Das blei-
rascher fließende Gewässerbereiche, die kiesige
und steinige Strecken zum Ansaugen und zur stiftdünne, wurmförmige 10 bis 20 Zentimeter lange
Fortpflanzung aufweisen. Bachneunauge ist ein lebendes Fossil, das sich seit
500 Millionen Jahren kaum verändert hat. Es g ehört
somit zu den ältesten noch lebenden Wirbeltieren
überhaupt. Es hat keine Schuppen und auch kein
gewöhnliches Maul mit einem Ober- und Unterkiefer,
24 Vitale Gewässer in Baden-Württemberg © LUBWsondern einen kreisförmigen Saugmund. Rund drei bis VERBREITUNGSGEBIET
sechs Jahre – und somit den Großteil seines Lebens –
wächst das Bachneunauge als augenlose Larve heran. Bachneunaugen waren in Baden-Württemberg ur-
Diese als Querder bezeichnete Larve lebt meist verbor- sprünglich sehr weit verbreitet. Heute sind die
gen im Feinsediment der Gewässersohle. Am Ende der Bestände lokal stark zurückgegangen.
Larvenzeit wandelt sich der Querder in einer neun-
bis zehnmonatigen Methamorphose zum erwachse- NAHRUNG
nen Tier um: Es bilden sich Augen, Geschlechtsorgane
und eine Rückenflosse aus. Der Körper des erwachse- Die Querder ernähren sich von feinsten organischen
nen Tieres ist speziell auf die Fortpflanzung ausgerich- Partikeln und Mikroorganismen, die sie aus dem Was-
tet. Abgelaicht wird zwischen April und Juni – wenn ser herausfiltern. Erwachsene Bachneunaugen nehmen
die Wassertemperatur zehn bis elf Grad Celsius erreicht keine Nahrung mehr zu sich, da sich ihr Darm in der
hat. Kleine Gruppen von sechs bis zwölf Tieren schla- Umwandlungsphase degeneriert hat.
gen dabei Laichgruben in den Untergrund, in denen
die Eier abgelegt werden. Nach der Eiablage und der GEFÄHRDUNG UND SCHUTZ
Besamung sterben die Elterntiere ab.
Die Art reagiert empfindlich auf Eingriffe in das
In Baden-Württemberg sind neben dem Bachneun Gewässersystem. Schlechte Wasserqualität führt zu
auge weitere Neunaugenarten heimisch: das Flussneun- Sauerstoffmangel im Sediment und in begradigten
auge (Lapetra fluviatilis) und das Meerneunauge (Petro und strukturarmen Gewässern fehlen die typischen
myzon marinus). Beide sind anadrom wandernde Arten. Feinsedimentstrukturen, in denen die Larven des
Bachneunauges leben. Wehre und Staustufen stellen
Das Bach unüberwindliche Hindernisse dar, die Bachneunau-
neunauge –
ein lebendes gen daran hindern, geeignete Laichsubstrate zu fin-
Fossil seit
500 Millionen den. Die Verbesserung der Gewässerqualität und der
Jahren Schutz naturnaher Gewässer haben in den letzten
Foto: Peter Rey, Büro Hydra
Jahren zu einer Erholung der Bestände der ganzjährig
unter strengem Schutz (FFH-Art) stehenden Bach-
neunaugen geführt.
Teamwork
beim Schlagen
von Laich
gruben in den
Untergrund
Foto: Clemens Ratschan
Das Rundmaul
des Bachneun
auges
Foto: Peter Rey, Büro Hydra
© LUBW Vitale Gewässer in Baden-Württemberg 2512 Die betäubende Taucherin
Wasserspitzmaus (Neomys fodiens)
Fotos: Erfa im Main-Tauber-Kreis, Büro am Fluss; Wasserspitzmaus, Erni, www.shutterstock.com
Der ideale Lebensraum
D ie Wasserspitzmaus ist für Raubzüge unter Was-
ser bestens ausgerüstet: Die Deckhaare ihres
dichten Fells sind so strukturiert, dass beim Tauchen
für die Wasserspitzmaus
Luftbläschen im Fell hängen bleiben. Die Luft umgibt
Die Wasserspitzmaus benötigt als Lebensraum
saubere, sauerstoffreiche Gewässer. Dazu die ans Wasser angepasste Spitzmaus wie eine silbrige,
zählen naturnahe Wasserläufe genauso wie wärmende Taucherglocke. Ihr Revier sind Teiche und
Teiche und Seen mitsamt den anschließenden
Ufer- und Verlandungsbereichen. Als Versteck Bäche. Dort taucht sie nach an der Sohle lebenden
nutzt die Wasserspitzmaus unverbaute Ufer
mit dichtem Bewuchs, unterspülte Bereiche und Kleinstwasserlebewesen. Die Wasserspitzmaus gehört
Baumwurzeln.
zu den besonders geschützten Arten.
Die Wasserspitzmaus ist die größte europäische Spitz-
mausart. Sie kann bis zu zehn Zentimeter lang werden
und zwischen 15 und 20 Gramm wiegen. An der
Schwanzunterseite hat sie einen Borstenkiel, der als
Ruder dient, und an den Hinterfüßen Borsten, die
26 Vitale Gewässer in Baden-Württemberg © LUBWwie Schwimmflossen den Vortrieb fördern. Wie alle VERBREITUNGSGEBIET
kleinen Säuger hat sie im Verhältnis zu ihrem Körper-
volumen eine große Körperoberfläche, über die sie Die Wasserspitzmaus findet man in Baden-Württem-
viel Wärme an die Umgebung verliert. Als Ausgleich berg an naturnahen Gewässerabschnitten wie zum
für diesen stetigen Energieverlust ist sie fast ständig Beispiel in den Auen des Oberrheins, an der Donau
auf der Jagd. oder an der Jagst und am Kocher.
Zur Aufzucht ihres Nachwuchses gräbt die Wasser- NAHRUNG
spitzmaus einen unterirdischen Bau. Mitunter richtet
sie sich in verlassenen Bauten anderer Kleinsäuger Wasserspitzmäuse tauchen auf dem Grund von
ein. Stets hat ihr Bau auch einen Ausgang zum Wasser Bächen und Teichen nach Kleinkrebsen, Insektenlar-
hin. Die Fortpflanzung findet von April bis Sep ven und anderen kleinen Wassertieren aller Art und
tember statt. Ein Weibchen wirft zwei- bis dreimal nutzen darüber hinaus zahlreiche weitere Nahrungs
im Jahr, wobei ein Wurf jeweils vier bis elf Junge um- quellen. Wasserspitzmäuse gehören zu den wenigen
fasst. giftigen Säugetieren Mitteleuropas. Ihre Beute wird
mit Gift aus unter der Zunge liegenden Giftdrüsen
Die Jungtiere wiegen bei der Geburt 0,6 Gramm. Ihre betäubt. Dabei sind sie überaus gefräßig. Sie verspei-
Augen öffnen sich nach 20 bis 24 Tagen und die sen jeden Tag etwa eine ihrem eigenen Körpergewicht
Säugezeit beträgt 38 bis 40 Tage. Wasserspitzmäuse entsprechende Menge an Nahrung.
werden im Freiland maximal etwa 18 Monate alt.
GEFÄHRDUNG UND SCHUTZ
Die etwas kleinere Sumpfspitzmaus (Neomys anomalus)
sieht der Wasserspitzmaus zum Verwechseln ähnlich. Die Wasserspitzmaus wird in Deutschland aufgrund
Allerdings ist sie nicht so streng an das Leben im Was- ihrer engen Bindung an naturnahe Gewässer in der
ser angepasst, sondern nutzt mehr sumpfige Uferbe- Roten Liste als „gefährdet“ geführt und ist nach dem
reiche. Sie wurde erst 1907 als eigene Art erkannt. Bundesnaturschutzgesetz besonders geschützt.
Wasserspitz
maus beim
Tauchengang
Die Wasser
spitzmaus
ist eine der
wenigen
giftigen Säuge-
tiere Mittel
Foto: All2014, istockphoto.com
europas.
Neugeborene
Wasserspitz
mäuse in
ihrem Nest
Foto: Rudmer Zwerver, shutterstock.com
Foto: All2014, shutterstock.com
© LUBW Vitale Gewässer in Baden-Württemberg 2713 Der fliegende Edelstein
Eisvogel (Alcedo atthis)
Fotos: Jagst, Heiko Lehmann, RP Stuttgart; Eisvogel, aaltair, shutterstock.com
D er Eisvogel ist ein seltener, aber auch unver-
wechselbarer Gewässerbewohner. Die bunte
Färbung ist für seinen Lebensraum eine gute Tarnung.
Der ideale Lebensraum Die blaue Oberseite des Eisvogels lässt ihn von oben
für den Eisvogel
mit der Wasseroberfläche verschmelzen, während ihn
Der Eisvogel bevorzugt klare,
mäßig fließende oder stehende die orangebraune Unterseite auf seiner Sitzwarte und
Gewässer mit einem ausreichen an der Bruthöhle tarnt. Der Eisvogel gehört zu den
den Bestand an kleinen Beute
fischen. Als Sitzwarte dienen ihm besonders und streng geschützten Arten.
häufig über das Wasser hängende Äste, von
denen aus er nach Beute im Wasser Ausschau
hält. Der Eisvogel brütet in Nisthöhlen, die
er in Steilufer und in erodierte Prallhänge mit Der Eisvogel wird wegen seines schillernden Gefie-
lehmig-sandigen Abbruchkanten gräbt. ders auch „Fliegender Edelstein“ genannt. In der Brut-
zeit von März bis September gräbt er Bruthöhlen in
Steilufer und zieht darin zwei, selten auch drei oder
sogar vier Bruten auf. Bei diesen sogenannten Schach-
telbruten legt das Weibchen bereits ein neues Gelege,
28 Vitale Gewässer in Baden-Württemberg © LUBWwährend das Männchen die Jungen der vorherigen ihren Jungen zu fliegen, um diese zu füttern. Dies kann
Brut noch füttert, bis sie das Nest verlassen. für die Küken tödlich enden. Kalte Winter und Hoch-
wasser während der Brutzeit führen bei Eisvögeln zu
Außerhalb der Paarungszeit leben Eisvögel als stand- einer hohen Sterblichkeitsrate. So kann die Popula
orttreue Einzelgänger. Sie bleiben meist im ihrem tionsgröße von Jahr zu Jahr stark schwanken und teil-
Revier, das einen Bach- oder Flussabschnitt von circa weise um bis zu 70 Prozent dezimiert werden. Eine
einem Kilometer umfasst. hohe Fortpflanzungsrate gleicht solche Verluste in
relativ kurzer Zeit aber wieder aus.
VERBREITUNGSGEBIET
Als FFH-Art ist der Eisvogel in Baden-Württemberg
Da der Eisvogel ganz besonders auf naturnahe Fließ- besonders streng geschützt und steht auf der Vorwarn-
gewässer angewiesen ist, findet man ihn in Baden- liste für gefährdete Arten. Da seine Beutefische auf
Württemberg vor allem an naturnahen Gewässer gute Wasserqualität angewiesen sind und er natur
abschnitten mit lehmig-sandigen Uferabbrüchen, bei- nahe Strukturen am Gewässer benötigt, ist der Eis
spielsweise an der Jagst, am Kocher, an der Enz, am vogel ein guter Indikator für vitale Gewässer und als
Neckar, an der Donau oder am Oberrhein. Schirmart für den Schutz vieler anderer Arten am und
im Wasser geeignet.
NAHRUNG
Von einem über das Wasser hängenden Ast oder
einem anderen geeigneten Sitzplatz hält der Eisvogel
Abflug von der
Ausschau nach Beute im Wasser. Hat er ein Beutetier, Bruthöhle
meist ein kleiner Fisch, entdeckt, taucht er im Sturz-
flug ins Wasser. Nach erfolgreicher Jagd wird die
Beute an einem Stein oder Ast bewusstlos geschlagen,
Foto: Daniel Dunca, shutterstock.com
bevor der Eisvogel damit zur Bruthöhle fliegt, um den
Nachwuchs zu füttern.
Eisvögel
GEFÄHRDUNG UND SCHUTZ auf einer
typischen
Sitzwarte
Der Eisvogel hat wenig natürliche Feinde. Allerdings
können einzelne Bruten durch Hauskatzen, Wiesel
und Greifvögel gefährdet werden. Störungen durch die
Anwesenheit von Menschen oder gar häufiger Trubel
in der Nähe der Brutröhre hindern Altvögel daran, zu
Foto: Joefrei, eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org
Eintauchender
Eisvogel beim
Beutefang
Foto: Marek Cech, shutterstock.com
© LUBW Vitale Gewässer in Baden-Württemberg 29Sie können auch lesen