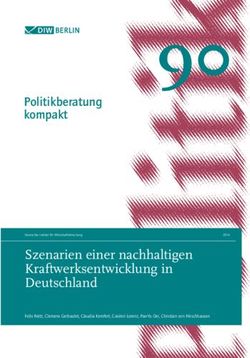Wirtschaftsbericht Japan - Juli 2020 - Switzerland Global Enterprise
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Embassy of Switzerland in Japan Wirtschaftsbericht Japan Juli 2020 Schweizer Vertretung in: Tokio Formular CH@WORLD: A754 512.0 – KFI / SJS 31.07.2020
Zusammenfassung
Das Jahr 2020 hätte zu einem Jahr Japans werden sollen.
Die ersten Olympischen Sommerspiele seit 56 Jahren wären ein Blickfang für die ganze Welt
gewesen. Vorzüglich vorbereitet, hätten sie Japan ermöglicht, sich im besten Licht zu präsentieren.
Bei den ausländischen Touristen peilte man die Marke von 40 Millionen Besuchern an. Hinsichtlich
Arbeitskräften aus dem Ausland wurde daraufgesetzt, dass das im April 2019 in Kraft getretene
Immigrationsregime zu greifen beginne.
Von all dem ist – zumindest vorläufig – kaum etwas übriggeblieben. Der grösste Sportanlass der
Welt ist auf nächstes Jahr verschoben worden, mit massiven Kostenfolgen für ein zurückgestuftes
Projekt. Von 40 Millionen Japanbesuchern blieben bisher nur diejenigen übrig, die das Land in den
ersten beiden Monaten besucht hatten. Und der Zuwanderung zum Arbeitsmarkt hat Covid-19
einstweilen ganz den Riegel geschoben.
Dabei hat Japan mit dem immer fundamentaleren Systemstreit zwischen den USA und China zu
kämpfen, seinen zwei wichtigsten Handelspartnern. Es folgte die Verbrauchssteuererhöhung vom
Oktober 2019, welche die Regierung Abe selbst zu verantworten hatte. Gerade als man mit diesen
Widrigkeiten zu leben begann, kam mit Covid-19 die dritte und grösste Erschütterung.
Um die drittgrösste Wirtschaft der Welt vor einer noch schwereren Rezession zu bewahren, haben
Parlament und Regierung massiv eingegriffen. Aktuell wird der Schuldenzuwachs auf 10 bis 13
Prozent des GDP geschätzt, die zu bereits rekordhohen 240% hinzukommen werden. Politische
Stabilität, Integrität der Institutionen und Kohäsion der Gesellschaft haben verhindert, dass sich die
Situation bisher weiter verschlimmert.
Bei der Bekämpfung von Covid-19 geht Japan dabei seinen eigenen Weg. Anders als in anderen
Staaten gründen die Massnahmen nämlich auf Empfehlungen. Dienstleistungs- und
Industrieunternehmen blieben in der Regel von Schliessungen verschont. Während grössere
Geschäfte kaum daran vorbeikamen, während der 7-wöchigen Intensivphase den Betrieb
einzustellen, blieben viele kleinere geöffnet, wie etwa Coiffeure oder Restaurants ausserhalb von
Geschäftszentren. Im Notfall bediente man sich eines «naming and shaming» von Abweichlern.
Mit Korea weist Japan die kleinste Infektions- und Sterberate unter den OECD-Staaten auf. Auch
wenn wegen geringen Testzahlen wohl zahlreiche Fälle unentdeckt bleiben, kommt beispielsweise
die Schweiz bei den Infektionen aktuell auf das 15-fache des japanischen Werts und bei den
Todesfällen nahezu auf das 30-fache.
Während dies für Zurückhaltung bei der Einreise von Touristen sprechen mag, scheint nichts die
Ablehnung von in Japan niedergelassenen Ausländern rechtfertigen zu können, die sich zum
Zeitpunkt der Suspendierung aller Visa ausserhalb Japans befanden. Für Geschäftsleute, die
beispielsweise eine Investition in Japan aufsuchen möchten, wären die strikten Einreiseverbote
ebenfalls zu lockern. Punktuelle Erleichterungen zeichnen sich ab – der Fahrplan ist jedoch unklar,
die Unsicherheit gross und der Imageschaden angerichtet.
Dabei wäre Japan auf internationalen Austausch angewiesen. Die Überalterung und der
Bevölkerungsschwund führen zu wachsenden Engpässen in zahlreichen Sektoren. Wie weit die
japanische Bevölkerung für eine verstärkte Einwanderung bereit ist, scheint aber weiterhin fraglich.
Für die Schweiz bleibt Japan ein anspruchsvoller, doch interessanter Markt. Handels- und
Investitionszahlen weisen ein deutliches Plus zugunsten der Schweiz auf. Das Engagement
schweizerischer Unternehmen auf dem japanischen Markt ist in der Regel langfristig ausgerichtet.
Was eine Revision des Freihandelsabkommens von 2009 betrifft, ein Hauptanliegen einer von
Bundesrat Parmelin angeführten Delegation von Juli 2019, dürfte eine rasche Realisierung des
Vorhabens wohl nicht gelingen.1 Wirtschaftliche Probleme und Herausforderungen 1.1 Vor COVID-19 Das Jahr 2019 schloss mit einer schwarzen Null beim realen GDP (+0.8 nominell), trotz eines stärker als erwarteten Dämpfers im letzten Quartal (-1.9%; -7.2% gegenüber dem Vorjahr). Bei der über Jahre aufgeschobenen Anhebung der Konsumsteuer von 8 auf 10 Prozent per 1. Oktober 2019 war im Unterschied zu 2014 versucht worden, mit diversen Gegenmassnahmen die Auswirkungen abzufedern. Gleichzeitig brachte die Reform zum Ausdruck, dass die Regierung von Premierminister Abe sich diese Massnahme in einem stabiler gewordenen Umfeld zutraute. Wenige Tage nach der Einführung erfasste ein ausserordentlich starker Taifun grosse Teile Japans. Es war eine weitere Erinnerung daran, wie sehr das Land verwundbar bleibt durch Erdbeben, Taifune und Tsunamis. Gemäss offiziellen Angaben haben Erdrutsche in den letzten Jahren um fast die Hälfte zugenommen. In jedem Fall hinterliessen die Steuererhöhung in Kombination mit der Naturkatastrophe deutliche Spuren in der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes. Wie meist in den letzten Jahren schien sich Japan aber bereits im folgenden Quartal wieder zu fangen. Premier Abe war dabei, die längste Wachstumsperiode (nach hiesiger Definition höchstens ein Rezessionsquartal, ergänzt um weitere Daten) weiterführen zu können. So standen die Zeichen in den ersten eineinhalb Monate zunächst auf Erholung, angetrieben von einer wieder anziehenden Konsumentenstimmung und wachsenden Investitionen. Überhaupt versprach 2020 ein besonderes Jahr zu werden. Die Olympischen Sommerspiele sollten vor allem Tokio, wo mittlerweile rund ein Drittel der japanischen Bevölkerung von 126 Millionen lebt, globale Aufmerksamkeit und zusätzliche Wirtschaftsimpulse verschaffen. Beim Fremdenverkehr, vor einem Jahrzehnt noch bei 6 Millionen Besuchern, wurden 40 Millionen angestrebt. Als eine der grossen Erfolgsgeschichten des Landes galt er auch als zumindest teilweise Antwort auf den fortschreitenden Bevölkerungsschwund in ländlichen Gebieten. Schliesslich schien auch die im April 2019 in Kraft getretene neue Ausländerregelung – Japans erstes eigentliches Immigrationsregime – nach äussert verhaltenem Start allmählich besser zu greifen. 1.2 Seit COVID-19 Dies, und manches mehr, wurde mit COVID-19 hinfällig. Die Olympischen Spiele wurden (vorerst?) auf den Sommer 2021 verschoben. Die Zahlen ausländischer Besucher brachen nach vielversprechendem Start komplett ein. Und auch anstelle von neuen ausländischen Arbeitskräften vor allem aus benachbarten südostasiatischen Staaten kam es zu einer nahezu totalen Abriegelung der Zuwanderung. Selbst Personen, die bereits über eine Niederlassung verfügten und sich zum Beispiel auf Heimaturlaub befanden, konnten bis heute nicht zurückkehren. Wirtschaftsentwicklung Mit einem negativen Wachstum von geschätzten -0.6% (auf Jahresbasis -2.2%) fiel das erste Quartal 2020 noch relativ moderat aus, obwohl die Anzeichen von COVID-19 sich rasch verdichteten. Der grosse Einbruch kam mit dem zweiten Quartal, das mit rund -20% alles seit den 1950er Jahren Gesehene in den Schatten stellte. Was die weitere Entwicklung betrifft, sind die Szenarien weiterhin mit erheblichen Unsicherheiten belastet. Selbst bei günstigen Aussichten könnte es noch einige Zeit brauchen, bis das Niveau von September 2019 wieder erreicht sein wird.
Am 20. Februar 2020 meldete die Weltgesundheitsorganisation, der grösste Infektionsherd ausserhalb Chinas sei ein im Hafen von Yokohama liegendes Kreuzfahrtschiff mit 3700 Passagieren und Besatzungsmitgliedern, von denen sich im weiteren Verlauf 711 mit COVID-19 ansteckten und 14 daran starben. Seither haben sich die Verhältnisse weltweit verschoben. Bis 30. Juli gab es in Japan rund 33’500 Infektionsfälle mit knapp über 1000 Verstorbenen. Die Schweiz kannte in der gleichen Periode fast gleich viele Fälle mit nahezu 2000 Toten. Im Verhältnis zur Bevölkerungszahl ergibt dies für die Schweiz eine 15-mal höhere Ansteckungsquote und eine um den Faktor 29 erhöhte Sterberate. Dabei kam es in Japan trotz Verhängung eines 7-wöchigen «Notstandes» durch die Regierung nie zu einem Lockdown. Die Massnahmen der Regierung hatten den Charakter von Empfehlungen, denen die meisten Unternehmen, aber zum Beispiel auch Restaurants oder Coiffeure ausserhalb von Einkaufszentren, nicht direkt unterstellt waren. Die schärfste Sanktionsform bestand in einem behördlichen «Naming and Shaming», das unter anderem gegenüber «Pachinko»-Hallen (Geldspielautomaten) teilweise zur Anwendung kam. Die Bevölkerung zeigte sich jedoch grösstenteils kooperativ. Vergleichsweise spät ist am 1. Mai 2020 ein vom Parlament verabschiedetes erstes Paket in Kraft getreten, das die Auswirkungen von COVID-19 mildern soll. Am 12. Juni folgten weitere, noch umfangreichere Massnahmen. Zusätzliche Schritte würden nicht überraschen, da die Regierung Abe einen Rückfall in ein Deflations-Szenario um (fast) jeden Preis verhindern will. Mit einer breiten Palette von Massnahmen wird – zusätzlich zur eigentlichen COVID-19- Bekämpfung – Unternehmen, Einzelfirmen und Privatpersonen unter die Arme gegriffen. Der Schwerpunkt liegt auf den KMUs, die über begrenzte finanzielle Ressourcen verfügen und oft von der Pandemie besonders betroffen sind. Hier sind neue Kredite und Kreditaufschübe, Kurzarbeit bzw. temporäre Freistellung, Mietzinsreduktionen und Steuermoratorien die wichtigsten Posten. In mehreren Fällen wurden die im ersten Paket gewährten Zuschüsse mit dem zweiten deutlich erweitert. Am umstrittensten war die Gewährung von Zahlungen an die Bevölkerung in Form von à-fonds- perdu-Beiträgen. Während Premierminister Abe eine selektive Verteilung favorisierte, beharrte der Junior-Partner in der Regierung («Komeito») in einem ungewöhnlichen Manöver auf einer entsprechend tieferen Abgabe an alle. Bei rund 900 Franken pro Person mag man sich fragen, wer daraus einen grossen Nutzen zu ziehen vermag. Bedenkt man hingegen, dass die Verteilung bis heute – rund drei Monate nach Ankündigung der Massnahme – noch immer nicht alle Haushalte erfasst hat, kann sich vorstellen, wie sehr die staatlichen Stellen bei einer anspruchsvolleren Methodik überfordert gewesen wären. Wo der Staat umgekehrt auf die Unterstützung durch private Stellen abstellte, führten hohe Verwaltungskosten zu Irritationen. Ungeachtet dieser Umstände und den Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Hilfsprogramms notierte der japanische Aktienmarkt im Juli 2020 nach einem tiefen Taucher in den ersten Monaten wieder nahe dem Hoch des Vorjahres. Zumindest von dieser Seite scheint der Kurs der Regierung wieder Kredit zu erhalten. Finanzhaushalt Japans fiskalische Position kennt schon seit längerem besondere Züge. Nach dem Ende der grossen Blase 1992 erreichte sie bis Ende des Jahrzehnts 100% des GDP, was die Staatsverschuldung betrifft. Um das Jahr 2010 wurden 200% überschritten. Seither hat sich dieser Trend deutlich verlangsamt, die Schulden nahmen jedoch weiterhin von Jahr für Jahr zu. Gleichzeitig gilt die japanische Währung als sicherer Hafen und Regierungsanleihen bleiben trotz tiefer Renditen
attraktiv. Rund 90% der Anleihenseigner sind Inländer, und die Tatsache, dass Japan seit vielen Jahren der grösste Gläubiger weltweit ist, trägt ebenfalls zur Kreditwürdigkeit bei. Bei japanischen Hilfspaketen ist insofern Vorsicht geboten, als sie nicht nur erwartete Privatinvestitionen, sondern auch Staatsausgaben, die mit der Pandemie nicht in Zusammenhang stehen, einrechnen. So wurden Ende letzten Jahres im Zusammenhang mit der Steuererhöhung vorgesehene Aufwendungen, die unter anderem einer verstärkten Digitalisierung dienen sollen, mit einbezogen. Insgesamt kamen auf diese Weise rund 40% des GDP zusammen, wie besonders in den internationalen Medien regelmässig berichtet wird. Aktuell dürften es, je nach Ausschöpfung der Beiträge, eher 10 bis 13% sein, die bei der Staatsverschuldung hinzukommen und damit die 250%-Schwelle übersteigen werden. Sollten weitere Massnahmen ergriffen werden, würde dies den Umfang selbstredend erhöhen. Bis zu einem ausgeglichenen Budget dürfte es jedenfalls noch einiges länger dauern als mit dem aktuellen Zeitplan (2025) angepeilt. Die Frage bleibt, was passieren würde, wenn die Zinsen auf breiter Front wieder ansteigen würden. Da dies zumindest vorläufig keine realistische Option scheint, dürfte Japan weiterhin mit den vorhandenen Mitteln über die Runden kommen. Zentralbank Die japanische Zentralbank galt lange Zeit als Sonderfall mit ihrer Politik der quantitativen Lockerung mittels Ankauf eigener Papiere (heute 85% der Bilanzsumme), der Intervention am Aktienmarkt durch Kauf von Indexpapieren und – seit 2016 – einer Zinskurvensteuerung, die bei 10- jährigen Anleihen eine Rendite von ungefähr null Prozent anstrebt. Inzwischen haben die amerikanische, die europäische, die englische und weitere Zentralbanken Schritte unternommen, die sich diesen Massnahmen mindestens zum Teil nähern. Allen ist gemeinsam, dass sie die Zinsen auf voraussichtlich längere Frist nahe Null halten wollen. Da die Bank of Japan schon längere Zeit mit diesen Instrumenten agiert, blieb ihr ein nur sehr beschränkter Spielraum für weitere Massnahmen. So wurde beschlossen, wenn nötig den Kauf von Staatsanleihen ohne Obergrenze zuzulassen, die Limite bei Unternehmensanleihen anzuheben und den Betrag zum Erwerb von Aktienindizes zu verdoppeln. Insgesamt hat die Bilanzsumme der Zentralbank indessen um nur ungefähr 5 Prozent zugenommen. Von der Option, nach europäischem oder amerikanischem Vorbild Banken mittels Subventionen zu ermuntern, Kredite an Unternehmen zu vergeben, wurde nicht Gebrauch gemacht. Dabei hatte Zentralbankgouverneur Kuroda noch vor zwei Jahren versucht, die Schraube bei der Geldpolitik äussert dosiert ein wenig anzuziehen. Noch bevor dies in erste Taten umgesetzt werden konnte, kam es zu einer Folge von Ereignissen, die in eine andere Richtung wiesen. Sie illustrieren, wie schwer ein Rückbau der Stützungsmassnahmen geworden ist. Beschäftigung Japans Arbeitskultur geht auf die 1950er und 1960er Jahre zurück. Bis heute gilt es als erstrebenswert, in einem Unternehmen zu beginnen und dort bis zur Pensionierung zu bleiben. Im Gegenzug bietet die Firma hohe Jobsicherheit und Investitionen in die Entwicklung ihrer Angestellten. Sehr lange Präsenzzeiten sind weiterhin die Regel, auch wenn die Regierung – unter anderem mit einer «Work Style»-Reform von 2018 – versucht, bis zu einem gewissen Grad Gegensteuer zu geben. Insgesamt sind heute rund 60% der japanischen Angestellten ein Teil dieses gut geschützten, «regulären» Sektors.
Auf der anderen Seite finden sich 40% mit sogenannt «nicht-regulären», befristeten Verträgen und meist deutlich geringeren Löhnen. Sie können ohne grössere Umtriebe entlassen werden können. Anders als während der Finanzkrise von 2008/09 fallen diese inzwischen zwar ebenfalls unter die Regelung über temporäre Freistellung und Kurzarbeit. 4.2 Millionen profitierten davon im Mai 2020, was 6% der Angestellten entspricht. Dass ungefähr ein Fünftel der Japaner über 60 in relativer Armut leben (definiert als weniger als die Hälfte des mittleren Einkommens), steht in direktem Zusammenhang mit dem Status als «nicht- reguläre» Arbeitskraft. Arbeitet jemand bei einem Unternehmen von höchstens 500 Angestellten, konnte bisher nur die «japanische AHV» beansprucht werden, die 650 Franken nicht überschreitet. Diese Grenze soll in den kommenden Jahren in mehreren Schritten auf 50 gesenkt werden. Zumindest vorläufig wird die Zahl bedürftiger Personen jedoch steigen, die sich am – oder unter diesem – Minimum bewegt. Japans Arbeitslosenrate hat bis heute von rekordtiefen 2.2% auf rund 3% zugenommen. Auf das Jahresende wird mit 4-5% gerechnet. Hintergrund dieser Zahlen ist, dass auf 100 Stellensuchende immer noch 120 Angebote kommen. Arbeitgeber, die es sich irgendwie leisten können, werden bestrebt sein, vor allem jüngere Leute bei der Stange zu halten. Je länger zudem Einreisesperren aus dem Ausland gelten, umso grösser wird die Konkurrenz um einheimische Arbeitskräfte sein. Eine Besonderheit der japanischen Arbeitskultur bildet das Hanko-Systems (persönlicher physischer Stempel, der sich in der Firma befindet). Wie weit sich diese Praxis der häufigen Anbringung solcher Stempel in Zukunft ändern wird, bleibt zu sehen. Während in einer breiten Studie eine Mehrheit sich dafür ausgesprochen hat, die Hanko-Anforderungen zu reduzieren, gaben nur 3 Prozent an, ganz auf ein elektronisches Format wechseln zu wollen. Dieser Umstand erschwert die Umstellung auf Home-Office während der Pandemie deutlich. Dass speziell Grosskonzerne auch aus der Krise lernen können, zeigt das Beispiel des Tech- Konzerns Fujitsu, der bis Anfang 2023 die Hälfte seiner 80'000 Arbeitsplätze ausserhalb der Produktion ins Home-Office verlegen will. Anstelle eines Pendler-Beitrags wird neu monatlich eine Entschädigung ausgerichtet, damit die Geschäfte von zu Hause aus geführt werden können. Fujitsu folgt damit Konkurrenten wie Hitachi, Toshiba oder Sony, die bereits eine namhafte Reduktion ihrer Arbeitsplätze an den Firmensitzen angekündigt haben. Erschwerung von Investitionen Bereits vor der Covid-19-Krise im November 2019 hatte das japanische Parlament beschlossen, Aktien in diversen Sektoren einer verschärften Kontrolle zu unterwerfen, indem ausländische Investoren bereits eine Beteiligung von 1% statt wie bisher 10% melden müssen (Foreign Exchange and Trade Act). Dies geschah vor allem in Reaktion auf eine amerikanische Neuerung, die japanische Firmen vor Problemen am US-Aktienmarkt bewahren sollte. In seinen Ausführungsbestimmungen vom Mai 2020 ging das japanische Finanzministerium jedoch deutlich weiter und unterstellte zusätzlich zu den bisher etwa 500 Unternehmen rund 1'600 weitere dem neuen Sicherheitsdispositiv, wie zum Beispiel der Hersteller von elektronischen Spielen Nintendo oder die Golfgeschäftskette Golf Do. Die neuen Regeln könnten zur Auswirkung haben, das Investitionsklima abzukühlen und aktivistische Fonds, die etwa eine höhere Dividende fordern, zurückzubinden. Die nächsten Jahre werden zeigen, welche Auswirkungen die neuen Regeln haben werden.
Strukturelle Probleme Grösstes Strukturproblem Japans bleibt jedoch die Demographie. Nicht nur hat Japan die höchste Lebenserwartung (84.6), vor jener der Schweiz. Mit einer Geburtenrate von 1.36 (2019: 865‘000 Geburten) geht auch die Schere zwischen älteren und jüngeren Bewohnern immer weiter auf. Weil im Jahr 2019 1.38 Millionen Personen starben, beläuft sich der Bevölkerungsrückgang – korrigiert durch eine Zunahme von Ausländern – auf knapp 300‘000 für das vergangene Jahr. Verschärft wird das Strukturproblem durch eine nach wie vor sehr zurückhaltende Haltung der Bevölkerung gegenüber der Einwanderung. Mit einer im April 2019 eingeführten neuen Regelung war geplant, innert einem Jahr rund 50‘000 neue Zuwanderer, vor allem aus Südostasien, ins Land zu holen. Bis zum 31. März belief sich die tatsächliche Zuwanderung jedoch auf weniger als 4000, und seit Covid-19 ist sie einstweilen ganz versiegt. 2 Internationale und regionale Wirtschaftsabkommen 2.1 Ausgangslage Mit 34% des Import-/Exportanteils des GDP (Waren und Dienstleistungen) gehört Japan zu den Ländern, die relativ gesehen am wenigsten Handel betreiben (Schweiz: ca. 120%). Trotzdem bleibt Japan – ähnlich den USA – aufgrund seiner Grösse ein sehr bedeutender Absatz- und Ursprungsmarkt. Die Warenexporte belaufen sich auf 737 Milliarden USD, mit den USA und China ungefähr auf gleicher Höhe bei jeweils rund 20%. Die Europäische Union und die TPP11-Staaten stehen mit je rund 12% zu Buch. 2.2 Japans Politik und Prioritäten Seit 2018 hat Japan – als wichtiger Pfeiler von Premierminister Abe’s Wirtschaftspolitik – zwei substanzielle Handelsabkommen zum Abschluss gebracht (EU, TPP) sowie einen «Phase 1»- Vertrag mit den USA vereinbart. Mit 14 Ländern, die RCEP angehören («Regional Comprehensive Economic Partnership»; ohne Indien), soll noch in diesem Jahr ein – allerdings weniger weitgehendes – Abkommen folgen. Sollte dieser Fall eintreten, würde Japans Warenfreihandelsquote ab 2019 – bei allen Unterschieden hinsichtlich Tiefe der Verträge – von 23% auf 88% anwachsen. Beim EU-, TPP- und US-Abkommen wurde erstmals der bisher stark geschützte japanische Agrarsektor in grösserem Umfang miteinbezogen. Bisher unterschied Japan zwischen landwirtschaftlichen Gütern, die im Land selbst hergestellt und mit hohen Zöllen geschützt wurden, sowie anderen Produkten, für die in der Regel keine Zollschranken bestehen. Der Selbstversorgungsgrad (auf Kalorienbasis) beläuft sich dabei auf nur gerade 37%. Während bei einigen Waren nun zusätzlich auf Import gesetzt wird, bleibt vor allem der Reis ausgespart, der in Japan meist von Personen im Pensionsalter auf kleinen Parzellen angebaut wird. Das Abkommen mit der Europäischen Union trat am 1. Februar 2019 in Kraft und wird sich, was zum Beispiel die Autoexporte in die EU (Zollsatz 10%) oder landwirtschaftliche Ausfuhren nach Japan (z.B. Hartkäse, Zollsatz 29.8%) betrifft, über die nächsten Jahre bis zur Zollfreiheit (oder einem wesentlich tieferen Tarifsatz) auswirken. Mit dem Vereinigten Königreich, im Moment noch in eine Übergangsregelung mit der EU eingebunden, wurden separate Verhandlungen aufgenommen. Hier ist zurzeit offen, ob der künftige Freihandel rechtzeitig auf die Übergangsfrist mit der EU, erst später realisiert, oder eine Zwischenlösung angestrebt wird. Beim «Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership» (TPP) haben sich seit der Unterzeichnung durch Vietnam Anfang 2019 keine nennenswerten neuen
Entwicklungen ergeben. Unter japanischer Führung wurde das einst von der Obama-Administration mitunterzeichnete Abkommen in einzelnen Punkten neu ausgehandelt. Seit dem Inkrafttreten am 28. Dezember 2018 vermochten die Vertragsstaaten Brunei, Chile, Malaysia und Peru ihre Ratifikationsverfahren noch nicht abzuschliessen. Ob eine Erweiterung des Abkommens realistisch sein wird, bleibt zu sehen. Mit den USA kam am 7. Oktober 2019 ein erstes Handelsabkommen zustande, bei dem es vor allem darum ging, den Rückstand auf die im Landwirtschaftsbereich vorangegangen Staaten der EU und der TPP-Staaten wettzumachen. Es ist im Januar 2020 in Kraft getreten. Schwierige Anliegen wie Motorfahrzeugzölle (Japan), Dienstleistungen (USA) oder Eingriffe in die Währungspolitik (USA) wurden dabei noch ausgeklammert. Die von Japan mit einiger Besorgnis erwarteten weiteren Verhandlungen sollen bald fortgesetzt werden. Hinsichtlich RCEP (10 ASEAN-Staaten plus China, Südkorea, Australien, Neuseeland und Japan) scheint ein Durchbruch auch ohne Indien greifbar. An einem virtuellen Ministertreffen vom 22. Juni 2020 bekannten sich alle Staaten zu einem Abschluss vor Jahresende bereit. Mit RCEP würden China und Südkorea zu Freihandelspartnern Japans werden. In Bezug auf Freihandelsbeziehungen mit den 10 ASEAN-Staaten (in Kraft seit 2008) hat Japan im Juni 2020 eine Ausdehnung des Anwendungsbereichs auf Dienstleistungen und Investitionen gemeldet. Damit werden einerseits jene drei ASEAN-Mitglieder erfasst, mit denen Japan noch über keinen bilateralen Vertrag zu diesen Disziplinen verfügt (Kambodscha, Laos, Myanmar). Anderseits gelangen die anderen sieben Länder, soweit anwendbar, zu einer Aufdatierung des Abkommens. Es tritt am 1. August 2020 in Kraft. Aktive Prozesse betreffen ausserdem das trilaterale Abkommen Japan-China-Südkorea, dessen 16. Verhandlungsrunde im November 2019 stattfand. Noch etwas länger ist es her (Oktober 2019), seit die 17. Runde im Hinblick auf ein Freihandelsabkommen mit der Türkei durchgeführt wurde. Bekanntlich löst ein Vertrag mit der EU infolge Zollunion eine Verhandlungspflicht mit Ankara aus. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Japan zwischen 2002 und 2012 dreizehn Freihandelsabkommen abschloss. Es handelt sich, neben einem Vertrag mit ASEAN als Gruppe (2008), um die ASEAN-Staaten Singapur (2002), Malaysia (2005), Thailand (2007), Indonesien (2007), Brunei (2007), Vietnam (2008) und Philippinen (2009). Zudem kam es zu Abschlüssen mit Mexiko (2005), Chile (2007), der Schweiz (2009), Indien (2011) und Peru (2012). Australien (2015) und die Mongolei (2015) ergänzten diese Serie. Diese Abkommen berührten Japans primäre Sensitivitäten, insbesondere im Agrarbereich, nur am Rande. Ab 2013 ging Premierminister Abe dazu über, Abkommen mit Gruppen ambitionierterer Partner zu verhandeln. Dazu gehörten namentlich die USA, die EU und die CPTPP-Staaten, die Zugang zum Markt mit landwirtschaftlichen Gütern verlangten. 2.3 Aussichten für die Schweiz Im Sommer 2019 weilte eine von Bundesrat Parmelin geleitete Delegation in Japan, um sich namentlich für eine Revision des Freihandelsabkommens einzusetzen. Vorausgegangen waren zwei Treffen des Gemischten Ausschusses unter dem FHWPA in den Jahren 2016 und 2018, bei denen die Schweiz sich für eine Überarbeitung ausgesprochen hatte, die japanische Seite es aber ablehnte, das Parlament zu involvieren. Als nächste Etappe stellt der Bundesrat in Aussicht, beim zuständigen japanischen Aussenministerium einen konkreten Vorschlag einzureichen. Wegen Covid-19 konnte dieses Anliegen noch nicht umgesetzt werden. Das wichtigste Ziel, vor allem beim Japan-EU-Abkommen im Landwirtschaftsbereich (Schweizer Exporte: 370 Millionen CHF) keine Benachteiligung zu erfahren, dürfte dabei keinen leichten Stand
haben. Zum einen verfügt die Schweiz gegenüber Japan seit Jahren über einen namhaften Überschuss. Auch hat sie vor mehr als 10 Jahren Fahrzeugexporten Zollfreiheit eingeräumt – dem wichtigsten offensiven Anliegen Japans. Umgekehrt ist das japanische Interesse an der Ausfuhr von Agrarprodukten in die Schweiz weiterhin gering. Bei gewissen Landwirtschaftsprodukten ist die Schweiz dabei vorläufig noch im Vorteil. So kann bei gewissen Hartkäsen auf ein Kontingent von 1000 Tonnen zurückgegriffen werden, das zu 14.8% verzollt wird (Endstufe). Die EU hat demgegenüber einen Prozess begonnen, den sie erst in ein paar Jahren zu diesem Ziel bringen, von dort aber weiter zur Zollbefreiung führen wird. Dass Japan bereit ist, sich schweizerischen Anliegen anzunehmen, soweit das Parlament nicht involviert werden muss, haben seit Bundesrat Parmelins Besuch mehrere Initiativen gezeigt. So wurde neben den USA, Australien und Kanada auch mit der Schweiz ein Abkommen geschlossen, das die gegenseitige Anerkennung von Bio-Erzeugnissen mit tierischen Produkten vorsieht (Verordnungsänderung seit Juli 2020 in Japan). Auch bei Rindfleischerzeugnissen dürfte ein Importverbot gegenüber der Schweiz bald aufgehoben werden, das auf die BSE-Krise in den 1990er Jahren zurückgeht. Bei Milcherzeugnissen ist eine aufgrund neuer japanischer Vorschriften entstandene Situation bilateral termingerecht gelöst worden. Ob ein Freihandelsprojekt im Verbund mit den EFTA-Staaten etwas daran ändern würde, bleibt abzuwarten. Den intensiven Bemühungen von Norwegen und Island ist noch kein Erfolg beschieden worden, zumal die beiden EFTA-Partner mit weniger als einem halben Prozent von Japans Aussenhandel zumindest vorläufig nicht im Vordergrund zu stehen scheinen. Vielmehr dürften die Projekte mit den USA und dem Vereinigten Königreich auf absehbare Zeit klare Prioritäten bleiben. 3 Aussenhandel 3.1 Entwicklung und allgemeine Aussichten 3.1.1 Warenhandel Nach teils kräftigen Zuwächsen in den Vorjahren sah das Jahr 2019 einen Rückgang von Japans Warenhandel. Um gut 5% gingen die Aus- und Einfuhren zurück, auf 77 Billionen Yen (ca. 680 Milliarden Franken) bei den Exporten und 78.5 Billionen Yen bei den Importen (ca. 695 Milliarden Franken). Dass sich weiter verschärfende Spannungen zwischen den USA und China, Japans zwei wichtigsten Handelspartnern, negativ auswirkten, steht ausser Frage. Überdurchschnittlich gingen auf Import- wie Exportseite insbesondere Stahl-, Metall- und elektronische Komponenten zurück. Dabei überholten die USA wieder China als erste Ausfuhrdestination, wobei China vor allem bei den Exporten nach Japan weiterhin deutlich die Nase vorne hatte. Auf Importseite spielen weiterhin die Energieträger eine dominante Rolle mit über 20% des Totals. Mit der EU als drittgrösstem Partner nahmen bei den Importen die Nahrungsmittel den zweiten Platz nach den Pharmazeutika ein. Während 2020 zunächst aufgehellter aussah (-2.9% im Januar, -1.0% im Februar bei den Exporten), kam der grosse Einbruch in der Folge. Laut Zahlen des japanischen Finanzministeriums für das 2. Quartal gingen die Ausfuhren um 25% und die Einfuhren um 16% zurück, mit einem Höhepunkt im Mai. Besonders hart traf es die Fahrzeugexporte in die USA – dem bedeutendsten einzelnen Ausfuhrposten – mit -42% für die Periode von Januar bis Juni. Deutlich besser erging es den Aus- und Einfuhren nach China mit -3.6%. Inzwischen hat sich Japan zu einem Programm entschlossen, das die Abhängigkeit von China reduzieren soll. Bis zu zwei Milliarden will die Regierung für eine Verlagerung kritischer Bereiche zurück nach Japan bzw. in die ASEAN-Staaten bewilligen. Dies dürfte ein weiterer Schritt sein in
einem sich verschlechternden Verhältnis zwischen Japan und seinem wichtigsten wirtschaftlichen Partner (Exporte und Importe zusammengenommen). 3.1.2 Dienstleistungshandel Erstmals seit Beginn der Zahlenreihe im Jahr 1996 wies Japan im Jahr 2019 einen leicht positiven Saldo bei den Dienstleistungen auf (150 Millionen Franken). Der Tourismus, mit einem Überschuss von 25 Milliarden Franken, sowie Einkünfte aus Geistigem Eigentum von 20 Milliarden gaben den Ton an. Auch Finanz- und Baudienstleistungen lieferten Zahlen im deutlich positiven Bereich. Insgesamt erreichten die japanischen Dienstleistungsexporte 22.6 Trillionen Yen (209 Milliarden Franken), während die Einfuhren 22.45 Trillionen Yen (207.5 Milliarden Franken) ausmachten. Unter den führenden Partnern befinden sich die USA (27%), die Europäische Union (21%) sowie China (10%). Dass (auch) der internationale Dienstleistungshandel durch Covid-19 in Mitleidenschaft gezogen wird, steht ausser Frage. Insbesondere dürfte der Tourismus, 2019 wie erwähnt stärkster Beitragszahler zur Bilanz, fast wegfallen. Eine Gesamtsicht wird indessen erst nach Jahresabschluss möglich sein. 3.2 Bilateraler Handel 3.2.1 Warenhandel Gemäss Eidgenössischer Zollverwaltung (Konjunkturelles Total, ohne Edelmetalle und Kunstgegenstände) belegt Japan den siebten Platz unter den schweizerischen Warenausfuhrpartnern, nach Deutschland, den USA, Frankreich, Italien, China und dem Vereinigten Königreich. 8.08 Milliarden Schweizer Franken gingen 2019 nach Japan (3.3% des Totals). Werden Edelmetalle und Kunstgegenstände eingeschlossen, kommt Japan auf den neunten Rang, nach Indien und Hongkong. Entgegen dem Trend sinkender Exporte legten die Schweizer Ausfuhren auch im Jahr 2019 zu. Allerdings war dies vorwiegend den beiden führenden Warenkategorien zuzuschreiben, nämlich Pharmazeutika (43.5%, +13%) und Uhren (19.8%, +20%), auf die gegen zwei Drittel des Ausfuhrwertes entfielen. Medizinprodukte waren gehalten, während Maschinen, Landwirtschaftsprodukte und Chemikalien Anteile verloren. Bei den Importen findet sich Japan an 13. Stelle (14. bei Anrechnung von Edelmetallen und Kunstgegenständen) mit 3.36 Milliarden (respektive 4.5 Milliarden). Maschinen (26%) und Pharmazeutika (22%) überholten dabei die Kategorie der Fahrzeuge (19%) in der japanischen Bilanz. Damit erreichte die Schweiz gegenüber Japan mit 4.7 Milliarden den zweithöchsten Handelsüberschuss, nach jenem der USA (sechshöchster bei Berücksichtigung von Edelmetallen und Kunstgegenständen). Mit Covid-19 haben sich diese Zahlen verändert. Während in den ersten sechs Monaten die Exporte aus der Schweiz gemäss noch provisorischen Angaben gegenüber dem Vorjahr um 14% zurückgingen, legten die Importe um 8.8% zu. Auch hier gilt es ein konsolidiertes Ergebnis für das Jahr abzuwarten, um weitere Schlüsse ziehen zu können. Es würde aber kaum überraschen, wenn namentlich bei den Uhren ein deutlicher Rückgang festzustellen wäre. 3.2.2 Dienstleistungshandel Nach Angaben des japanischen Finanzministeriums überstiegen im Jahr 2019 die bilateralen Dienstleistungen interessanterweise die Ausfuhren von Waren in Richtung der Schweiz, und dies recht deutlich. Bei 5 Milliarden resultierte ein Dienstleistungsüberschuss von rund 500 Millionen
zugunsten Japans, was einem Plus von 4% bzw. 9% der schweizerischen Dienstleistungsausfuhren entspricht. 4 Direktinvestitionen 4.1 Entwicklungen und allgemeine Aussichten Der Bestand ausländischer Direktinvestitionen erreichte 2019 in Japan 240 Billionen Yen (225 Milliarden Franken), ein Zuwachs von 6% gegenüber 2018. Die USA blieben der wichtigste Anleger mit 23%, gefolgt von Frankreich (16%), Singapur (11%) und den Niederlanden (9%). Direktinvestitionen liegen in Japan jedoch so tief wie in keinem anderen entwickelten Land. In Prozenten des GDP ausgedrückt sind es 4.4% – dies im Vergleich zum Vereinigten Königreich mit 67%, den USA mit 37% oder 23% für Deutschland. Trotz gewisser Anstrengungen der Regierung Abe, unter anderem durch eine Unternehmenssteuer von weniger als 30% vermehrt ausländische Unternehmen anzuziehen, dürfte sich daran auch nicht so rasch etwas ändern. Eher wird das neue Investitionsgesetz ein zusätzlicher Grund sein, sich in Japan mit längerfristigen Engagements zurückzuhalten. Auch die restriktiven Einreisebestimmungen für niedergelassene Ausländer dürften sich nicht gerade positiv auf das Investitionsklima auswirken. Mit 36% des GDP bewegt sich Japans Bestand an Direktinvestitionen im Ausland etwa auf gleicher Höhe mit den USA. Noch vor zehn Jahren waren es 14% gewesen. Die USA sind mit 30% der mit Abstand führende Markt für japanische Anlagen, vor dem Vereinigten Königreich (9%), China (7%) und den Niederlanden (ebenfalls 7%). Der Wert im abgelaufenen Jahr belief sich auf 1.93 Billionen Yen. Es kann damit gerechnet werden, dass sein Umfang weiter zunehmen wird, nicht zuletzt infolge des kaum mehr wachsenden Heimmarktes. 4.2 Bilaterale Investitionen Die Schweiz figuriert auch 2019 prominent auf der Liste der grössten Investoren in Japan. Mit einem Bestand von 147 Billionen Yen (13.3 Milliarden Franken) und einem Anteil von 4.4% liegt sie auf Platz 6. Wird in der Statistik auf den «Letztlich Berechtigten» abgestellt, verbessert sich ihre Position auf den 4. Rang, zulasten von Singapur und den Cayman Islands. Nur die USA (25%), Frankreich und die Niederlande (je 11%) liegen vor ihr. Der Bestand der japanischen Direktinvestitionen in der Schweiz hat im letzten Jahr sehr deutlich zugenommen, was auch auf die Mehrheitsbeteiligung von Hitachi an ABB Power Grids zurückzuführen sein dürfte. Gemäss Zahlen der japanischen Zentralbank ist Japan mittlerweile mit rund 44 Milliarden Franken in der Schweiz engagiert, was 2.4% der japanischen Direktinvestitionen im Ausland entspricht. 5 Handels-, Wirtschafts- und Tourismusförderung, „Landeswerbung“ 5.1 Instrumente der Aussenwirtschaftsförderung Swiss Business Hub Japan Der Swiss Business Hub, in die Botschaft integriert mit sechs Mitarbeitern, berät und organisiert Anlässe zur Förderung schweizerischer Exporte nach Japan, von japanischen Investitionen in die Schweiz und – seit Januar 2020 – von R&D-Aktivitäten an schweizerischen Forschungsstandorten. Seit März 2020 finden diese Veranstaltungen meist in Form von Webinars oder Online-Panel- Diskussionen statt.
Zu den Hauptveranstaltungen zählen solche mit offizieller schweizerischer Beteiligung, insbesondere in Form von nationalen Ständen. Dazu gehören die Japan International Machine Tool Fair (JIMTOF), die alle zwei Jahre stattfindet. Von Swissmem mit Unterstützung des SBH veranstaltet, nahmen im Herbst 2018 rund 100 Schweizer Firmen daran teil. Wegen Covid-19 ist die Ausgabe 2020 verschoben worden. Im Jahr 2019 nahm die Schweiz zudem erstmals mit einem «Swisstech» Pavillon und 17 Firmen, Startups und Organisationen an CEATEC teil, der führenden Messe für Unterhaltungselektronik in Japan, als gemeinsame Aufgabe des SBH, der Wissenschafts- und Technologieabteilung der Botschaft sowie von Präsenz Schweiz. In diesem November ist eine nächste Ausgabe vorgesehen, allerdings im Online-Format. Weitere schweizerische Beteiligungen betrafen MassTrans Japan, ein vom SBHJ erstmals mit zwölf Schweizer Unternehmen durchgeführter Anlass im Bereich der Bahntechnologie. Eine Fortsetzung dieses Engagements, das ebenfalls alle zwei Jahre stattfindet, ist für 2021 geplant. Weiter nahm der SBHJ 2019 mit sechs Schweizer Firmen an Medtech Japan teil. 2020 war ausserdem eine Beteiligung an BioJapan eingeplant, doch musste die Veranstaltung wiederum wegen Covid-19 abgesagt werden. Während diese Veranstaltungen in erster Linie der Promotion schweizerischer Produkte auf dem japanischen Markt dienen, sind Synergien mit der Förderung von Investitionen in der Schweiz offensichtlich. Der SBHJ agiert dabei als «one stop shop» in Zusammenarbeit mit Kantonen und weiteren Partnern. Unter anderem werden regelmässig Seminare, derzeit meist in Online-Form, zur Attraktivität der Schweiz durchgeführt, besonders als Standort für regionale oder globale Hauptquartiere sowie führende Innovationen. Mit der Wissenschafts- und Technologiesektion der Botschaft ist dabei die Zusammenarbeit intensiviert worden. Schweiz Tourismus Schweiz Tourismus, 1976 als erste Vertretung in Asien in Tokio eingeführt, wurde 2017 in die Botschaft integriert. Drei Mitarbeiter setzen sich für eine Vermarktung der Schweiz als attraktive Destination für Freizeit- und Geschäftsreisen ein, in enger Zusammenarbeit mit Partnern auf beiden Seiten. Für japanische Touristen bleibt die Schweiz primär eine Sommerdestination. 70% der Reisen finden zwischen Juni und August statt. Im Jahr 2019 registrierte die Schweizer Hotelindustrie rund 390'000 Übernachtungen von Personen aus Japan (1.9% der ausländischen Besucher). Mit etwa 300 Franken gehören sie zu den zahlungskräftigsten Kunden, mit einem Fokus auf Qualität. Die direkte ökonomische Wirkung wird auf rund 190 Millionen Franken geschätzt. Unter den Herausforderungen, mit denen sich Schweiz Tourismus auseinandersetzen hat, gehören neben der beschränkten Zahl von Ferientagen japanischer Angestellter auch, das Interesse bei einer jüngeren Kundschaft zu wecken. Mit Covid-19 ist die internationale Tourismusindustrie fast zu einem Stillstand gekommen. Seit dem zweiten Weltkrieg handelt es sich um die grösste Krise, welcher sich der Sektor weltweit ausgesetzt sieht. Japan befleissigt sich dabei einer besonders restriktiven Linie, was die grenzüberschreitende Reisetätigkeit anbelangt. Ohne grössere Änderung dürfte es bis zu einem Abklingen der Pandemie nur wenige japanische Touristen geben, welche in die Schweiz kommen werden.
Präsenz Schweiz
Im Hinblick auf die Olympischen und Paralympischen Spiele, die nun im Sommer 2021 stattfinden
sollen, arbeiten die Botschaft und Präsenz Schweiz eng zusammen. Der Bundesrat hat seine
Zustimmung gegeben zur Durchführung zwischen Juli und September eines «House of Switzerland»
in einem von Tokios Trendquartieren. Dazu gehörte eine Neubeurteilung im Anschluss an die
Verschiebung der Spiele, einschliesslich der Suche eines neuen Veranstaltungsortes. Unter den
Sponsoren hat bereits eine Mehrheit signalisiert, auch im kommenden Jahr dabei sein zu wollen.
Seit Februar 2019 führt die Botschaft zusammen mit Präsenz Schweiz im Hinblick auf die Spiele
eine Kommunikationskampagne unter dem Titel «Doors to Switzerland». Diese zielt darauf ab, das
Bild der Schweiz unter anderem in den Bereichen der Technologie und der kreativen Industrien zu
stärken. Nach eineinhalb Jahren hat die Kampagne über 40 Anlässe mit etwa 50'000 Besuchern,
200 Presseartikeln und 750'000 Einträgen auf Sozialen Medien bewirkt.
Schweizer Netzwerke in Japan
Swiss Chamber of Commerce and Industry in Japan (SCCIJ)
Die SCCIJ, gegründet 1981, verbindet Schweizer Unternehmen in Japan durch ein vielseitiges
Programm. Monatliche Business Lunches, Anlässe für junge Berufsleute und manches mehr
schaffen Kontakte und Geschäftsverbindungen. Bei offiziellen Besuchen schweizerischer Vertreter,
wie jenem von Bundespräsident Berset 2018 und Bundesrat Parmelin 2019, gehört sie zu den ersten
Ansprechpartnern. Die Kammer hat ungefähr 200 Mitglieder, von denen drei Viertel Firmen sind.
Zusammen mit der Botschaft und der IMD Business School in Lausanne bildet die SCCIJ ein Team
zur Organisation des Switzerland-Japan Economic Forum, einem halbtägigen Anlass mit rund
200 Teilnehmern. Im Verbund mit der Schweizerisch-Japanischen Handelskammer in Zürich
ermöglicht sie Stagiaire-Stellen in Japan und der Schweiz. Seit dem Ausbruch von Covid-19 sind
die Möglichkeiten der SCCIJ zwar eingeschränkt worden, doch kann mit Online-Angeboten und
gelegentlichen physischen Anlässen ein Ersatzprogramm gewährleistet werden.
Japan-Switzerland Economic Council (JSEC)
JSEC wurde 2014 aus Anlass der 150-Jahr-Feier der diplomatischen Beziehungen zwischen der
Schweiz und Japan geschaffen. Der Rat, dessen Sekretariat von der Botschaft wahrgenommen wird,
vernetzt japanische Firmen mit Direktinvestitionen in der Schweiz.
ISC St. Gallen Club Japan
Gegründet im Jahr 2003, unterstützt der Club das jährlich stattfindende Internationale St. Gallen
Symposium für aktuelle und zukünftige Führungskräfte, unter anderem durch die Rekrutierung von
namhaften japanischen Teilnehmern. Das hochrangig besetzte Gremium führt seine
Generalversammlung auf der Residenz des Schweizer Botschafters durch, ihrem Ehrenpräsidenten.
Wegen Covid-19 musste die Ausgabe 2020 des St. Gallen Symposiums auf nächstes Jahr
verschoben werden.
World Economic Forum (WEF) Japan
Japan ist am jährlichen WEF in Davos traditionell stark vertreten. In Zusammenarbeit mit der
Botschaft veranstaltet das japanische Büro regelmässig einen «Post-WEF»-Anlass mit Vertretern
von Wirtschaft, Regierung und Akademie. Im März 2019 war WEF-Gründer Klaus Schwab für die
Hauptansprache verantwortlich.Andere Netzwerke in Japan mit Schweizer Bezug Mehrere Schweizer Universitäten unterhalten Alumni-Assoziationen, die sich regelmässig treffen. Auch diverse Städte sowie Tourismusanbieter unterhalten Partnerschaften, wie zum Beispiel jene zwischen der «Rhätischen Bahn» und «Hakone Railways». 5.2 Interesse Japans für die Schweiz Der Finanzplatz Schweiz geniesst in Japan hohes Ansehen hinsichtlich Qualität und Spezialisierung seiner Dienstleistungen, speziell was das Geschäft mit vermögenden Privatkunden betrifft. Zahlreiche Schweizer Anbieter sind mit teils ansehnlichen Mitarbeiterbeständen vor Ort, von denen aber nur noch die Wenigsten einen Schweizer Hintergrund haben. Seit 1998 findet ein im Grundsatz jährlicher bilateraler Finanzdialog statt, dessen 21. Ausgabe im Dezember 2019 durchgeführt wurde. Während die gegenseitige Abstimmung und Information wichtige Aufgaben des Dialogs darstellen, konnte bei der grenzüberschreitenden Beratungstätigkeit für in Japan ansässige Bankengruppen bis auf weiteres kein Durchbruch erzielt werden. Bei den Investitionen ist die Schweiz, neben Vertriebsgesellschaften für den nationalen Markt, wie gesagt besonders für regionale oder globale Konzernsitze und als Forschungs- und Entwicklungsstandort attraktiv. Mit ihren komparativen Vorteilen – speziell hinsichtlich Bildung und Forschung – interessiert die Schweiz japanische Unternehmen insbesondere in den Bereichen Fintech und Blockchain, künstliche Intelligenz, Robotics und Life Sciences. Eine restriktive Praxis bei den Arbeitsbewilligungen und relativ hohe Preise können sich dämpfend auswirken.
ANHANG 1
Wirtschaftsstruktur Japans
2013 2018
Verteilung des BIP
Primärsektor 1.1 % 1.2 %
Verarbeitende Industrie 25.0 % 29.0 %
Dienstleistungen 73.9 % 69.8 %
- davon öffentliche Dienstleistungen 5.2 % 5.0 %
Verteilung der Beschäftigung
Primärsektor 4.1 % 3.9 %
Verarbeitende Industrie 23.3 % 22.5 %
Dienstleistungen 72.6 % 73.6 %
- davon öffentliche Dienstleistungen 6.0 % 5.8 %
Quellen:
"Gross Domestic Product and Factor Income classified by Economic Activities", National Accounts for 2018
Economic and Social Research Institute, Cabinet Office
https://www.esri.cao.go.jp/en/sna/data/kakuhou/files/2018/2018annual_report_e.html
https://www.esri.cao.go.jp/en/sna/data/kakuhou/files/2018/tables/30fcm3n_en.xlsx
https://www.esri.cao.go.jp/en/sna/data/kakuhou/files/2018/pdf/point_flow_en_20191226.pdf (p.9)
"Employed Persons, Employees and Hours Worked classified by Economic Activities", National Accounts for 2018
Economic and Social Research Institute, Cabinet Office
https://www.esri.cao.go.jp/en/sna/data/kakuhou/files/2018/tables/30s3_en.xlsxANHANG 2
Wichtigste Wirtschaftsdaten Japans
2018 2019 2020 Schweiz 2019
SBIP (Mrd. USD ) 4’954.0 5'154.5 4’912 782.0
BIP/pro Kopf (USD) 39’166 40’847 38’928 83’162
Wachstumsrate (% des BIP) 0.3 0.0 -4.7 0.9
Inflationsrate (%) 1.0 0.5 -0.5 0.4
Arbeitslosigkeit (%) 2.4 2.3 3.0 2.3
Budget-Saldo (% des BIP) -2.4 -2.8 -12.0 0.9
Ertragsbilanz (% des BIP) 3.5 3.6 1.6 12.2
Gesamtverschuldung (% des BIP) 237.9 239.0 251.0 38.7
Quellen:
1., 2. und 4. Kolonne:
World Economic Outlook, International Monetary Fund, October 2019, April and June 2020:
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
3. Kolonne:
Bank of Japan, Outlook for Economic Activity and Prices, July 2020 (Schätzung):
https://www.boj.or.jp/en/mopo/outlook/gor2007b.pdfANHANG 3
Japans Handelspartner 2019
Land Exporte Anteil % Land Importe Anteil %
(Mio. USD) (Mio. USD)
1 U.S.A. 139’884 19.8% -0.1% 1 China 169’262 23.5% -2.5%
2 China 134’697 19.1% -6.4% 2 U.S.A. 79’214 11.0% -2.9%
3 South Korea 46’249 6.6% -11.9% 3 Australia 45’463 6.3% -0.5%
4 Taiwan 43’015 6.1% 1.5% 4 South Korea 29’586 4.1% -7.9%
5 Hong Kong 33’631 4.7% -3.0% 5 Saudi Arabia 27’625 3.8% -18.2%
6 Thailand 30’186 4.3% -6.4% 6 Taiwan 26’857 3.7% -1.0%
7 Germany 20’229 2.9% -3.1% 7 UAE 26’200 3.6% -4.8%
8 Singapore 20’159 2.9% -13.9% 8 Thailand 25’359 3.5% 1.2%
9 Vietnam 16’496 2.3% 0.5% 9 Germany 24’965 3.5% -3.9%
10 Australia 14’491 2.1% -15.3% 10 Vietnam 22’489 3.1% 6.6%
European 82’133 11.6% -1.5% European 89’161 12.4% 1.4%
Union (28) Union (28)
26 Switzerland 4’105 0.6% 8.4% 19 Switzerland 8’184 1.1% 5.4%
Total 705’682 100.0 -4.4% Total 720’764 100.0 -3.7%
Quelle:
"Japanese Trade and Investment Statistics", Japan External Trade Organization
(based on MOF's trade statistics)
https://www.jetro.go.jp/ext_images/en/reports/statistics/data/gaikyo2019e.xlsANHANG 4 Modul CH@WORLD: A750
Bilaterale Handelsentwicklung Schweiz-Japan
Export Veränderung Import Veränderung Saldo Volumen
(Mio. CHF) (%) (Mio. CHF) (%) (in Mio.) (in Mio.)
2010 6’735 -5.8% 3’681 2.3% 3’054 10’416
2011 6’658 -1.1% 4’144 12.6% 2’514 10’802
2012* 7’171 N/A 4’730 N/A 2’440 11’901
2013 6’425 -10.4% 3’753 -20.7% 2’582 10’179
2014 6’394 -0.5% 3’660 -2.5% 2’735 10’054
2015 6’592 3.1% 3’483 -4.8% 3’109 10’075
2016 7’511 13.9% 3’954 13.5% 3’557 11’465
2017 7’468 -0.6% 5’995 51.6% 1’473 13’462
2018 7’765 4.0% 4’669 -22.1% 3’096 12’434
2019 8’136 4.8% 4’526 -3.1% 3’610 12’662
*) Ab dem 1.1.2012 hat die EZV die Berechnungsmethode für die Importe und Exporte geändert. Infolgedessen sind
Vergleiche zwischen 2012 und den vorhergehenden Jahren nicht mehr möglich.1
**) Total «Konjunktursicht» (Total 1): ohne Gold in Barren und andere Edelmetalle, Münzen, Edel- und Schmucksteine
sowie Kunstgegenstände und Antiquitäten
***) Veränderung (%) gegenüber Vorjahresperiode
Exporte 2019 2018
(% des Totals) (% des Totals)
1. Pharmazeutische Erzeugnisse 43.5% 40.2%
2. Uhrmacherwaren 19.8% 17.3%
3. Edelsteine, Edelmetalle, Bijouterie 7.7% 8.5%
4. Opt./ medizin. instrumente 7.7% 7.1%
Importe 2019 2018
(% des Totals) (% des Totals)
29.8% 34.0%
1. Edelsteine, Edelmetalle, Bijouterie
2. Pharmazeutische Erzeugnisse 15.4% 12.2%
3. Fahrzeuge, Flugzeuge usw. 13.3% 14.5%
4. Maschinen (nicht elektrisch) 10.9% 10.4%
Quelle: Eidgenössische Zollverwaltung EZV, Gesamttotal (Total 2): mit Gold in Barren und anderen Edelmetallen, Münzen, Edel- und Schmucksteinen
sowie Kunstgegenständen und Antiquitäten. Das Total 2 vor 2012 enthält kein Gold, Silber und Münzen.ANHANG 5
Hauptinvestoren in Japan nach Land (2019)
Flüsse im
Platz Land Direktinvestitionen Anteil Veränderung vergangenen
(Mia JPY) (Bestand) Jahr
(Mia JPY)
Vereinigte
1 7'980.1 23.6% 24.9% 1'589.2
Staaten
2 Frankreich 3'928.4 11.6% 4.5% 168.3
3 Niederlande 3'906.7 11.5% -15.4% -712.6
4 Singapur 3'561.8 10.5% 38.7% 992.9
Vereinigtes
5 2'496.0 7.4% -3.0% -76.4
Königreich
6 Cayman Islands 1'948.5 5.8% 16.2% 271.8
7 Schweiz 1'472.5 4.3% -7.3% -116.6
8 Hongkong 1'236.5 3.7% 21.4% 217.7
9 Luxemburg 972.7 2.9% 16.2% 135.8
10 Deutschland 957.6 2.8% -12.7% -139.3
… EU 13'089.1 38.6% -4.6% -636.1
Total 100% 10.4% 3'188.3
33'871.1
Quelle: Regional Direct Investment Position (Liabilities), Ministry of Finance
https://www.mof.go.jp/international_policy/reference/iip/rdip2019.xls
https://www.mof.go.jp/international_policy/reference/iip/rdip2018.xlsSie können auch lesen