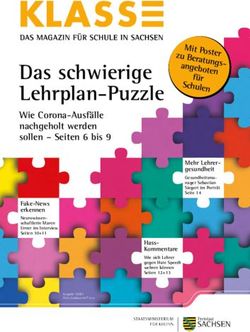AESF Herbsttagung 2021 - 4-6 Tagungsband mit Abstracts - University ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
4-6
NOVEMBER
Universität Luxemburg
Campus Belval, Maison du Savoir
Luxemburg
2021
AESF
Herbsttagung 2021
Tagungsband mit AbstractsDonnerstag, 4. November 2021 Freitag, 5. November 2021
Pre-Conference 9.30 – 11.30 Stadtführung Luxemburg Stadt
Treffpunkt: Luxembourg City Tourist Office
Universität Luxemburg – Campus Belval – Maison du
Im Anschluss gemeinsame Busfahrt zum Campus
Savoir
13.00 Ankunft und Anmeldung (3. Stock) HAUPTTAGUNG / Tag 1
13.30- Workshop I – Intensive Longitudinal Methods Universität Luxemburg – Campus Belval – Maison du Savoir
15.30 (Raum 3.500) Ab 12.00 Tagungsanmeldung und Mittagssnack (3. Stock)
Carmen Zurbriggen
13.00 Tagungseröffnung (Raum 3.500)
15.30- Christine Schiltz, Professor in Cognitive Neuroscience,
Pause mit Kaffee und Kuchen
16.00 Vice Dean of Faculty of Humanities, Education and Social
Sciences
16.00- Workshop II – Social Media in der empirischen
Justin J. W. Powell, Professor for Sociology of Education, Head
18.00 sonderpädagogischen Forschung (Raum 3.500) of Institute of Education and Society
Chantal Hinni & Samira Veraguth Mireille Krischler, Postdoctoral Researcher in Inclusive
Education
18.30 Möglichkeit eines gemeinsamen Abendessens (Nähe Campus
Carmen Zurbriggen, Professor in Inclusive Education
Belval und Bahnhof)13.30 – Session 1.1.1 – Vorträge Session 1.1.2 – Vorträge 15.30 - Postergalerie mit Kaffee und Kuchen
15.00 (Raum 3.500) / (Raum 3.510) / 16.30 (Raum 3.190)
Chair: J. Goldan Chair: M. Krischler
Die soziale Integration von Schülerinnen und Schülern mit
Soziale Urteilstendenzen Ist soziale Kompetenz externalisierenden Verhaltensproblemen in zweiten, dritten
und soziale Orientierung ansteckend? Kooperatives und vierten Klassen der Allgemeinen Schule / M. Spilles, M.
von Jugendlichen mit Lernen als Katalysator Grosche, C. Huber, A. Bartling, G. Casale, K. Fussangel, K.
geistiger Behinderung: Ein der Ansteckung sozialer Gottfried, C. Gräsel, T. Hennemannm J. Kluge & K. Kaspar
Experiment zum Paradigma Kompetenz Unterscheidet sich der Einfluss der Sprachkontaktdauer auf
der Minimalen Gruppen C. Hank & C. Huber die Wortschatzleistungen zwischen simultan und sukzessiv
S. Egger, P. Nicolay, C. Huber mehrsprachigen Kindern? / B. Ehl & M. Grosche
& C. M. Müller Experimentelle Einzelfallstudien zur Förderung
N.N. Geschlechtsspezifische mathematischer Basisfähigkeiten und der Entwicklung von
Unterschiede bei Peereinfluss Mathematikangst bei Grundschulkindern / M. Balt
auf autistisches Verhalten Interkulturelle Entwicklung und Validierung eines
G. Nenniger & C. M. Müller Fragebogens zur Erfassung von Lehrkrafteinstellungen
zur traumasensitiven Pädagogik / G. Casale, J. Weber & F.
Was macht den Unterschied? Lehrkraftfeedback und
Linderkamp
Beobachten lernen in soziale Akzeptanz: Eine
Hamburg und Zürich Untersuchung sozialer Interventionen zur kurzfristigen Reduktion von
G. Ricken, J. Hilkenmeier, Referenzierungsprozesse auf Mathematikangst (State) – Erste empirische Befunde einer
S. Wenck, C. Henriksen, L. Dyaden Ebene experimentellen Studie mit Lehramtsstudierenden / L. Kuhr,
Toennissen & D. Hövel P. Nicolay, C. Huber, C. Hank & M. Balt, J. Bosch & J. Wilbert
M. Spilles Diagnose von Barrieren für autistische Schüler*innen in
inklusiven Schulen (schAUT) / S. Fuhrmann, L. Gerhard, J.
15.15 Session 1.2.1 – Poster Pitches (Raum 3.500) / Kleres, M. Knigge, V. Moser & S. Schwager
Chair: C. Zurbriggen & J. Goldan Schreibförderung von Jugendlichen mittels Strategietraining
und motivationaler Methoden / S. Hisgen & D. Vilz
Wirksamkeit einer evidenzbasierten Förderung
mathematischer Kompetenzen bei Schüler:innen mit
komorbiden Lern- und Verhaltensauffälligkeiten in der
Grundschule / M. Herzog & G. Casale
Das DYNAMIK Projekt - Dynamisches Testen als Perspektive
für förderdiagnostische Entscheidungen in der Schule /
M. Börnert-Ringleb, C. Mähler & J. Wilbert
„Wir sind doch ALLE ein bisschen behindert“ – Eine
quantitative Inhaltsanalyse der Verwendung des Begriffs
‚behindert‘ in Youtube-Videos und -Kommentaren /
M. Möhring, A. Röhm, C. Nellen, J. Jesk & M. R. Hastall16.30 –
17.30
Session 1.3.1 – Vorträge
(Raum 3.500) /
Session 1.3.2 – Short Pitches
(Raum 3.510) / Samstag, 6. November 2021
Chair: M. Tebbe Chair: A. Stöcker
Die Schulleitung als zentrale Entwicklung und Evaluation
Steuerungsfunktion – des Programms "Journey HAUPTTAGUNG / Tag 2
Schulleitungshandeln to Math" - ein adaptives
als Potenzial für Förderprogramm
Universität Luxemburg – Campus Belval – Maison du Savoir
Veränderungsprozesse an für mathematische
inklusiven Schulen Basiskompetenzen
9.00 – Session 2.1.1 – Session 2.1.2 – Session 2.1.3 –
10.30 Vorträge Vorträge Vorträge
N. Reinsdorf & A. Ehlert L. Wagner & A. Ehlert (Raum 3.500) (Raum 3.510) (Raum 3.190)
Narrative Persuasion Unterrichtliches Engagement Chair: J. Goldan Chair: A. Stöcker Chair: C. Hinni
durch Fabeln: Einfluss der und Störverhalten von
Moral und moralischer Grundschulkindern – eine Unterscheiden sich Ein Ratingverfahren When I go on the
Wertorientierungen des videobasierte Analyse von Lehrkräfte an inklu- zur Erfassung des mound, I don't
Publikums auf Einstellungen Zusammenhängen siven und nicht-inklu- Wissens von Regel- feel like I have a
und Verhaltensintentionen siven Grundschulen und Förderlehrkräf- learning disability:
N. Jansen & J. Decristan
gegenüber Minderheiten hinsichtlich ihrer Han- ten bezüglich Eine qualitative
dlungsintentionen bei der Förderung Studie über einen
C. Nellen, M. Möhring, J. A.
der Gestaltung adap- von Kindern mit Ex-Baseball-Profi mit
Finzi, A. Röhm, A. Biewener &
tiven Unterrichts? Rechenschwäche Dyslexie
M. R. Hastall
M. F. Löper, G. Görel & M. Wehren-Müller, S. M. Grünke & C.
EduMeta DB - Ideen zur F. Hellmich Luger, S. Schnepel, Klöpfer
Entwicklung einer Meta- M. Stöckli & E. Moser
Datenbank für die empirische Opitz
(Inklusions-)Forschung
Selbstabsorbiertes Auswirkungen Der Einfluss von
J. Bosch Verhalten bei Schüle- eines mehrkompo- Lautgebärden auf
rinnen und Schülern nentigen Motiva- die Entwicklung von
17:45 Gemeinsame Busfahrt vom Tagungsort zum mit einer geistigen tionssystems mit Graphem-Phonem-
Gesellschaftsabend Behinderung: Die Peer-Tutoring auf Korrespondenz
Rolle der individuellen die Automatisierung M. Tebbe
18:30 Apéro in der Brasserie du Cercle, Luxemburg Stadt und klassenkontex- von einstelligen Ad-
tuellen Kommunika- ditionsaufgaben bei
19:00 Abendessen in der Brasserie du Cercle, tionsfähigkeiten vier lernschwachen
Luxemburg Stadt V. Hofmann & C. M. Grundschüler*innen
Müller J. Karnes & I. GürcayZum Einfluss von
Regelverhalten und
Inklusion und
Beziehungsqualität
Gesundheitliche
Eignung von Donnerstag, 4. November 2021
Lehrkraftfeedback auf auf Sekundarstufe I Logopäd:innen: Was
die soziale Akzeptanz: R. Luder, G. Pastore heißt das?
Eine empirische & A. Kunz A. Rother & L.-J. Bur Pre-Conference
Analyse unter
Berücksichtigung von
Schulkind-Dyaden 13.30 – 15.30 Uhr (Raum 3.500)
M. Spilles, C. Huber,
A. Bartling, G. Casale, Workshop I – Intensive Longitudinal Methods
K. Fussangel, K. C. Zurbriggen
Gottfried, C. Gräsel &
M. Grosche Die Gruppe der intensiv längschnittlichen Methoden (ILM) sind «methods
for studying daily life» (Mehl & Conner, 2012), indem das Erleben, Verhalten
10.30- Pause mit Kaffee und Croissants (3. Stock) oder physiologische Vorgänge zeitnah im unmittelbaren Kontext untersucht
11.00 werden. Die Datenerhebung erfolgt dabei einmal oder mehrmals täglich über
eine oder mehrere Wochen hinweg im konkreten Lebensalltag. In Kombination
11.00 Session 3.1.1 – Vorträge Session 3.1.2 – Vorträge mit neuen mobilen Technologien eröffnen die ILM innovative Möglichkeiten
– (Raum 3.500) (Raum 3.510) der Datengewinnung und haben dadurch das Potenzial, wichtige Erkenntnisse
zu sonderpädagogisch relevanten Forschungsfragen zu liefern.
12.30 Chair: M. Tebbe Chair: M. Krischler
Trotz ihrer Eignung kommen die ILM in der sonderpädagogischen Forschung
Evaluation einer impliziten Ängstlich-depressive jedoch noch wenig zu Einsatz. Im Workshop werden zuerst die Grundideen
Rechtschreibförderung Verhaltensprobleme bei der ILM vorgestellt und anhand von Beispielen aus bisherigen und
M. Grosche, S. Dietz, M. Wissing, Jugendlichen. Eine empirische aktuellen Projekten verdeutlicht. Anschließend skizzieren wir gemeinsam
J. Decristan, K. Urton & M. Untersuchungsreihe zu Anwendungsfelder für den Einsatz der ILM in der sonderpädagogischen
Grünke Beurteilerdiskrepanzen in der Forschung (z.B. im Rahmen von Einzelfallstudien) und diskutieren
schulischen Diagnostik Herausforderungen und Lösungsmöglichkeiten.
S. Lüdeke & F. Linderkamp
Schreibflüssigkeit bei Die Bedeutung von Erfahrungen 16.00 – 18.00 Uhr (Raum 3.500)
Schülerinnen und für die Einstellungen von
Schülern mit und ohne Grundschulkindern gegenüber Workshop II – Social Media in der empirischen
Spracherwerbsstörung Peers mit emotional-sozialen sonderpädagogischen Forschung
J. Winkes & S. Berner-Nayer Schwierigkeiten im inklusiven C. Hinni & S. Veraguth
Unterricht
M. F. Löper, M. Lehofer, S. Schwab Social Media haben Einzug in nahezu allen Lebensbereichen gehalten. In der
& F. Hellmich (sonderpädagogischen) Forschung werden Social Media hingegen noch eher
zurückhaltend verwendet, obwohl eine offene und publikumsfreundliche
Änderungssensibilität und Sozial-emotionales Lernen und Kommunikation in der Wissenschaft im Zuge von open-access-Standards
Lernzuwachs bei Anwendung LRS seitens Forschungsförderorganisationen unterstützt oder gefordert wird.
einer Lernverlaufsdiagnostik D. Hövel, A. Schabmann, B. Webseiten und open-access-Publikationen sind inzwischen zu einem
im Bereich Addition und Gasteiger Klicpera, B. Schmidt, J. wichtigen oder verpflichtenden Bestandteil eines Forschungsprojekts
Subtraktion im Hunderterraum Plank, A. Krauss, L. Tönnissen, C. geworden. Doch welche Bedeutung haben Social Media für die öffentliche
S. Anderson, M. Schurig & M. Bär, C. Hoffmann Kommunikation? Und wie können Social Media für die sonderpädagogische
Gebhardt Forschung sinnvoll genutzt werden?
Im Workshop werden zum einen Social-Media-Varianten und Möglichkeiten
12.35 Verabschiedung & Ausblick nächste AESF-Tagungen
z.B. der Integration in Projektwebseiten kurz aufgezeigt, und zum anderen
(Raum 3.500)Freitag, 5. November 2021
deren Einsatz und Möglichkeiten diskutiert. Der Workshop richtet sich sowohl
an (potenzielle) Einsteiger*innen als auch (fortgeschrittene) Social-Media-
Nutzer*innen, aber auch an kritische Gegner*innen oder enthusiastische
Befürworter*innen, die beim Thema Social Media für die sonderpädagogische
Forschung produktiv mitdiskutieren und mitlernen möchten.
Haupttagung
13.30 – 15.00 Uhr
Session 1.1.1 – Vorträge (Raum 3.500) / Chair: Janka Goldan
Soziale Urteilstendenzen und soziale Orientierung von
Jugendlichen mit geistiger Behinderung: Ein Experiment zum
Paradigma der Minimalen Gruppen
S. Egger, P. Nicolay, C. Huber & C. M. Müller
Jugendliche mit geistiger Behinderung (GB) haben oft Schwierigkeiten,
die Feindseligkeit unbekannter Personen in uneindeutigen Situationen
einzuschätzen. Dies könnte dazu führen, dass Jugendliche mit GB nach
eindeutigen sozialen Urteilen streben (z.B. polarisierende Urteile), um ein
Bedürfnis nach Klarheit zu befriedigen. Zudem könnten sie in solchen
Situationen vermehrt soziale Hinweise nutzen, um sich Orientierung
zu verschaffen. Ziel dieser Studie war es, einerseits zu untersuchen, wie
polarisierend Jugendliche mit GB soziale Urteile treffen. Andererseits war
von Interesse, inwieweit sich Jugendliche mit GB an einer Eigengruppe von
Gleichaltrigen orientieren, wenn gleichzeitig widersprüchliche Meinungen
einer Eigengruppe und einer Fremdgruppe von Gleichaltrigen erkennbar sind.
Es wurde ein computergestütztes Experiment auf der Grundlage des
Paradigmas der Minimalen Gruppen entwickelt und mit Jugendlichen mit
GB (N=34; M=14.89 Jahre, SD=1.41), Kindern desselben mentalen Alters (N=34,
M=7.93 Jahre, SD=.64) und Jugendlichen ohne GB (N=34; M=14.68 Jahre,
SD=1.15) durchgeführt.
Jugendliche mit GB zeigten stärker polarisierende soziale Urteile und eine
grössere Empfänglichkeit für den Einfluss einer unbekannten Eigengruppe
von Gleichaltrigen als Jugendliche ohne GB (pWas macht den Unterschied? Beobachten lernen in Hamburg Ansteckungsprozesse für die Förderung prosozialen Verhaltens zu nutzen
und Zürich (Busching & Krahé, 2020). Kooperatives Lernen wird als eine Unterrichtsform
diskutiert, die soziale Kompetenzen erfordert (Johnson & Johnson, 2002) und
G. Ricken, J. Hilkenmeier, S. Wenck, C. Henriksen, L. Toennissen & D. Hövel somit Situationen evoziert, in denen Schülerinnen und Schülern mehr Modelle
Das Beobachten von Unterrichtssituationen als situationsspezifische Fähigkeit und somit Ansteckungsmöglichkeiten geboten werden.
ist eine zentrale diagnostische Kompetenz für Lehrkräfte in inklusiven Dieser Beitrag untersucht zunächst, ob Kinder mit geringen sozialen
Lehr- und Lernsettings. Insbesondere das Erkennen von potentiellen Kompetenzen in sozial kompetenteren Gruppen von der Gruppenkompetenz
Lernbarrieren ist eine Voraussetzung dafür, dass Lernangebote von allen profitieren können. Zum Anderen widmet er sich der Frage, ob der Prozess
Lernenden gleichermaßen genutzt werden können. Solche Lernbarrieren sozialer Ansteckung durch Kooperatives Lernen zusätzlich unterstützt werden
können in individuellen Bedingungen von Schülerinnen und Schülern kann.
liegen, in schlechten Raumbedingungen, in erschwerter Zugänglichkeit In einer längsschnittlichen Interventionsstudie mit N = 889 SuS (N = 39
von Lernangeboten oder in der Gestaltung der Lehr-Lernsituation, wenn Klassen) wurde die Ansteckung sozialer Kompetenzen untersucht. In
Maßnahmen der Klassenführung und Lernunterstützung nicht ausreichend der Interventionsgruppe wurde über vier Wochen tägliche eine Einheit
umgesetzt werden. Gerade die Umsetzung solcher Unterrichtsmerkmale ist Kooperativen Lernens durchgeführt. Die Ergebnisse werden in den aktuellen
situativ unterschiedlich und kann durch Lehrkräfte beeinflusst werden, so Forschungsstand eingeordnet und die Nutzbarkeit für die Praxis diskutiert.
dass eine Sensibilität zur Beobachtung dieser ein zentrales Lernziel in der
Lehramtsausbildung darstellen sollte. Literatur
Zur Förderung dieser Beobachtungskompetenz wurde ein Seminarkonzept Bornstein, M. H., Hahn, C.‑S. & Haynes, O. M. (2010). Social competence,
entwickelt, welches drei wesentliche Bausteine beinhaltet: 1. Vermittlung externalizing, and internalizing behavioral adjustment from early childhood
deklarativen Wissens zu den Inhaltsbereichen „Beobachtung“ sowie through early adolescence: developmental cascades. Development and
„Merkmale guten Unterrichts“, 2. Anwendung und Reflektion des erworbenen Psychopathology, 22(4), 717–735. https://doi.org/10.1017/S0954579410000416
Wissens durch die Beobachtung von Unterrichtsvideos. In mehreren Busching, R. & Krahé, B. (2020). With a Little Help from Their Peers: The Impact
Durchgängen werden systematisch jene Indikatoren herausgearbeitet, die in of Classmates on Adolescents' Development of Prosocial Behavior. Journal of
Teams eine hohe Urteilerübereinstimmung erreichen. 3. erfolgt ein Transfer der Youth and Adolescence, 49(9), 1849–1863. https://doi.org/10.1007/s10964-020-
erworbenen Beobachtungskompetenz auf die Indikatoren, die Lernbarrieren 01260-8
enthalten können. Studierende üben mit unterschiedlich gestalteten Johnson, D. W. & Johnson, R. T. (2002). Learning together and alone. Overview
Textvignetten Barrieren zu identifizieren. and meta‐analysis. Asia Pacific Journal of Education, 22(1), 95–105. https://doi.
In einer Kooperation zwischen der Universität Hamburg (UHH) und der org/10.1080/0218879020220110
Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) Zürich werden
Seminarbausteine gemeinsam erprobt.
Nach einer Pilotierung im Wintersemester 2021/22 in Zürich wird für das Geschlechtsspezifische Unterschiede bei Peereinfluss auf
Sommersemester eine vergleichende Studie geplant, mit der der Frage autistisches Verhalten
nachgegangen werden soll, welche Seminaranteile besonders wirksam sind, G. Nenniger & C. M. Müller
um Beobachtungskompetenzen von Studierenden zu entwickeln.
Über die Peersozialisation bei Personen mit Autismus-Spektrum-Störung
(ASS) ist wenig bekannt. Es wurde daher untersucht, inwiefern Kinder
13.30 – 15.00 Uhr und Jugendliche mit einer hohen Ausprägung an autistischem Verhalten
an Förderschulen durch die von ihnen besonders gemochten Peers in
Session 1.1.2 – Vorträge (Raum 3.510) / Chair: Mireille Krischler ihrem autistischen Verhalten beeinflusst werden. Zudem wurde der
Ist soziale Kompetenz ansteckend? Kooperatives Lernen als Frage nachgegangen, inwiefern sich Mädchen und Knaben mit hoher
Katalysator der Ansteckung sozialer Kompetenz Ausprägung autistischen Verhaltens in ihrer Empfänglichkeit für Peereinfluss
unterscheiden.
C. Hank & C. Huber
Im Rahmen einer Fragebogenstudie (Teilprojekt von KomPeers) gaben
Die Bedeutung sozialer Kompetenzen für schulischen Erfolg und psychische Mitarbeitende an Schweizer Förderschulen zu zwei Messzeitpunkten Auskunft
Gesundheit sind hinreichend untersucht worden (Bornstein, Hahn & Haynes, über die Verhaltensprobleme und die adaptiven Kompetenzen von 1125
2010). Gerade im Kontext Schule scheint es die Möglichkeit zu geben, soziale Schülerinnen und Schülern mit geistiger Behinderung. Um die Ausprägungautistischen Verhaltens zu erfassen, wurde der Autismus-Algorithmus 15.15 Uhr
der Developmental Behavior Checklist angewandt. Dabei wurden 330
Schülerinnen und Schüler (Alter T1 M=10,17 Jahre, SD=3,74; weiblich=20.6 %) mit Session 1.2.1 – Poster Pitches (Raum 3.500) / Chair: Carmen
einer hohen Ausprägung an autistischem Verhalten und schwachen adaptiven Zurbriggen & Janka Goldan
Kompetenzen identifiziert. Die Daten dieser 330 Schülerinnen und Schüler und
deren besonders gemochten Peers wurden analysiert.
Mehrebenenanalysen zeigten, bezogen auf die Gesamtgruppe (N=330), keinen 15.30 – 16.30 Uhr
Einfluss des autistischen Verhaltens der besonders gemochten Peers (T1) auf
das zukünftige individuelle autistische Verhalten (T2) der Schülerinnen und Postergalerie (Raum 3.190)
Schüler. Dieser Peereffekt wurde jedoch signifikant durch das Geschlecht Die soziale Integration von Schülerinnen und Schülern mit
moderiert, was darauf hindeutet, dass Mädchen mit hoher Ausprägung
externalisierenden Verhaltensproblemen in zweiten, dritten
autistischen Verhaltens, jedoch nicht Knaben, für Peereinfluss empfänglich
sind. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf das Verständnis der Entwicklung und vierten Klassen der Allgemeinen Schule
von ASS im Peerkontext diskutiert. M. Spilles, M. Grosche, C. Huber, A. Bartling, G. Casale, K. Fussangel, K.
Gottfried, C. Gräsel, T. Hennemannm J. Kluge & K. Kaspar
Lehrkraftfeedback und soziale Akzeptanz: Eine Untersuchung Positive soziale Beziehungen zu Gleichaltrigen im Kindes- und Jugendalter
sozialer Referenzierungsprozesse auf Dyaden Ebene sind essentiell für das Wohlbefinden, die Identitätsbildung sowie für
die soziale und kognitive Entwicklung. Internationale und nationale
P. Nicolay, C. Huber, C. Hank & M. Spilles Untersuchungen zeigen jedoch, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler
Ausgehend von der sozialen Referenzierungstheorie konnten in den letzten in ihren Klassen gleichermaßen sozial integriert sind. Insbesondere Kinder
Jahren mehrere experimentelle (u.a. Huber et al. 2018; Nicolay & Huber, 2021) und Jugendliche externalisierenden Verhaltensproblemen werden in
und längsschnittliche Studien (u.a. Wullschleger et al., 2020) zeigen, dass inklusiven Settings von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern oftmals
öffentliches Lehrkraftfeedback einen Einfluss auf die soziale Akzeptanz von wenig sozial akzeptiert, was nicht nur problematisch im Hinblick auf deren
Schüler*innen hat. Das angenommene Wirkmodell geht dabei davon aus, Wohlbefunden und Entwicklung ist, sondern ebenfalls in Widerspruch zu
dass Schüler*innen das Feedbackverhalten von Lehrkräften gegenüber ihren den Zielen der UN-Behindertenrechtskonvention steht. Im aktuellen Beitrag
Mitschüler*innen beobachten und daraus Rückschlüsse auf die Haltung der werden Querschnittsdaten des PARTI-Projekts zur sozialen Integration von
Lehrkräfte gegenüber diesen Mitschüler*innen ziehen, die sie wiederum Schülerinnen und Schülern mit externalisierenden Verhaltensproblemen
in ihrer eignen Haltung gegenüber diesen Mitschüler*innen beeinflusst. in zweiten, dritten und vierten Klassen der Allgemeinen Grundschule
Methodisch besteht in den bisher vorliegenden Studien das Problem, dass analysiert (n = 626). Im Vergleich zu bisherigen Studien der letzten Dekade
durch die Operationalisierung von Feedback in Experimentalstudien bzw. in Deutschland wurden hierbei Verhaltensprobleme durch ein validiertes
die Beobachtung von Lehrkraftfeedback in Feldstudien, die unterschiedliche und schulrelevantes Erhebungsinstrument erfasst. Darüber hinaus wurde
Wahrnehmung dieses Feedbacks durch beobachtende Schüler*innen nicht die soziale Integration anhand der vier Dimensionen nach Koster et al.
berücksichtigt werden kann. (2009) operationalisiert, was bisher in deutschen Untersuchungen kaum
vorgenommen wurde. In den Ergebnissen zeigt sich, dass vor allem die
Im vorliegenden Beitrag soll vor diesem Hintergrund mit Hilfe der Daten
soziale Akzeptanz negativ mit externalisierenden Verhaltensproblemen
einer Querschnittserhebung an 127 Schüler*innen aus 8 Schuklassen
zusammenhängt. Im Hinblick auf Probleme im lernförderlichen Verhalten
methodisch ein anderer Ansatz verfolgt werden. Mit Hilfe von Cross-
scheinen die Jahrgangsstufenzugehörigkeit und das klassenspezifische
Classified Mehrebenenmodellen werden soziale Referenzierungsprozesse
Ausmaß an Verhaltensproblemen den Zusammenhang zu moderieren.
auf Ebene von Schüler*innen-Dyaden (n = 1664) modelliert. Dies ermöglicht
den Zusammenhang zwischen dem individuell von Schüler*innen
wahrgenommenem Lehrkraftfeedback gegenüber Mitschüler*innen und der
diesen entgegengebrachten sozialen Akzeptanz zu untersuchen. In einem
zweiten Schritt wird darüber hinaus in den Blick genommen, inwieweit
dieser Zusammenhang zwischen wahrgenommenem Feedback und sozialer
Akzeptanz durch die Beziehung zu Lehrkraft moderiert wird.Unterscheidet sich der Einfluss der Sprachkontaktdauer auf wurden dreimal pro Woche für jeweils 30min mit dem computergestützten
die Wortschatzleistungen zwischen simultan und sukzessiv Lernspiel „Meister Cody - Talasia“ gefördert. Während der Förderphase
sowie zwei Wochen davor (insgesamt 8 Wochen) wurde der mathematische
mehrsprachigen Kindern? Lernfortschritt sowie die Mathematikangst (State) etwa zweimal pro Woche
B. Ehl & M. Grosche mit Kurztests erfasst. Darüber hinaus wurden Mathematikleistung und -angst
(Trait) zu Beginn und am Ende der Untersuchung erhoben. Zudem erfolgte
Ein Ansatz in der Sprachdiagnostik bei Mehrsprachigkeit besteht darin, die
eine kurze Befragung der Mathematiklehrkräfte zu besonderen Ereignissen im
Sprachleistungen in der Umgebungssprache anhand separater Normen für Unterricht (z.B. Klassenarbeiten, Unterrichtsausfall). Auf dem Poster werden die
mehrsprachige Kinder auszuwerten. Für sukzessiv mehrsprachige Kinder, d. h. Ergebnisse der Untersuchung präsentiert.
mit einem Erwerbsbeginn zur Zweitsprache ab drei Jahren, wird es als „sehr
gut“ (Neugebauer & Becker-Mrotzek, 2015, S. 36) bewertet, wenn Altersnormen
zusätzlich nach der Sprachkontaktdauer gegliedert angegeben sind. Bei Interkulturelle Entwicklung und Validierung eines
simultan mehrsprachigen Kindern kann der Sprachkontakt ab der Geburt Fragebogens zur Erfassung von Lehrkrafteinstellungen zur
beginnen oder auch erst kurz vor dem Alter von drei Jahren. Daher könnte die traumasensitiven Pädagogik
Sprachkontaktdauer auch für simultan mehrsprachige Kinder ein sinnvoller
Bestandteil von separaten Normen sein. Die Studie ging der Frage nach, G. Casale, J. Weber & F. Linderkamp
ob sich der Einfluss der Sprachkontaktdauer auf die Wortschatzleistungen Die Lehrkrafteinstellungen zur traumasensitiven Pädagogik stellen ein
zwischen simultan und sukzessiv mehrsprachigen Kindern unterscheidet. zentrales Konstrukt in der Erforschung traumasensitiver sonderpädagogischer
Eine schrittweise lineare Regressionsanalyse bei 451 mehrsprachigen Arbeit dar. Im deutschsprachigen Raum existieren allerdings bislang
Grundschulkindern (271 simultan, 180 sukzessiv) zeigte, dass nach der Kontrolle keine Erhebungsinstrumente, die die Einstellungen von Lehrkräften zur
des Alters die Kontaktjahre zu Deutsch auch bei simultan mehrsprachigen traumasensitiven Pädagogik psychometrisch hochwertig erfassen. Die in den
Kindern (ß = .24, p = .001) - ebenso wie bei sukzessiv mehrsprachigen Kindern USA bewährte ATTITUDES RELATED TO TRAUMA-INFORMED CARE SCALE
(ß = .25, p = .030) - einen bedeutsamen Einfluss auf die Wortschatzleistungen (ARTIC) ist ein Forschungsinstrument, das die traumabezogenen Einstellungen
in Deutsch hatten. Die Varianzaufklärung durch die beiden Prädiktoren betrug von Lehrkräften in der traumasensitiven Arbeit erfasst. Das Instrument hat
bei simultan mehrsprachigen Kindern 33% und bei sukzessiv mehrsprachigen 45 Items, die sich auf insgesamt sieben Faktoren (Ursachen von Trauma,
Kindern 42%. Die Vorhersage der Wortschatzleistungen ließ sich durch die Reaktionen auf Problemverhalten traumatisierter Schüler*innen, Empathie
Kontaktjahre zu Deutsch bei simultan mehrsprachigen Kindern um 3% & Kontrolle, Selbstwirksamkeit, Reaktionen zur traumasensitiven Arbeit,
steigern (p = .001) und bei sukzessiv mehrsprachigen Kindern um 2% (p = persönliche Unterstützung, systemweite Unterstützung) verteilen. In einer
.027). Diese Steigerung unterschied sich nicht signifikant (z = 0.275, p = .392). interkulturellen Entwicklungs- und Validierungsstudie wird der Fragebogen
Demnach kann die Sprachkontaktdauer auch für simultan mehrsprachige durch Vor- und Rückübersetzungstechniken ins Deutsche übersetzt, anhand
Kinder ein sinnvoller Bestandteil von separaten Normen sein. von kognitiven Interviews inhaltlich validiert und überarbeitet sowie in einer
deutschsprachigen Stichprobe von ca. 400 Lehrkräften hinsichtlich der
Literatur faktoriellen Validität, der Konstruktvalidität, der internen Konsistenz und
Neugebauer, U. & Becker-Mrotzek, M. (2015). Gütemerkmale von 21 der Test-Retest-Reliabilität überprüft. Auf dem Poster sollen vor allem der
Sprachstandsverfahren im Elementarbereich. In G. Esser, M. Hasselhorn & W. Fragebogen, das methodische Vorgehen sowie erste Ergebnisse aus den
Schneider (Hrsg.), Diagnostik im Vorschulalter (S. 19–42). Göttingen: Hogrefe. kognitiven Interviews präsentiert und diskutiert werden.
Experimentelle Einzelfallstudien zur Förderung Interventionen zur kurzfristigen Reduktion von
mathematischer Basisfähigkeiten und der Entwicklung von Mathematikangst (State) – Erste empirische Befunde einer
Mathematikangst bei Grundschulkindern experimentellen Studie mit Lehramtsstudierenden
M. Balt L. Kuhr, M. Balt, J. Bosch & J. Wilbert
Als eine mögliche Ursache von Mathematikangst werden Schwierigkeiten im Trotz uneinheitlicher Kriterien zur Abgrenzung einer relevanten Ausprägung
Erwerb mathematischen Basisfähigkeiten diskutiert. Mittels experimenteller von Symptomen weisen internationale Forschungsbefunde in Bezug auf
Einzelfallstudien wurde der Effekt der Förderung mathematischer Mathematikangst auf hohe Prävalenzraten von 17% (Ashcraft & Moore, 2009)
Basisfähigkeiten auf die Entwicklung von Mathematikangst bei sechs über 30% (OECD, 2004) bis 68% (Betz, 1978) hin. Aus diesem Grund wurde
Grundschulkindern im Alter zwischen 7 und 9 Jahren untersucht. Die Kinder der Zusammenhang zwischen Mathematikangst und Mathematikleistungvielfach in der Literatur untersucht und als wechselseitig wirkend beschrieben von PISA 2003. Paris: OECD. https://www.oecd.org/education/school/
(Carey et al., 2016). In diesem Zusammenhang werden in der Literatur zwei programmeforinternationalstudentassessmentpisa/34474315.pdf
wesentliche Mechanismen angegeben, die sowohl Mathematikleistung Park, D., Ramirez, G., & Beilock, S. L. (2014). The role of expressive writing in
als auch die Mathematikangst beeinflussen, dies sind vor allem math anxiety. Journal of Experimental Psychology: Applied, 20(2), 103–111.
mathematikbezogene physiologische Erregung (Mattarella-Micke et al., 2011) https://doi.org/10.1037/xap0000013
und mathematikbezogene Sorgen (Ramirez et al., 2018).
Ramirez, G., Gunderson, E. A., Levine, S. C., & Beilock, S. L. (2013). Math Anxiety,
In der vorliegenden Studie werden daher einerseits die Wirkungen der Working Memory, and Math Achievement in Early Elementary School. Journal
Atementspannung (Mattarella-Micke et al., 2011) und der kognitiven of Cognition and Development, 14(2), 187–202. https://doi.org/10.1080/15248372.2
Neubewertung als Interventionen, die auf die physiologische Erregung 012.664593
(Johns et al., 2008) abzielen, untersucht; andererseits wird die Wirkung des
Ramirez, G., Shaw, S. T., & Maloney, E. A. (2018). Math anxiety: Past research,
expressiven Schreibens als Intervention, die die mathematikbezogener Sorgen
promising interventions, and a new interpretation framework. Educational
adressiert (Park et al., 2014), betrachtet. Die vorliegende Studie setzt sich
Psychologist, 53(3), 145–164. https://doi.org/10.1080/00461520.2018.1447384
dabei zum Ziel in einer konkreten mathematischen Anforderungssituation
die kurzzeitigen Effekte dieser bekannten Interventionen auf die
empfundene Mathematikangst (Fragebogen STAI (Laux et al., 1981)) sowie Diagnose von Barrieren für autistische Schüler*innen in
die Mathematikleistung (Prozent richtig gelöster arithmetischer Aufgaben
konzipiert in Anlehnung an (Ramirez et al., 2013) zu testen.
inklusiven Schulen (schAUT)
Die experimentelle Untersuchung ist als Online-Studie für S. Fuhrmann, L. Gerhard, J. Kleres, M. Knigge, V. Moser & S. Schwager
Lehramtsstudierende konzipiert und umfasst eine Stichprobe von N= 145 Das BMBF-geförderte Forschungsprojekt Diagnose von Barrieren
Probanden, die randomisiert und annähernd gleichmäßig auf die drei für autistische Schüler*innen in inklusiven Schulen (schAUT) ist ein
Interventionsbedingungen sowie eine Kontrollbedingung verteilt sind (N= 34 partizipatorisches Vorhaben zwischen der Humboldt-Universität Berlin, der
bis N= 38). Goethe-Universität Frankfurt und dem Verein White Unicorn e.V. Es zielt
Im Rahmen des Posters werden erste Ergebnisse präsentiert. darauf, eine bebilderte Fragebogenerhebung zu entwickeln, die auf mehreren
Befragungen in der autistischen Community basiert, um mögliche Barrieren
Literatur in Bezug auf das Lernen und das Schulleben bei Schüler:innen zu erheben.
Ashcraft, M. H., & Moore, A. M. (2009). Mathematics anxiety and the affective Entwickelt werden soll damit ein Barrieretool, das geeignet ist, in einem
drop in performance. Journal of Psychoeducational Assessment, 27(3), 197–205. schlanken, alltagstauglichen Verfahren subjektiv empfundene Barrieren
https://doi.org/10.1177/0734282908330580 und ableitbare Hinweise für die Gestaltung angepasster Lernumgebungen
zu ermitteln. Validiert wird dieses Tool in Erhebungen in schulischen
Betz, N. E. (1978). Prevalence, distribution, and correlates of math anxiety in
Transitionsphasen (Eintritt Grundschule, Eintritt weiterführende Schule)
college students. Journal of Counseling Psychology, 25(5), 441–448. https://doi.
mit jeweils 1.600 Schüler_innen in drei bis vier deutschen Bundesländern zu
org/10.1037/0022-0167.25.5.441
zwei Messzeitpunkten. Das Diagnosetool inkl. einer Nutzungshandreichung
Carey, E., Hill, F., Devine, A., & Szücs, D. (2016). The chicken or the egg? The wird in einer Fachkonferenz mit einer Gruppe international renommierter
direction of the relationship between mathematics anxiety and mathematics Expert:innen weiterentwickelt und in Fortbildungsveranstaltungen für
performance. Frontiers in Psychology, 6. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01987 Lehrkräfte erprobt. Es versteht sich als ein inklusives Schulentwicklungstool im
Johns, M., Inzlicht, M., & Schmader, T. (2008). Stereotype threat and executive Sinne der Herstellung von Verfügbarkeit, Zugänglichkeit, Anpassungsfähigkeit
resource depletion: Examining the influence of emotion regulation. Journal und Akzeptanz der einzelnen Schule (Tomaševski 2001).
of Experimental Psychology: General, 137(4), 691–705. https://doi.org/10.1037/ Das Projekt schAUT ist als interdisziplinäres und partizipatorisches,
a0013834 international vernetztes Forschungsprojekt konzipiert, das theoretisch auf den
Laux, L., Glanzmann, P., Schaffner, P., & Spielberger, C. D. (1981). Das State-Trait- aktuellen Befunden der Neurodiversitätsforschung basiert.
Angstinventar (1.). Hogrefe. Das Poster präsentiert das Forschungsdesign, die Erhebungsinstrumente
Mattarella-Micke, A., Mateo, J., Kozak, M. N., Foster, K., & Beilock, S. L. (2011). sowie erste Befunde.
Choke or thrive? The relation between salivary cortisol and math performance
depends on individual differences in working memory and math-anxiety.
Emotion, 11(4), 1000–1005. https://doi.org/DOI: 10.1037/a0023224
OECD. (2004). Lernen für die Welt von morgen: Erste ErgebnisseSchreibförderung von Jugendlichen mittels Strategietraining auch Verhaltensauffälligkeiten wie Aufmerksamkeitsstörungen oder
und motivationaler Methoden Angststörungen (Visser et al., 2020). In Kontrollgruppenstudien konnten
positive Effekte gezielter Interventionen auf die mathematische
S. Hisgen & D. Vilz Kompetenzentwicklung nachgewiesen werden. Spezifische
Wirksamkeitsanalysen bei komorbid auftreten Auffälligkeiten in Mathematik
Risikobelastete Jugendliche benötigen aufgrund ihrer schwachen
und im Verhalten fehlen bislang, sind allerdings wichtig, um mögliche
Leistungen im kompositorischen Schreiben gezielte Unterstützung,
Modifikationen der Interventionen abzuleiten.
um sowohl am schulischen Alltag teilnehmen zu können als auch auf
dem Arbeitsmarkt konkurrenzfähig zu sein. Der Einsatz motivationaler Um zu prüfen, wie die mathematische Kompetenzentwicklung von
Schreibstrategieförderungen stellt eine erfolgsversprechende Fördermethode Kindern mit Lern- und Verhaltensauffälligkeiten durch evidenzbasierte
dar (Hisgen et al., 2021). In der vorliegenden Untersuchung wurden Förderprogramme beeinflusst wird und welche Interaktionen zwischen
mittels Experimentalgruppendesign die Effekte einer motivationalen Kompetenzentwicklung und Verhalten bestehen, wird eine kontrollierte
Schreibförderung auf die Quantität und Qualität der Aufsätze von Einzelfallstudie mit multiplem Baseline-Design vorgestellt. N=8 Kinder mit
Lernenden eines Berufskollegs (n=35) untersucht. Die Experimentalgruppe Rechenschwierigkeiten und komorbid auftretenden internalisierenden und
erhielt über einen Zeitraum von sechs Wochen ein motivationales externalisierenden Verhaltensstörungen werden in einem ABAB-Design
Schreibtraining. Hierbei kam eine, aus dem angloamerikanischen adaptierte, gefördert. Die Förderung beginnt zeitversetzt nach 2 bis 5 Wochen Baseline-
Schreibstrategieförderung - STOP und START (original Stop & Dare) zum Phase. In allen Phasen werden dabei die Mathematikleistungen sowie die
Einsatz. Die auf dem „Self-Regulated Strategy Development“ (SRSD) Verhaltensauffälligkeiten mittels Verlaufsdiagnostik erfasst. Nach der Baseline
basierende Strategie unterstützt die Jugendlichen bei der Planung und dem ohne Intervention (A-Phase, mind. 2 Wochen) werden die Kinder zunächst mit
Verfassen von argumentativen Texten (Hayes & Flower, 1980; Hisgen et al., einem evidenzbasierten Mathematikförderprogramm gefördert (B-Phase, 3
2020). Die Messungen der abhängigen Variablen erfolgte durch Prä-, Post- und Wochen), worauf A-Phase,3( Wochen) sowie eine zweite B-Phase (3 Wochen)
Follow up Messungen. Sowohl in der Post-, als auch in der Follow up Messung folgen.
zeigen sich signifikante Unterschiede zugunsten der Experimentalgruppe. Die Daten der Einzelfallstudien sollen regressionsbasiert für jedes einzelne
Kind sowie mehrebenenanalytisch über alle Kinder ausgewertet werden.
Literatur Wir erwarten bei allen Schüler:innen einen kontinuierlichen Anstieg der
Hisgen, S., Klöpfer, C., Karnes, J., & Grünke, M. (2021). Fachbeitrag: Die Einflüsse Mathematikleistungen über die B-Phasen (signifikante Slope-Effekte).
motivierender Methoden auf das Verfassen von Texten von Schüler/innen Außerdem erwarten wir einen signifikanten Interaktionseffekt zwischen den
der Sekundarstufe mit Förderschwerpunkt Lernen. Vierteljahresschrift für Verhaltensauffälligkeiten der Schüler*innen und den Mathematikleistungen
Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete. in den B-Phasen. Die Ergebnisse der Studie sollen differenziertere Einblicke
Hisgen, S., Barwasser, A., Wellmann, T., & Grünke, M. (2020). The Effects in die Wirksamkeit von Mathematikinterventionen bei Kindern mit
of a Multicomponent Strategy Instruction on the Argumentative Writing komorbiden Lern- und Verhaltensauffälligkeiten geben und Implikationen für
Performance of Low-Achieving Secondary Students. Learning Disabilities: A Fördermodifikationen liefern.
Contemporary Journal, 18(1), 93-110.
Hayes, J. R., & Flower, L. S. (1980). Identifying the organisation of writing
processes. In L. W. Gregg, & E. R.; Steinberg (Eds.), Cognitive processes in Das DYNAMIK Projekt - Dynamisches Testen als Perspektive
writing (pp. 3–30). Lawrence Erlbaum. für förderdiagnostische Entscheidungen in der Schule
M. Börnert-Ringleb, C. Mähler & J. Wilbert
Wirksamkeit einer evidenzbasierten Förderung Testdiagnostische Zugänge werden im Rahmen einer förderdiagnostischen
mathematischer Kompetenzen bei Schüler:innen mit Debatte für eine fehlende Ableitbarkeit von Aussagen zu Potentialen und
benötigter Unterstützung kritisiert. In diesem Zusammenhang kann der
komorbiden Lern- und Verhaltensauffälligkeiten in der Ansatz des dynamischen Testens eine vielversprechende Innovation im
Grundschule förderdiagnostischen Prozess darstellen. Im Zuge des dynamischen Testens
M. Herzog & G. Casale wird durch die Verbindung von Messung und Förderung versucht, Einblicke
in die Problemlöseprozesse von Kindern zu erhalten und Lernpotentiale zu
Schwierigkeiten beim Erwerb basaler Kompetenzen im Lernbereich identifizieren.
Mathematik betreffen beinahe eins von fünf Kindern in Deutschland
Das Poster gibt Einblicke in ein aktuelles Forschungsprojekt („DYNAMIK“), in
(OECD, 2019). Beinahe die Hälfte dieser Schüler:innen zeigt zudemwelchem das Konzept des dynamischen Testens im Rahmen der Erfassung 16.30 – 17.30 Uhr
des Rechnens angewendet und untersucht wird, inwiefern das dynamische
Testen Vorzüge gegenüber traditionellen Zugängen im Hinblick auf die Session 1.3.1 – Vorträge (Raum 3.500) / Chair: Marc Tebbe
Gestaltung von Förderempfehlungen hat. Im Rahmen der Postervorstellung Die Schulleitung als zentrale Steuerungsfunktion –
werden die unterschiedlichen Projektschritte skizzert: Zunächst sollen
ausgewählte Lehrkräfte mit Bezug auf ein im Projekt entwickeltes
Schulleitungshandeln als Potenzial für Veränderungsprozesse
dynamisches Testinstrument fortgebildet werden. Daran anschließend wird an inklusiven Schulen
in einem experimentellen Kontrollgruppendesign untersucht, inwiefern N. Reinsdorf & A. Ehlert
es den im dynamischen Testen geschulten Fachkräften besser gelingt,
Förderempfehlungen auf Grundlage selbst erfasster Informationen über Seit der Umsetzung einer inklusiven Beschulung (KMK, 2011) werden
ausgewählte lernschwache SchülerInnen im Rahmen eines Fördergutachtens Schulleitungen dazu aufgefordert, Strukturen und Verbindlichkeiten in
auszusprechen.Die zentralen Fragestellungen des Projektes werden der Einzelschule zu schaffen, die es interdisziplinären Teams bestehend
vorgestellt. aus Lehrpersonen und Sonderpädagogen*innen ermöglichen, Kinder und
Jugendliche mit und ohne Behinderung gemeinsam zu unterrichten (UN-
BRK, 2018). Insbesondere die Initiierung geeigneter Kooperationsstrukturen
„Wir sind doch ALLE ein bisschen behindert“ – Eine gilt als Potenzial der Schulleitung für Veränderungsprozesse im Unterricht
quantitative Inhaltsanalyse der Verwendung des Begriffs (Arndt & Werning, 2016; Badstieber & Amrhein, 2021). Mit welchen Maßnahmen
‚behindert‘ in Youtube-Videos und -Kommentaren es der Schulleitung gelingen kann, die Kooperation in interdisziplinärer
Teams zu unterstützen, wurde bislang kaum untersucht (Brauckmann,
M. Möhring, A. Röhm, C. Nellen, J. Jesk & M. R. Hastall Pashiardis, & Ärlestig, 2020). Die vorliegende Interventionsstudie setzt
Sprache ist das wichtigste Element der Informationsvermittlung, wirkt sich auf an diesem Desiderat an. Zur Untersuchung von möglichen Potentialen
unser Denken aus und trägt zur Konstruktion unserer sozialen Wirklichkeit bei durch Handlungsentscheidungen der Schulleitungen bei der Entwicklung
(z. B. Radtke, 2006). Aus diesem Grund ist es nahliegend, dass Sprache auch von geeigneten Kooperationsstrukturen, wurden interdisziplinäre Teams
eine entscheidende Rolle für die Wahrnehmung von und Kommunikation über aus Lehrpersonen und Sonderpädagogen*innen implementiert und in
Behinderung innerhalb einer Gesellschaft spielt (z. B. Ford, Acosta & Sutcliffe, wöchentlichen Teammeetings wissenschaftlich begleitet.
2013). Für junge Menschen stellen insbesondere soziale Medien wie Youtube In einer quasi-experimentellen Interventionsstudie wurden die teilnehmenden
eine wichtige Informationsquelle und Kommunikationsplattform dar (Kolotaev Schulleitungen (N=3) mittels (Experten-)Interviews am Ende des
& Kollnig, 2020). In Deutschland liegen bislang kaum Studien zur Verwendung Schuljahres zu ihren Handlungsentscheidungen im Kontext entwickelter
des Begriffs „behindert“ in medialen Kontexten vor. Ausgehend von einer US- Kooperationsstrukturen befragt.
amerikanischen Untersuchung zur Verwendung des Begriffs „retarded“ auf
Die ersten Ergebnisse zeigen, dass die Schulleitungen von unterschiedlichen
Youtube (Johanson-Sebera & Wilkins, 2010) wurde daher in der vorliegenden
Handlungsentscheidungen berichten. So können durch die Aussagen
Studie untersucht, wie der Begriff „behindert“ in deutschsprachigen Youtube-
der Schulleitung E1 der Experimentalschulen, klare Erwartungen an die
Videos und -Kommentaren genutzt wird. Basierend auf Erkenntnissen einer
Lehrpersonen, Möglichkeiten zur professionellen Fort- und Weiterbildung
Studie von Weisser (2005) wurde insbesondere vermutet, dass „behindert“
sowie einen regelmäßigen Austausch über die Unterrichtspraxis
in den seltensten Fällen im (neutralen) terminologisch-beschreibenden
aufgezeigt werden. Demgegenüber berichtet die Schulleitung E2 der
Sinne verwendet wird. Mithilfe einer quantitativen Inhaltsanalyse wurden
Experimentalschulen über vorhandene Strukturen, die jedoch von den
516 Youtube-Videos anhand eines zuvor entwickelten und validierten
interdisziplinären Teams kaum genutzt werden.
Codebuchs analysiert. Es wurden anschließend der Kontext der
Begriffsverwendung (mit oder ohne Behinderungsbezug) sowie der Tenor (z. Literatur
B. terminologisch-beschreibende oder stigmatisierende Begriffsverwendung)
Arndt, A.‑K., & Werning, R. (2016). Unterrichtsbezogene Kooperation von
der zugrundliegenden Aussagen bestimmt. Es zeigte sich, dass die
Regelschullehrkräften und Sonderpädagog/innen im Kontext inklusiver
stigmatisierende Begriffsverwendung mit 29,7 % aller getätigten Aussagen,
Schulentwicklung. Implikationen für die Profes-sionalisierung. In V. Moser & B.
gefolgt von einer terminologisch-beschreibenden Begriffsverwendung (15,4
Lütje-Klose (Eds.), Schulische Inklusion (62nd ed., pp. 160–174). Beltz Juventa.
%), in Youtube am weitesten verbreitet ist. Diese und weitere Ergebnisse
werden vor dem Hintergrund der Bedeutung der Kommunikation und des Badstieber, B., & Amrhein, B. (2021). Schulleitungshandeln in integrations-/
Sprachgebrauchs in sozialen Medien hinsichtlich der Stigmatisierung und inklusionsorientierten Schulentwicklungsprozessen – Empirische Befunde
Entstigmatisierung von Menschen mit Behinderung diskutiert. aus der Schweiz und Deutschland. In A. Köp-fer, J. J. W. Powell, & R. Zahnd
(Eds.), Handbuch Inklusion international / International Handbook of InclusiveEducation (pp. 383–406). Verlag Barbara Budrich. 16.30 – 17.30 Uhr
Brauckmann, S., Pashiardis, P., & Ärlestig, H. (2020). Bringing context and
educational leadership together: fostering the professional development of Session 1.3.2 – Short Pitches (Raum 3.510) / Chair: Anne
school principals. Professional Development in Education, 1–12. Stöcker
UN-BRK (2018). UN-Behindertenrechtskonvention. Retrieved from www. Entwicklung und Evaluation des Programms "Journey to
behindertenbeauftragte.de Math" - ein adaptives Förderprogramm für mathematische
Basiskompetenzen
Narrative Persuasion durch Fabeln: Einfluss der Moral L. Wagner & A. Ehlert
und moralischer Wertorientierungen des Publikums auf Mathematische Basiskompetenzen (TTG-Verständnis, Stellenwertverständnis,
Einstellungen und Verhaltensintentionen gegenüber Multiplikation/Division, Modellieren) bereiten vielen Schüler:innen auch
Minderheiten am Ende der Grundschulzeit noch große Schwierigkeiten, obgleich
sie eine Voraussetzung für die Mathematik der Sekundarstufe bilden.
C. Nellen, M. Möhring, J. A. Finzi, A. Röhm, A. Biewener & M. R. Hastall Förderprogramme für diese Altersgruppen bzw. Klassenstufen sind jedoch
Geschichten werden seit Jahrtausenden als Mittel der narrativen Persuasion überwiegend curricular ausgerichtet und betrachten diese grundlegenden
genutzt, um Normvorstellungen oder Einstellungen und Verhaltensintentionen Kompetenzen nicht mehr. Daher soll das digitale Förderprogramm „Journey to
Math“ entwickelt werden, das diese Basiskompetenzen der Grundschule in den
gegenüber Individuen und Gruppen zu beeinflussen (z. B. Bilandzic, 2011;
Fokus nimmt, sich adaptiv an die individuellen Lernstände der Schüler:innen
Sukalla, 2018). In Fabeln werden Geschichten erzählt, die eine bestimmte
anpasst und somit für die differenzierende Förderung in inklusiven Settings
Lehre (Moral der Geschichte) beinhalten. Häufig werden Tiere dargestellt, die
genutzt werden kann.
menschliche Eigenschaften und Verhaltensweisen zeigen und bestimmte
Personen(gruppen) repräsentieren (Ehrismann, 2011). In der vorliegenden Die inhaltliche Konzeption wurde bereits vorgenommen und anhand
Studie wurde empirisch untersucht, inwiefern Veränderungen in der Moral von Expert:inneninterviews evaluiert. Außerdem wurde im Rahmen
einer Fabel zu Veränderungen in Einstellungen und Verhaltensintentionen einer Masterarbeit ein Prototyp des Programms entwickelt und in
der Rezipierenden gegenüber Personen aus Minderheitengruppen führen Grundschulklassen eingesetzt. Aus den ersten Ergebnissen lässt sich ein
und inwiefern die moralische Werteorientierung der Rezipierenden diesen signifikanter Kompetenzzuwachs der Schüler:innen durch die Nutzung des
Prozess moderiert. Es wurde ein Paper-Pencil-Experiment durchgeführt, in Förderprogramms erkennen.
dem die Teilnehmenden die Aesop-Fabel „Der Fuchs und der Bock“ lasen, die Leider beinhaltet der Prototyp aktuell nur die Förderung des TTG-
hinsichtlich ihrer dargestellten Moral systematisch variiert wurde (prosoziale Verständnisses. Außerdem ist er technisch noch nicht ausgereift, sodass eine
Moral vs. egozentrische Moral). Wir nahmen an, dass Rezipierende einer Weiterentwicklung dringend notwendig ist, jedoch sowohl an finanzieller als
Fabel mit einer prosozialen Moral allgemein prosozialere Einstellungen und auch an qualifizierter personeller Ausstattung bisher scheitert. Aus diesem
Verhaltensintentionen gegenüber Minderheiten zeigen als Rezipierende Grund ist auch eine umfassende Evaluation des Programms bisher noch nicht
einer Fabel mit einer egozentrischen Moral (Hypothese 1) und dass möglich.
dieser Effekt durch die moralische Werteorientierung der Rezipierenden Unsere Diskussionsfragen, für die wir uns möglichst viele und breite Ideen
moderiert wird (Hypothese 2). Als abhängige Variablen wurden altruistische erhoffen, sind daher Folgende:
Verhaltensintentionen, Toleranz und Vorurteile gegenüber Minderheiten sowie 1. Welche Möglichkeiten zur Beantragung finanzieller Unterstützung bzw.
allgemeine Einstellungen gegenüber Minderheiten erfasst. Es zeigte sich, dass welche möglichen Kooperationspartner:innen im Bereich der Programmierung
Rezipierende, die sich stark an Universalismus und Benevolenz orientieren, könnten für dieses Projekt gewonnen werden?
nach Lesen einer Fabel mit egozentrischer Moral weniger altruistische 2. Welche Aspekte sollten in der Evaluation des Programms neben einer
Verhaltensintentionen gegenüber Minderheiten zeigen als Rezipierende mit klassischen Wirksamkeitsstudie betrachtet werden?
geringerer Orientierung an diesen Werten. Dieses und weitere Ergebnisse
3. Welche Plattform ist geeignet, um das Förderprogramm an die Schulen zu
werden vor dem Hintergrund des Persuasionspotenzials von Fabeln im
bringen?
inklusiven Unterricht sowie zum Auf- und Abbau von Stigmatisierungen
diskutiert.Unterrichtliches Engagement und Störverhalten von Gettinger, M. & Walter, M. J. (2012). Classroom Strategies to Enhance Academic
Grundschulkindern – eine videobasierte Analyse von Engaged Time. In S. L. Christenson, A. L. Reschly & C. Wylie (Hrsg.), Handbook of
Research on Student Engagement (653 – 673). Boston, MA: Springer US. https://
Zusammenhängen doi.org/10.1007/978-1-4614-2018-7
N. Jansen & J. Decristan Hattie, J. (2009). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating
Die Analyse von Unterrichtsprozessen bietet einen vielversprechenden Ansatz to achievement. London: Taylor & Francis Group.
zu einem elaborierteren Verständnis des vielschichtigen, interaktionalen Klieme, E. (2006). Empirische Unterrichtsforschung: aktuelle Entwicklungen,
Unterrichtsgeschehens. Dazu bieten videobasierte Analysen das Potenzial theoretische Grundlagen und fachspezifische Befunde. Einführung in den
eines vertieften Blickes in entsprechende Unterrichtsprozesse, sind Thementeil. Zeitschrift für Pädagogik, 52(6), 765–773.
methodisch jedoch auch herausfordernd (z.B. Klieme, 2006). Lohmann, G. (2014). Mit Schülern klarkommen: Professioneller Umgang
Schüler*innenseitige Störverhalten bildet einen klassischen, videobasiert mit Unterrichtsstörungen und Disziplinkonflikten (11. Aufl.). Scriptor Praxis.
erfassten Unterrichtsprozess und wird inzwischen durch das Cornelsen.
schüler*innenseitigen Engagement als eine weitere wichtige Prozessvariable Winkel, R. (2011). Der gestörte Unterricht: Diagnostische und therapeutische
sinnvoll ergänzt. Während Unterrichtsstörungen als Beeinträchtigungen des Möglichkeiten (10. Aufl.). Schneider-Verl. Hohengehren.
Lehrens und Lernens durch Unterbinden der notwendigen Voraussetzungen
definiert (Lohmann, 2011; Winkel, 2005) und mit verringerten Lernerfolgen
assoziiert sind (z.B. Angus, 2010; Hattie, 2009), wird unterrichtliches EduMeta DB - Ideen zur Entwicklung einer Meta-Datenbank
Engagement dementgegen als behavioraler und mentaler Prozess in für die empirische (Inklusions-) Forschung
Interaktion mit unterrichtlichen Aktivitäten charakterisiert (z.B. Frendricks &
J. Bosch
McColskey, 2012) und steht konsistent mit positiver Leistungsentwicklung in
Verbindung (Gettinger & Walter, 2012). Die Literatursuche in der empirischen (Inklusions-)Forschung läuft aktuell
Der Short-Pitch präsentiert eine Sneak Peak erster Befunde einer beinahe ausschließlich über die Abstract- bzw. Volltextsuche einschlägiger
videobasierten Verhaltensbeobachtung unterrichtlichen Störverhaltens und Suchmaschinen wie z.B. Google Scholar, ERIC oder PubMed. Dabei ist speziell
Engagements in 35 Grundschulklassen. in quantitativ-empirischen Studien eine Vielzahl von Informationen über die
Es wird untersucht (1) inwiefern beobachtetes Störverhalten und Engagement erhobenen Variablen und das genaue Forschungsdesign sozusagen im Text
miteinander in Zusammenhang stehen und (2) welche Zusammenhänge „versteckt“ und muss durch Forscher:innen „entschlüsselt“ werden.
sich zwischen dem beobachteten Unterrichtverhalten und individuellen Das präsentierte Projekt soll dabei die Möglichkeit der Entwicklung einer
Lernvoraussetzungen von Drittklässler*innen zeigen. systematischen Meta-Datenbank explorieren, die ein festes Kategoriensystem
Da es sich bei den zu präsentierenden Daten um work-in-progress handelt, nutzt, um diese Informationen schnell und übersichtlich zu präsentieren. Im
liegen zum Zeitpunkt der Beitragseinreichung noch keine finalen Befunde vor. Rahmen dieses Vortrages sollen dabei der mögliche Aufbau, sowie mögliche
erste Schritte in der Entwicklung einer solchen Datenbank vorgestellt und
Die Diskussion des Short Pitchs und die weitere empirische Untersuchung mit Mitgliedern der empirischen sonder- und inklusionspädagogischen
des Verhältnisses von unterrichtlichem Störverhalten und Engagement Community diskutiert werden.
sollen das Verständnis von lernbeeinträchtigenden bzw. -förderlichen
Unterrichtprozessen verbessern und zur Erklärung interindividueller
Unterschiede in der Lern- und Leistungsentwicklung beizutragen.
Literatur
Angus, M., McDonald, T., Ormond, C., Rybarcyk, R., Taylor, A. & Winterton, A.
(2010). The Pipeline Project: Trajectories of classroom behaviour and academic
progress: a study of student engagement with learning. Edith Cowan
University, Mount Lawley, Australia.
Fredricks, J. A. & McColskey, W. (2012). The Measurement of Student
Engagement: A Comparative Analysis of Various Methods and Student
Self-report Instruments. In S. L. Christenson, A. L. Reschly & C. Wylie (Hrsg.),
Handbook of Research on Student Engagement (763 – 782). Boston, MA:
Springer US. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-2018-7Sie können auch lesen