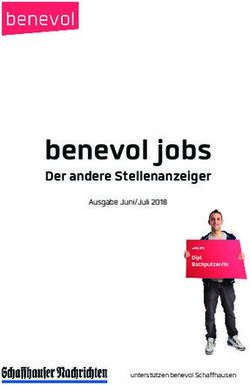ALPENVEREIN NEUHOFEN / KREMS - Österreichischer Alpenverein
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
ALPENVEREIN
NEUHOFEN / KREMS
AV-INFO 12 / 2020 (051) Neuhofen/Krems, 10.12.2020
Liebe Bergfreunde,
ein schwieriges und teilweise beängstigendes Jahr - das ihr hoffentlich bis jetzt unfallfrei und
gesund überstanden habt - neigt sich seinem Ende zu. Wie es aktuell und in den nächsten
Wochen oder Monaten weitergeht, ist nach wie vor nicht wirklich abzusehen - aber, wir hoffen
auf das Beste. Wir möchten es deshalb nicht verabsäumen, euch und euren Familien ein
segensreiches und geruhsames Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch in ein Neues Jahr zu
wünschen, mit hoffentlich - einem Ende des Corona-Alptraums, weiterhin viel Gesundheit und
natürlich auch wieder schönen Bergerlebnissen.
Nach dem Lockdown ist vor dem Lockdown (unserer Bundesregierung wird`s sicher möglich
machen) - deshalb bleibt unserer Weihnachtsfeier in diesem Jahr 2020 endgültig abgesagt.
Der schneereiche Winter 1916/17 führte zu einer der folgenreichsten Wetterkatastrophen. Am
13. Dezember 1916 fielen bis zu 5000 Soldaten den Lawinen zum Opfer.
Die Winterzeit ist im „Lebensraum Berg“ per se schon eine schwierige Zeit für Wildtiere und
Pflanzen. Schneemassen, wie wir sie derzeit in unseren südlichen Bundesländern haben,
erschweren die Situation noch einmal dramatisch. Unterstützen wir die Tierwelt zumindest
insofern, dass wir ihren Lebensraum respektieren. Deshalb - Achtsam unterwegs im Winter -
unsere Wildtiere sind es allemal wert!
Heuer jährt sich der 80. Todestag von Emilio Comici. Er war ein Meister in den schwierigsten
Kletterrouten seiner Zeit. Die Leidenschaft und Liebe zu den Bergen spiegelt sich noch heute in
den logischen Linien seiner Erstbegehungen wider.
Ein herzliches Berg Heil
wünscht euch
das AV-TEAM der Ortsgruppe Neuhofen/Krems
Ortsgruppe Neuhofen / Krems
www.alpenverein.at/linz-neuhofenDie Leute hasten,
Weihnachtszeit! von Helga Duffek-Kopper Packerln stapeln sich am Kasten.
Mütter kaufen, Väter zahlen,
und man grübelt voller Qualen,
ob man heute in der Stadt
wohl wirklich nichts vergessen hat:
Für Opa Badesalz aus Latschen.
Für Oma die karierten Patschen.
Den Cognac für die Schwiegermutter.
Für Lumpi teures Hundefutter.
Den Regenschirm für Onkel Otto.
Fürs Kind das bunte Bilderlotto -
Das sind halt jetzt so viele Fragen,
die einen Schenkenden so plagen.
Ein jeder hat von allem viel
und überdies im besten Stil,
er hat zum Trinken und zum Essen,
die Kleidung darf man nicht vergessen.
Die Wohnung, die ist auch komplett,
vom Klo bis hin zum Ehebett.
Ob Whiskey, Gürtel oder Seidentücher,
ob dicke Bücher, dünne Bücher,
ob große Flaschen, kleine Flaschen,
ob Feuerzeuge, Pfeifen, Taschen,
ob Bilder, Vasen, Lampen, Platte -
mir fällt nichts ein, was man nicht hatte.
Jede Idee, die mich entzückt,
wird alsbald rüde unterdrückt,
ich höre nur mehr voller Hohn:
Das hat er schon - das hat sie schon!
Ja, gibt`s denn wirklich keine Sachen,
die einem heut` noch Freude machen?
Mein Hirn ist ausgebrannt erloschen.
Doch plötzlich fällt bei mir der Groschen:
An einem fehlt es weit und breit,
eins hat kein Mensch, kein Mensch hat Zeit!
Wir wollen einmal richtig denken:
W e i h n a c h t e n Die Zeit soll`s sein, die wir verschenken!
Man muss kein Millionär, kein Schah sein -
2020
Man muss nur füreinander da sein!
Ich weiß zum Beispiel, was ich tu:
Ich hör dir einmal richtig zu….
Wir schenken Zeit - mal heut, mal morgen,
erzähl`n einander unsre Sorgen
und leih`n einander unsre Ohren.
Erholsame Weihnachten und einen guten Rutsch Von dem Geschenk geht nichts verloren!
in ein gesundes Neues Jahr „Zeit“ ist auch einfach zu verschenken,
- mit vielen schönen Bergelebnissen - man braucht nicht lange nachzudenken,
man braucht dazu kein Weihnachtspackerl,
wünscht euch das Geschenkpapier, Spagat und Sackerl,
AV-TEAM Lametta, Engelshaar und Kerzen -
der Ortsgruppe Neuhofen/Krems Das Wichtigste: Es kommt von Herzen!
Ich will euch nun nicht lange quälen,
euch eure Zeit nicht länger stehlen -
ich hoffe nur, ihr denkt daran
und fangt bald mit dem Schenken an!
Ortsgruppe Neuhofen / Krems
www.alpenverein.at/linz-neuhofenDezember 1916 - Weißer Tod im Ersten Weltkrieg
Im Winter 1916/17 ereignete sich in den südöstlichen Alpen eine der folgenreichsten
Wetterkatastrophen überhaupt. Auf ein massives Schneefallereignis folgten zahlreiche Lawinen,
die tausende von Soldaten und Zivilisten unter sich begruben.
Die Alpenfront (1915-1918)
verlief zum großen Teil im Hochgebirge
Kriegerische Ausgangslage
Vor etwas mehr als einem Jahrhundert befand sich Europa inmitten des Ersten Weltkriegs. An
der italienischen Front standen sich die österreichisch-ungarische und die italienische Armee auf
einem der rauesten Schlachtfelder der Geschichte, den Berggipfeln der südöstlichen Alpen,
gegenüber. (siehe Box 1) Während eines Großteils des Jahres ruhten die Gefechte allerdings
weitgehend, denn es begann ein anderer Kampf - derjenige gegen Kälte, Eis und Schnee. Mit
einem durchschnittlichen Niederschlag von 2m pro Jahr gehört diese Region der Alpen zu den
feuchtesten Gebieten des Kontinents. Die Soldaten wurden damals buchstäblich unter Schnee
begraben.
Meteorologische Ausgangslage
Das Schicksal meinte es nicht gut mit jenen Männern, denn der Winter 1916/17 wurde zu einem
der schneereichsten des Jahrhunderts. Im Dezember 1916 fiel während neun Tagen in den
Südalpen fast ununterbrochen Schnee. Auslöser war eine „blockierte“ atmosphärische
Zirkulation, das sogenannte „Negative Ostatlantik-/Westrussland-Muster“ (ein Hochdruckrücken
über Westrussland und ein Tiefdruckgebiet über Westeuropa). In den südlichen Alpen führt dies oft
zu Starkniederschlägen und ungewöhnlich hohen Temperaturen im Mittelmeerraum. Durch das
Zirkulationsmuster steigt außerdem die Wassertemperatur des Mittelmeers. Dieses ist wiederum
die Hauptquelle von Wasserdampf für die südlichen Alpen. Im Dezember 1916 verursachte
dieses Ostatlantik/Westrussland-Muster so starke Schneefälle, wie man sie in der Region seit
Menschengedenken nicht erlebt hatte. Im Winter 1916/17 wurde das Zwei- bis Dreifache der
zwischen 1931 und 1960 erhobenen Maximalwerte gemessen.
13. Dezember 1916
Es war aber vor allem ein einzelner Tag, der tragischerweise in die Geschichtsbücher einging:
der 13. Dezember 1916. Nach neun Tagen Schneefall, erreichte die Schneedecke an der alpinen
Kriegsfront ein kritisches Gewicht. Ein Wetterumschwung führte zudem warme und feuchte
Luftmassen aus dem Mittelmeerraum in die Südalpen und ließ die Schneefallgrenze rasch
steigen. Auch in höheren Lagen begann es zu regnen. Die weißen Massen wurden noch dichter
und schwerer. In der Folge gingen dutzende von riesigen Lawinen in der ganzen Region nieder,
auch an Orten, die bisher eigentlich als sicher gegolten hatten. (siehe Box 2) Ganze Kompanien
Ortsgruppe Neuhofen / Krems
www.alpenverein.at/linz-neuhofenwurden verschüttet. Nach neuesten Schätzungen fielen an diesem Tag bis zu 5000 Soldaten den
Lawinen zum Opfer. Das erste Bataillon des Kaiserschützenregiments Nr. III zum Beispiel hatte
an diesem Tag 230 Tote zu beklagen und an der Marmolada, dem höchsten Berg der Dolomiten,
riss eine einzige Lawine zwischen 270 und 332 Männer in den Tod. Aber nicht nur Soldaten,
sondern auch dutzende Zivilisten wurden von den Lawinen getötet, welche oft bis in die niedrig
gelegenen und als sicher geltenden Siedlungen
vordrangen. Die Schneemengen, welche am 13.
Dezember 1916 Tausende von Soldaten unter sich
begruben, waren so gewaltig, dass die schmelzenden
Gletscher noch heute hin und wieder Leichen und
Fundstücke freigeben, eine traurige Erinnerung an das
absurde Gemetzel des Ersten Weltkriegs.
Tiroler Standschützen, Vorgipfel Ortler, 2016
Im Krieg verheimlicht - kaum Thema für k. u. k. Presse
Da sich das Unglück inmitten einer weit größeren Tragödie, dem Ersten Weltkrieg, zutrug, blieb
sie zu jener Zeit so gut wie unbeachtet. Nichtsdestotrotz handelt es sich gemessen an der
Opferzahl um eine der schlimmsten wetterverursachten Katastrophen der europäischen
Geschichte. Als „Worst Case“, bei dem alles zusammenkam.
Wissenschaftliche Aufarbeitung
Zum 100. Jahrestag der Katastrophe rekonstruierten Klimatologen und Historiker der Universität
Bern das damalige Extremwetter. Durch die historischen Dokumente und Tagebücher von
Zeitzeugen sowie die wenigen vorhandenen Messdaten waren die Ereignisse im Einzelfall
bereits gut dokumentiert und nachvollziehbar. Es musste jedoch überprüft werden, ob die
Zeitzeugen die Ereignisse richtig wahrgenommen oder vielleicht bei der Berichterstattung ins
Tal übertrieben hatten. Die Forscher untersuchten die Ursachen und Auswirkungen jener
fürchterlichen Lawinenniedergänge mittels Klimarekonstruktion und historischer Analysen.
Anhand dieser Untersuchungen stellten sie fest, dass die Soldaten bei der Schilderung der
Ereignisse keineswegs übertrieben hatten. Die Kommandanten vor Ort schätzten die Gefahr für
ihre Truppen richtig ein und versuchten teils den Rückzug anzuordnen, was ihnen allerdings
nicht immer gestattet wurde. So durfte auch auf Bitte eines an Ort und Stelle im Einsatz
befindlichen Bataillonskommandanten der Nachschubposten Gran Poz nicht geräumt werden.
Die Offiziere im Tal konnten sich die Situation aus der sicheren Distanz gar nicht richtig
vorstellen und gaben diesen Rückzugsgesuchen nicht statt - „Krieg ist eben Krieg“.
Am 13. Dezember wurde der Posten Gran Poz, am höchsten Dolomiten-Gipfel der Marmolata
gelegene, von einer Lawine verschüttet - nur 51 der insgesamt 321 dort stationierten Soldaten
überlebten. „Die Sturzflut aus Schnee (...) überrannte eine zweistöckige Baracke“, hielt ein
Zeitzeuge in seinen Aufzeichnungen fest.
Ein Verweis auf die Ereignisse findet sich auch beim
Österreichischen Bundesheer, wo „eines der
traurigsten Kapitel in der Geschichte des
Gebirgskrieges“ auch als „ein Beispiel für die
Ignoranz der Vorgesetzten in Bezug auf alpine
Gefahren“ gesehen wird.
25. November 1916: Eine Feldmesse auf dem Gletscher
der Marmolada zu Ehren des neuen Kaisers von
Österreich, Karl I. Viele dieser Männer fielen 18 Tage
später der Lawine von Gran Poz zum Opfer
Ortsgruppe Neuhofen / Krems
www.alpenverein.at/linz-neuhofenBox 1: Die italienische Front
Am 23 Mai 1915 erklärte das italienische Königreich der österreichisch-ungarischen Monarchie
den Krieg, fast ein Jahr nach Beginn des Ersten Weltkriegs. Die Grenze zwischen den beiden
Ländern zog sich größtenteils durch alpines Gelände, wo sich die österreichisch-ungarische
Armee auf gut organisierte Verteidigungslinien zurückzog. Die rund 775 Kilometer lange Front
zog sich vom Stilfser Joch an der Schweizer Grenze über die Dolomiten, die Karnischen Alpen
bis zum Isonzo-Gebiet hin und weiter zur Adria. Sogar die höchsten Gipfel wie Ortler, Adamello
oder Marmolada wurden miteinbezogen. Die räumliche Lage der Front veränderte sich anfangs
kaum, bis dann im Oktober 1917 deutsche Truppen der österreichisch-ungarischen Armee zu
einem Durchbruch der italienischen Linien verhalfen. Dieser Angriff zwang die Italiener zum
Rückzug um mehr als 100km zum Fluss Piave, im Flachland des Veneto. Zwischen Stilfser Joch
und Monte Grappa blieb die Front bis zum Ende des Krieges unverändert. Im Jahre 1918
zerbrach schließlich die österreichisch-ungarische Monarchie und Italien stand auf der Seite der
Sieger. Die Bilanz der Todesopfer war erschreckend: in
dreieinhalb Jahren wurden rund 650.000 italienische und
400.000 österreichisch-ungarische Soldaten getötet.
Auch wenn die Kampflinie zwischen Österreich-Ungarn
und Italien im Ersten Weltkrieg nur eine Nebenfront war
- deren Bedingungen waren für die meisten Soldaten
mehr als ungewöhnlich. Die Front verlief teilweise auf
über 3000 Metern quer durch die Dolomiten. An
manchen Frontabschnitten kamen mehr Soldaten durch
Lawinen, Felsstürze und Unfälle ums Leben als durch
feindlichen Beschuss. Italienische Truppen im Hochgebirge
(1916)
Box 2: Lawinen an der Front
Ab Anfang November schneite es entlang der gesamten Frontlinie sehr viel. Berichte von
Zeitzeugen zeigen, dass die Schaufel fast überall entlang der gebirgigen Frontlinie zwischen dem
Stilfser Joch und dem Krn zum wichtigsten wurde. Fast täglich gab es Lawinen, die immer
wieder neue Opfer forderten. An der Frontlinie wurden Tunnels gegraben, um die vordersten
Positionen zu erreichen. Angesichts der Tatsache, dass Angriffe der Gegenseite unmöglich
waren, verlangten Offiziere vor Ort oft, dass die Soldaten von Positionen abgezogen würden, die
von Lawinen bedroht waren. In den meisten Fällen befahlen die in warmen Stuben im Tal
sitzenden höheren Kommandeure, dass die Truppen in ihren Stellungen verblieben. Am frühen
13. Dezember und auch später an diesem Tag fielen etliche große Lawinen auf österreichische
wie italienische Stellungen - meist dort, wo sie von
denjenigen vor Ort erwartet worden waren. Das größte
Einzelereignis traf Männer am höchsten Berg der
Dolomiten, der Marmolada (3343m), wo eine Lawine am
Gran Poz (2242m) an die 270 Männer tötete, von welchen
einige erst im Juli 1917 geborgen werden konnten. Der
dort stationierte Josef Strohmeier kommentierte die
Situation wie folgt: […] nach der Warnung, dass die
Lawine komme, wollten wir rasch zur Türe hinaus, aber
in diesem Moment wurde die Aussenwand durch Schnee
und Eis eingedrückt. […] Mein Schlafkamerad sagte: Lawine in Vermiglio, Trentino (1916)
‘Kruzifix iaz san mir hin‘.“
Quelle und Bilder: www.geography.unibe.ch, www.orf.at, www.wikipedia.org, naturwissenschaften.ch,
www.sn.at, www.nzz.ch
Ortsgruppe Neuhofen / Krems
www.alpenverein.at/linz-neuhofenDer nächste Winter kommt bestimmt
Wildtiere - Achtsam unterwegs im Winter
Der Lebensraum jenseits der Waldgrenze bringt Tiere an ihre Existenzgrenze. Für unser
heimisches Wild ist es deshalb die „Notzeit“, also der absolute „Engpass“ im „Überlebensjahr“.
Wildtiere wie Rehe, Hirsche und vor allem die Gämsen im Hochgebirge sind besonders zu dieser
Zeit ruhebedürftig. Schon eine einzige unbewusste Störung kann über Leben und Tod dieser
Tiere entscheiden. Wie man grobe Störungen und damit Stress für die Tiere vermeiden kann,
zeigen ein paar einfache Empfehlungen.
Das dunkle Winterfell der Gämsen
wärmt sich in der Sonne schnell auf
Neben der Kälte ist es die Nahrungsknappheit, auf die sich die Tiere im Winter einstellen
müssen. Murmeltiere, Igel, Siebenschläfer und andere Säugetiere halten einen Winterschlaf. Eine
dicke Fettschicht bietet ihnen Schutz gegen die Kälte und liefert Energie. Auch das
Winterquartier selbst muss gut isoliert sein. Nur gesunde und kräftige Tiere können den Winter
sicher überdauern. Den Stoffwechsel auf ein Minimum zu reduzieren, birgt große Gefahren in
sich. Unvorhergesehene Störungen können sich fatal auswirken, auch der Schutz vor Infektionen
ist reduziert.
In unseren Bergen gibt es eine Reihe von Tieren, die den Winter über nicht versteckt in ihrer
Höhle schlafen, sondern sehr aktiv sind und gelernt haben, mit tiefen Temperaturen, Schneefall
und dem Mangel an Nahrung umzugehen. Ihre Spuren findet man überall im Schnee, wenn man
nur genauer hinsieht.
Wer wach bleibt, muss über sichere Nahrungsquellen im Winter verfügen, oder sich Vorräte
anlegen. Pflanzenfresser wie Hirsch, Reh, Gämse und Steinbock müssen sich im Winter mit
Knospen und Zweigen von Bäumen begnügen, saftige Kräuter gibt es nicht. Einen Winterspeck
als Energiereserve und ein dickes Fell als Kälteschutz haben auch diese Tiere angelegt.
Zusätzlich fahren sie ihren Stoffwechsel herunter, um mit ihrer wertvollen Energie hauszuhalten
und sind dann besonders empfindlich gegen Störungen. Birkhühner, Auerhühner, Schneehühner
und der Schneehase lassen sich zudem einschneien und nutzen so die Isolierende Wirkung des
Schnees.
Vorratshaltung hingegen ist typisch für Eichhörnchen. Sie verstecken bereits ab dem Spät-
sommer Nüsse und andere Winternahrung in Baumhöhlen und Erdlöchern. Schermäuse grasen
im Winter die Bodenoberfläche nach Pflanzenteilen und Wurzeln ab. Eine Schneedecke schützt
sie dabei effizient vor Fressfeinden.
Raubtiere wie Füchse, Wölfe oder Luchse sind auch im Winter auf Beutefang angewiesen. Sie
müssen in der kalten Jahreszeit oft große Gebiete nach Beutetieren absuchen, dies zehrt
zusätzlich an den nur spärlich vorhandenen Energiereserven. Ähnlich ergeht es den heimischen
Greifvögeln. Eine längerfristig geschlossene Schneedecke kann ihren Beständen stark zusetzen.
Ortsgruppe Neuhofen / Krems
www.alpenverein.at/linz-neuhofenStörung bringt Stress
Die heimische Tierwelt kann sich an permanente Menschenmassen, wie sie an Schipisten
vorkommen „gewöhnen“. Viel gefährlicher sind jedoch überraschende Störungen in den
wichtigen Ruhezonen:
• Jede Störung durch den Menschen versetzt die Tiere in Stress
• Blitzschnell muss der Kreislauf ohne Aufwärmphase auf Fluchtverhalten umgestellt
werden
• Dadurch gelangt schnell auch kälteres Blut aus den Beinen in die inneren Organe
• Dies kann in kürzester Zeit zum Kälte-Schock-Tod des Tieres führen
Vor allem Jungtiere - wie dieses Reh -
kämpfen in schneereichen Wintern
mit dem Vorwärtskommen
Störung der Tiere in ihren Einstandsgebieten, beim Fressen oder gar während ihrer Nachtruhe,
bedeutet Stress in Kombination mit Flucht und lassen den Energielevel in die Höhe schnellen -
und das zehrt an den Reserven (die besonders am Ende des Winters ohnehin schon auf einem
sehr geringen Level sind). Der erhöhte Energiebedarf muss durch höhere Nahrungsaufnahme
ausgeglichen werden. Aufgrund der erschwerten Nahrungssuche im Winter ist dies jedoch nur
schwer möglich. Die Energiebilanz der Tiere gerät somit aus dem Gleichgewicht, was eine
schlechte körperliche Verfassung und im schlimmsten Falle den Tod zur Folge haben kann.
Auch muss berücksichtigt werden, dass zum Beispiel Rehwild, Rotwild und auch Gämse
Wiederkäuer sind. Sie brauchen nach der Nahrungsaufnahme viel Ruhe, um die Nahrung optimal
zu verwerten. Werden diese Tiere mehrmals oder anhaltend beunruhigt, können sie keine
Energie aus der Nahrung ziehen und erleiden im schlimmsten Fall einen langsamen
Erschöpfungstod.
Störfaktoren, die zur Flucht führen
• Verlassen der Wege, querfeldein gehen
• Lärm
• Plötzliches Auftreten, Überraschungseffekt
• Hunde
• Annäherung von oben (z.B. bei Skiabfahrt)
Besonders sensible Zeiträume
• Brunft- bzw. Balzzeit
• Brutzeit
• In Anwesenheit von Jungtieren
• Zur Dämmerung / Dunkelheit
• Bei fehlenden Rückzugsmöglichkeiten
Ortsgruppe Neuhofen / Krems
www.alpenverein.at/linz-neuhofenWas kann ich tun, um Tiere nicht zu stören -
einfache Empfehlungen für ein gutes Miteinander:
• Kartenstudium und Abfrage von „Wildruhezonen“ bei der Tourenplanung (Wenn man
weiß, wo sich die Tiere aufhalten, dann kann man als Skitourengeher oder
Schneeschuhwanderer viel an Störung vermeiden)
• Routenempfehlungen nutzen, Schutz- und Schongebiete respektieren und umgehen -
nicht in „Ruhezonen“ eindringen
• im Wald auf den Forststraßen oder ausgewiesenen Routen bleiben - Schilder und
Markierungen beachten (Das Wild kann sich an uns Menschen gewöhnen, wenn wir uns
immer auf den gleichen Steigen bewegen. Auch an den Hirten der jeden Tag seine gleichen
Tätigkeiten auf der Alm verrichtet gewöhnt sich das Wild rasch)
• Lärm vermeiden (aber bitte auch nicht anschleichen - reden in normaler Lautstärke warnt
das Wild frühzeitig vor und es kann entspannt Abstand halten)
• Hunde anleinen - sie stellen eine besondere Gefahr für Jungtiere oder brütende Vögel
dar und sollten daher immer an der Leine geführt werden.
• Im freien Gelände, wenn möglich, Abstand zu Baum- und Strauchgruppen sowie
abgewehten Rücken und Graten halten
• Fütterungen und scheefreie Äsungsflächen des Wildes großräumig umgehen
• Touren in der Dämmerungs- und Nachtzeit vermeiden, Mondscheintouren nur auf
Pisten (Die Zeit der Morgen- und Abenddämmerung sowie die Nachtzeit sind die
Hauptäsungszeiten für das Wild)
• Wenn du Tier und Tierspuren siehst, diesen nicht folgen - sofort anhalten, ruhig
bleiben und nur aus der Distanz beobachten
• Wiederaufforstungsflächen meiden, die Schikanten zerstören die jungen Bäumchen
Der Appell an den Sportler und Naturfreund lautet:
„Akzeptiere diese Grenze auch ohne einen vorhandenen Zaun und respektiere
diesen gekennzeichneten Raum als wichtige Schutz- und Schonzone für Tiere und Pflanzen.“
Perfekte Waldabfahrt?
Jungwälder schonen!
Neben der Rücksicht auf die Wildtiere ist auch ein verantwortungsvolles Verhalten gegenüber
dem Wald von großer Bedeutung. Oft scheint eine wunderschöne schneebedeckte und
vermeintlich freie Schneise die perfekte Abfahrtsroute zu sein. Hier sollte unbedingt bedacht
werden, dass es sich um Aufforstungsflächen handeln kann. Bei der Abfahrt über diese Flächen
können mit den scharfen Kanten der Skier große Schäden an den Jungbäumen unter dem Schnee
angerichtet werden.
Junge Baumkulturen (< 3 Meter Höhe) meiden
Das Österreichische Forstgesetz verbietet das Betreten und Befahren von Jungwäldern unter
einer Höhe von drei Metern. Wir bitten Skitourengeher, unbedingt junge Baumkulturen zu
meiden. Diese Jungbestände sind oft der Aufenthaltsbereich von Wildtieren und es dürfen auch
die Bäume und deren Wurzeln und Äste nicht beschädigt werden. Die Verjüngung der alpinen
Wälder wird dringend zur Aufrechterhaltung aller Schutzfunktionen für die Zukunft benötigt.
Ortsgruppe Neuhofen / Krems
www.alpenverein.at/linz-neuhofenInformationsinitiative „RespekTIERE deine Grenzen“
Die Initiative „Respektiere deine Grenzen“ will informieren und
Bewusstsein schaffen.
Wildtiere - Wohnraum Natur
Wir Menschen bewegen uns in der freien Natur im Wohnraum von Tieren, Bäumen und
Pflanzen. als Sportler und Erholungssuchende sind in dieser Wohnung zu Gast und sollen dieses
Gastrecht nicht über Gebühr in Anspruch nehmen. Damit wir auch in Zukunft die Vielfalt von
Fauna & Flora genießen können, ist es notwendig, deren Lebensräume und Lebensrecht zu
respektieren.
Gezielte Lenkungsmaßnamen
wollen sensibilisieren und informieren. Sie leiten Schneeschuh- und Skitourengeher an den
Ruhezonen vorbei (Panoramatafeln am Ausgangspunkt, Schilder im Gelände) und tragen so
maßgeblich zu einem guten Miteinander bei.
Panoramatafeln des
Tiroler Projektes „Bergwelt-Tirol
Info - Skitourenlenkungsprojekte
www.alpenverein.at/portal/natur-umwelt/av-naturschutz/besucherlenkung/skitourenlenkung.php
Info - Folder
„Natürlich auf Tour“ - www.alpenverein.de/Natur-Umwelt/ naturvertraeglicher-Bergsport
Download – Bereich / Download – Bereich / Download – Bereich / Download – Bereich
Im Download-Bereich unserer AV-Homepage für euch abgelegt: Folder RespekTIERE deine
Grenzen - Bundesland Oberösterreich
Download-Datei:
2020----_RespekTIERE deine Grenzen OÖ - Sommer (1.253 KB)
2020----_RespekTIERE deine Grenzen OÖ - Winter (806 KB)
Download – Bereich / Download – Bereich / Download – Bereich / Download – Bereich
Hier findet ihr interaktive Karten für eine Tourenplanung mit Rücksicht auf die Wildtiere:
• www.respektieredeinegrenzen.at/die-initative/ruhezonen-karte
• www.bergwelt-miteinander.at (Bundesland Tirol)
• www.alpintouren.com
• www.wildruhezone.ch (Wildruhezonen Schweiz)
• www.upmove.eu
„Eigenverantwortung“ sollt das wichtigste Lenkungsprojekt sein
Ortsgruppe Neuhofen / Krems
www.alpenverein.at/linz-neuhofenDiese Tiere sind im Winter besonders gefährdet
Rotwild
Das scheue Rotwild verbringt den Winter in den
niedrigen und mittleren Lagen des Gebirgswaldes
und schränkt seine Aktivitäten stark ein. Dabei
senken die Tiere ihre Körpertemperatur deutlich
ab. Gefressen wird während der Nachtstunden,
danach verharrt der Rothirsch bewegungslos an einer
Stelle, um Energie zu sparen. Sein Pansen fasst im
Winter nur halb so viel Nahrung wie im Herbst, er
reduziert seine Herzschlagfrequenz bei Bedarf auf 30
bis 40 Herzschläge pro Minute. Eine anstrengende
Flucht vor Menschen muss durch erhöhte Nahrungsaufnahme ausgeglichen werden, was einmal
mehr schwierig ist, da das Nahrungsangebot im Winter knapp ist.
Hirsche und Rehe - wo sie gefüttert werden, haben sie gut lokalisierbare Einstandsgebiete. Die
Fütterungen - vor allem jene der scheuen Hirsche - sind entsprechend gekennzeichnet und dürfen
nicht betreten werden. Rehwildfütterungen sieht man manchmal vom Weg aus.
Rehe sind weniger scheu und arrangieren sich gut mit Personen, die die ihnen bekannten Wege
nutzen. Ein Befahren der Fütterung von oben und ein Abschneiden des Rückzugsweges ist
dagegen schlecht. Dadurch kann es passieren, dass die Tiere tagelang nicht zur Fütterung
kommen, den Wald durch Verbiss- und Schälschäden beeinträchtigen oder schlicht verhungern.
Wildruhezonen sind auf Karten vermerkt und wichtiger Bestandteil von Lenkungsmaßnahmen.
Gamswild
Gämsen haben dasselbe Fluchtproblem wie das
Rotwild. Allerdings werden sie nirgendwo in den
Alpen gefüttert und ziehen sich bei starkem
Schneefall in tiefere Lagen zurück. Sobald die
Bedingungen es zulassen, wandern sie wieder hinauf.
Sie halten sich meist an sonnenexponierten
Hängen auf, wo der Schnee schnell schmilzt. Dort
suchen sie Knospen und Triebe von Sträuchern, sowie
Gräser und Flechten. Wenn es stürmt und schneit, ist
es aber auch dort eisig kalt und die Tiere benötigen
viel Energie. Die weiche Sohle der Hufe passt sich perfekt jeglichen Unebenheiten an, während
die Nebenhufe das einsinken im Schnee verhindern.
Sommer- und Winterfell unterscheiden sich stark in Farbe und Dichte. Die Gams behält ihre
Hörner auch im Winter - im Gegensatz zum Rotwild, die ihr Geweih während dieser Jahreszeit
abwerfen.
Schneehuhn
Das Schneehuhn - der Tarnungskünstler - gehört wie Auerhuhn, Birkhuhn, Haselhuhn zur
Gattung der Raufußhühner. Sein Lebensraum liegt weit oberhalb der Baumgrenze und
überschneiden sich mit den alpinen Tourengebieten.
Es wird bis zu 40 Zentimeter groß, bringt ein halbes Kilo auf die Waage und hat gut einen halben
Meter Flügelspannweite. Viermal jährlich mausert sich das Alpenschneehuhn und passt sein
Federkleid so perfekt der Umgebung an. Im Sommer trägt es ein braunes, im Winter ein
schneeweißes Fellkleid. Sie haben befiederte Zehen - wie bei Schneeschuhen vergrößert das die
Auftrittsfläche und verhindert, dass die großen Hühnervögel im Schnee einbrechen.
Ortsgruppe Neuhofen / Krems
www.alpenverein.at/linz-neuhofenUm Energie zu sparen, beschränken diese Tiere ihre
Aktivitäten im Winter auf ein Minimum und halten
sich nur dort auf, wo sie auf engstem Raum
Nahrung, Deckung vor Fressfeinden und Schutz
vor Kälte finden. Sie nutzen - wie die Gämsen - die
abgewehten Grate, auf denen sie letzte Beeren und
Gräser finden. Sie lassen sich einschneien und
vertrauen auf ihr weißes Winterkleid als perfekte
Tarnung. Wird es besonders Kalt, graben
Schneehühner sich - genauso wie Birkhühner - eine
kleine Höhle im lockeren Schnee. Dort herrschen Temperatur um die null Grad, selbst wenn
draußen ein eisiger Wind weht. Kommt man ihnen zu nahe, fliegen sie in letzter Sekunde auf
und lassen sich in einigen Metern Entfernung wieder nieder. So verbringen sie den restlichen
Tag meist ohne Kälteschutz und Deckung. Einfache Maßnahmen zur Vermeidung von Störungen
sind das Umgehen von Graten und Kuppen. Ihre Fresszeiten sind jeweils vor und nach der
Dämmerung.
Ähnlich ist es beim Birkhuhn, das im Bereich der Waldgrenze zu Hause ist. Schitourengeher
und Schneeschuhwanderer sollten Strauch- und Baumgruppen (Achtung Schneehase) meiden.
Im April beginnt die Balz von Auerhahn und Birkhahn
- hier zwei rivalisierende Birkhähne
Schneehase
Schneeweiß - so sieht der Schneehase im Winter aus,
eine Ausnahme sind seine Ohrenspitzen - die sind
schwarz gefärbt. So können ihn seine Feinde in der
Umgebung können ihn seine Feinde nur schlecht
erkennen. Doch der Hase ist nicht immer weiß: Im
Sommer läuft er im braunen Kleid herum. Sobald es
aber im Herbst kalt genug wird, wachsen dem
Schneehasen in rasanter Geschwindigkeit weiße
Haare und überdecken das braune Fell. Dadurch ist
der Hase nicht nur gut getarnt, sondern auch viel
wärmer angezogen als im Sommer! Aber nicht nur durch seine Farbe ist der Schneehase gut an
seinen Lebensraum im Gebirge angepasst, sondern auch durch seinen Körperbau. Er hat kurze
Ohren, die nicht so schnell frieren können und riesige Pfoten mit viel Fell zwischen den Zehen.
So kriegt er keine kalten Füße und kann auf pulvrigem Schnee rennen, ohne einzusinken.
Der Schneehase passt auch seine Nahrungssuche an, um im Winter nicht zu viel Energie zu
verbrauchen. Er bewegt sich weniger weit und sucht nur noch im engeren Umkreis nach Futter.
Im Winter frisst er Rinden und Hölzer. Um die Nahrung vollständig zu verwerten, verdaut er sie
ein erstes Mal im Blinddarm, scheidet sie als feuchten Kot aus und frisst diesen Kot nochmals.
Bei dieser zweiten Verdauung entstehen die bekannten, trockenen Kügelchen von Hasenkot.
Ortsgruppe Neuhofen / Krems
www.alpenverein.at/linz-neuhofenDer Schneehase gilt als gesellig. An besonders kalten Tagen kuscheln manchmal 100
Schneehasen zusammen und wärmen sich gegenseitig. Er ist vorwiegend nachtaktiv und
versteckt sich tagsüber in kleinen Gruben im Schnee oder Erdreich.
Steinbock
Der Steinbock wechselt sein Fell nur einmal im Jahr. Im
Spätfrühling werden die Haare komplett erneuert, das
Sommerhaar wird bis zum Winter hin nur noch verdichtet.
Dadurch verändert sich auch die Färbung der Tiere über die
ganze zweite Jahreshälfte kontinuierlich leicht.
Ein bekannte Anpassungsstrategie ist das Bilden von
Körperreserven über die Aufnahme von Nahrung in der
scheefreien Zeit. Bei körperlich bereits ausgereiften
Steinböcken (Männchen ab etwas neun Jahren) können diese
Fettdepots zu Winterbeginn um die 25 Kilogramm
ausmachen. Interessant ist, wie sich der Verdauungstrakt an
den Winter anpasst. So kommt es zur Verkleinerung und
Reduktion der Pansenzotten. Das bedeutet, dass im Winter
gar nicht so viel Nahrung wie im Sommer verwertet werden
kann. Umso wichtiger sind die angelegte Fettreserven. Nun
ist der Winter in den Bergen lang und Fettreserven sind je
nach Winterstrenge irgendwann aufgebraucht. Das Steinwild
muss also mit diesen Reserven haushalten.
Aus diesem Grund gehen Tiere in eine Art Energiesparmodus. So wird beispielweise die
Herzschlagrate bereits gegen Ende August von durchschnittlich knapp 100 Schlägen pro Minute
langsam reduziert, um im Jänner und Februar ein Minimum von etwa 40 Schlägen zu erreichen.
Im gleichen Zeitraum senkt das Wild die allgemeine Körpertemperatur kontinuierlich um etwa
ein Grat ab und bewegt sich wenig. Die Tiere konzentrieren ihren Wärmehaushalt auf die
lebenswichtigen Organe und Körperbereiche, wo sie eine konstante Temperatur von rund 38
Grad Celsius halten (in den Extremitäten teilweise nur an die 15 bis 20 Grad Celsius). Dieses
Auskühlen ist zwar energiesparend, plötzliche Fluchten mit einem damit verbundenen, abrupten
Hochfahren der Körperfunktionen sind allerdings mit enormen Energiekosten verbunden.
Mitunter fehlen die Reserven dann gegen Ende des Winters.
Um im Normalfall keine Energie zu vergeuden, nutzen Steinböcke zum Hochfahren des
Organismus die Sonne. Vorausgesetzt sie werden nicht gestört, warten die Tiere in den
Morgenstunden meist auf den Sonnenaufgang und lassen sich aufwärmen. Man vermutet, dass
die ausgekühlte Muskulatur der Tiere am Morgen gerade so funktionstüchtig ist, dass die Tiere
ohne großen zusätzlichen Energieaufwand sonnenbeschienen Plätze erreichen können. Dort
lassen sie sich - ähnlich wie wechselwarme Reptilien - passiv aufheizen. Das dauert solange,
dass ungestörte Tiere erst am Nachmittag wieder ihre volle Bewegungsaktivität erreichen.
Respekt vor dieser Leistung
Führt man sich die für uns nicht sichtbare Leistung vor Augen, versteht man, wie wichtig es ist,
die Ansprüche und Lebensräume der heimischen Arten zu respektieren. Denn der nächste Winter
kommt bestimmt, und er wird für unsere Tierwelt wieder ein Kampf ums Überleben.
Quelle und Bilder: www.alpenverein.de, www.alpenverein.at, www.bergwelten.com, www.naturvielfalt.at,
www.respektieredeinegrenzen.at
Ortsgruppe Neuhofen / Krems
www.alpenverein.at/linz-neuhofenEmilio Comici Der Engel der Dolomiten
Comici galt als Intellektueller, als Schöngeist, dessen Leben von
Kultur und der Liebe zur Natur geprägt war. Sein Selbstausdruck
orientierte sich an Eleganz und Ästhetik. Deutlich waren Parallelen zu
Hans Dülfer sichtbar, die sich auch in den Linien seiner
Erstbegehungen und der ausgefeilten, fast tänzerischen Feinheit seiner
Klettertechnik widerspiegelten. Er ging als das außergewöhnlichste
Talent der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen in der Geschichte
des Bergsteigens und Kletterns ein.
* 21. Februar 1901 in Triest
† 19. Oktober 1940 in Wolkenstein in Gröden
Dabei kam Leonarde Emilio Comici erst ziemlich spät, im Alter von
24 Jahren, zum Bergsteigen. Bis dahin beschäftigte er sich neben der
Kunst und Musik mit verschiedenen Sportarten, in denen er durchaus
erfolgreich war. Beruflich tätig zunächst als Beamter in den
Lagerhäusern des Hafens seiner Heimatstadt, fand er Gefallen an der Höhlenforschung (er stellte
sogar einen Tiefenrekord von 500m auf) und entdeckte dann das Klettern für sich, das fortan zur
Leidenschaft, zum Mittelpunkt seines Lebens wurde. Schnell zeigte sich sein außerordentliches
Talent, und er gehörte bald zu den besten Felskletterern des gesamten Alpenbogens.
Zwischen 1929 und 1930 gründete er die Kletterschule der Val Rosandra, welche immer noch
unter seinem Namen besteht. Unter seinen Schülern befanden sich einige spätere
Spitzenkletterer, wie beispielsweise Riccardo Cassin. Er stand für eine neuen Art den Beruf des
Bergführers zu verstehen. In seiner Tätigkeit war es nicht mehr möglich den Bergführer vom
Bergsteiger zu unterscheiden. Wie sein Lehrmeister Julius Kugy war auch er beides, und seine
Art dies weiterzugeben war von großer professioneller Korrektheit, Großzügigkeit und Mut
geprägt.
In der Folge unternahm er um die vierhundert schwere und schwerste Touren sowie rund
einhundert Erstbegehungen. Spätestens, als er im Mai 1931 eine bis heute selten wiederholte
Route in der gigantischen Nordwand der Civetta eröffnete, bewies er, dass er zu den fähigsten
Sestogradisten (Bergsteiger, der in der Lage ist, Aufstiege auf Routen der sechsten Schwierigkeitsgrades
durchzuführen) zählte, die den gerade erst als äußerste Grenze akzeptierten VI. Grad auch in ganz
großen Wänden in Vollendung beherrschten.
Nordwand der Großen Zinne
Und dann sein Meisterstück an der Nordwand der Großen Zinne!
Zusammen mit den Brüdern Angelo und Giuseppe Dimai überwand er
vom 12. bis 14. August 1933 die enormen Schwierigkeiten an der
rund 500 Meter hohen, für unmöglich gehaltenen Riesenmauer und
eröffneten damit die nach ihnen benannte Comici-Dimai-Route. Bei
dieser Durchsteigung verwendeten sie 400m Seil, 150m Reepschnurr,
90 Haken, Steigschlingen und 40 Karabiner. Mit dieser Tour war nun
die wohl begehrteste Wand in den Dolomiten durchstiegen. Doch
löste diese reine hakentechnische Kletterei in der damaligen
Bergsteigerszene auch eine Stil-Diskussion aus. Lange stritt man nach
dieser Tat, ob eine neue Ära des Alpinismus begonnen hätte oder die
Ortsgruppe Neuhofen / Krems
www.alpenverein.at/linz-neuhofenBerge um ein »Heiligtum« entweiht worden wären. Es war der neue Stil, der provozierte, weil
für damalige Verhältnisse vermehrt Haken und Karabiner, bisweilen auch zur Fortbewegung,
eingesetzt wurden.
Im Sommer 1937 wiederholte Comici seine Route als Alleingeher in nur 3,5 Stunden. Die Route
wurde damals mit dem Schwierigkeitsgrad VI bewertet. Heute ist die Wertung VI/A0 (UIAA)
bzw. in freier Kletterei VII (UIAA).
„So viele Haken, arme Nordwand“
(Emilio Comici nach seiner Alleinbegehung der Großen-Zinne-Nordwand,1937)
Aus heutiger Sicht darf man Comici allerdings als Kompositeur großzügiger Seillängen in
Freikletterei bezeichnen, der mit seiner Route an der Großen-Zinne-Nord dem Alpinismus ein
einzigartiges Denkmal schuf!
Erstbegehungen (Auswahl)
• 1928: Cima di Riofreddo, Nordwand, 8. August, mit Giordano Bruno Fabjan (ein mehr als
600m hohe Wand, vertikal und exponiert)
• 1929: Sorella di Mezzo al Sorapìs (Tre Sorelle-Sorapìs), mit Giordano Bruno Fabjan, die
erste italienische Ketterroute im VI Grades Schwierigkeitsgrat
• 1931: Civetta, Nord-West-Wand Comici-Benedetti, 4. bis 5. August 1931 mit Giulio
Benedetti, 1050 m, VI/A2
• 1933: Zuccone Campelli, Westwand, mit Riccardo Cassin , Mario Dell'Oro, Mary Varale
und Mario Spreafico, 140m, IV-
• 1933: Große Zinne, Nordwand, Comici/Dimai, 12. und 13. August, mit den Brüdern
Angelo und Giuseppe Dimai, technische Kletterei, 550m, damals mit VI bewertet, heute
ist die Wertung VI/A0 (UIAA) bzw. in freier Kletterei VII (UIAA).
• 1933: Kleine Zinne, Südkante Gelbe Kante/Spigolo Giallo, 8. bis 9. September mit Mary
Varale und Renato Zanutti, 350 m, VI+ (UIAA) oder V+/A0
• 1934: Punta di Frida, Direkte Süd-Ost-Wand, Comici, 2. August, mit Giordano Bruno
Fabjan, Vittorio Cottafavi und Gianfranco Pompei, 170 m, V/VI
• 1934: Torre Piccola di Falzarego, Südwand, 10. August, mit Mary Varale und Sandro
Del Torso, 230m, V - IV
• 1936: Torre Comici, Ostwand, 13. Juli, mit Sandro Del Torso und Renato Zanutti, 300m,
V, VI
• 1936: Finger Gottes, Nordwand, 8./9. September, mit Piero Mazzorana und Sandro Del
Torso, 600 m. VI
• 1940: Langkofel, Salamiturm (Campanile Comici), grandiose Route durch die Nordwand
28. und 29. August, mit Severino Casar, 450m, VI+ (UIAA)
• 1940: Torre Comici, Nordwand (seine letzte Erstbegehung)
Comici verbesserte seine Klettertechnik durch neue Bewegungsabläufe
und war Urheber einiger technischen Erfindungen bzw. Verbesserungen:
• Verbesserung der Klettertechnik durch Druck gegen die Wand
• Verbesserung der gegenseitigen Sicherheitstechnik
• Erfindung des Comici-Knotens und der Schulterbremsung
• Verbesserung einiger Felshaken, des Schuhwerkes und der
Bekleidung
Ortsgruppe Neuhofen / Krems
www.alpenverein.at/linz-neuhofenEmilio Comici, konnte mit seiner Bescheidenheit, Leidenschaft und
Liebe zu den Bergen konnte. Er verfügte über die besondere Begabung
die Logik einer Kletterroute zu erkennen, dieser Linie zu folgen und
dabei die schwierigsten Passagen zu lösen umso ein unmöglich
scheinendes Ziel zu erreich. Für ihn stellt der Alpinismus eine
Hingabeform zu einem höheren Ideal dar. Neben seiner Tätigkeit als
„Bergsteiger“ war er als Direktor der Skischule von Wolkenstein tätig
und zwischen 1938 und 1940 Bürgermeister des Ortes.
Emilio Comici, der sich als Meister in den schwierigsten
Routen seiner Zeit erwies, starb am 19. Oktober 1940
durch Absturz in der Kletterwand Parëi de Ciampac im
Langental nahe Wolkenstein. Ursache für sein tragisches
Ende war der Riss einer Abseilschlinge. Heute gehört die
Parëi de Ciampac zum 1995 eingerichteten Klettergarten
Busc dl Preve, der Emilio Comici gewidmet ist. Ein dort
aufgestelltes geschnitztes Holzmonument erinnert an ihn.
Rifugio Zsigmondy-Comici
Nach Comici wurden der Rifugio Zsigmondy-Comici in
den Sextner Dolomiten, die Emilio-Comici-Hütte und
der Campanile Comici, beide in der Langkofelgruppe,
benannt.
Quelle: www.bergsteiger.de, www.wikipedia.org, www.paretiverticali.it, www.tarvisiano.org
Ortsgruppe Neuhofen / Krems
www.alpenverein.at/linz-neuhofenSie können auch lesen