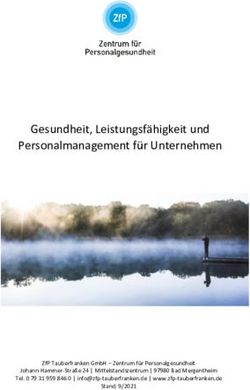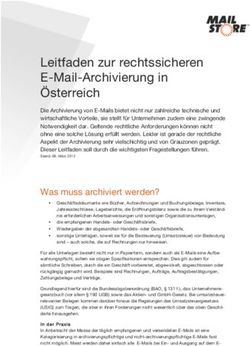Arbeits- und Innovationsfähigkeit sichern - Demographische Entwicklung als Herausforderung Jahrestagung der DGFP am 22. und 23. Mai 2003 in ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Demographische Entwicklung als Herausforderung
Arbeits- und Innovationsfähigkeit sichern
Jahrestagung der DGFP am 22. und 23. Mai 2003 in Wiesbaden
Michael Astor
22.05.2003Gliederung des Vortrags:
„Arbeits- und Innovationsfähigkeit sicher“
n Die PROGNOS AG im Überblick
n Ökonomische Rahmendaten
n Entwicklungstrends: Innovation als Triebfeder der Wirtschaft
n Betriebliche Rahmenbedingungen des Personalmanagements
ÜBERSICHT
n Strategien für das Innovations- und Personalmanagement
n FazitDie Prognos AG im Überblick
Die Prognos AG:
Zukunft als Herausforderung – Tradition als Referenz
n 1959, Basel: Gründung von Prognos als „Think Tank“, der eine
Brücke zwischen Theorie und Praxis schlägt
n erster deutscher Standort in Köln 1979
n 1981: Das erste „Prognos Zukunftsforum“
n Gründung des Berliner Büros 1986
n weitere Standorte kommen in den 90er Jahren dazu
(Brüssel, Bremen)
GESCHICHTE
Heute zählt Prognos in seinen Themenfeldern zu den führenden
Beratungsunternehmen in Europa.
Rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten in über 150
Projekten Unternehmen, öffentliche Auftraggeber und
internationale Organisationen.
In vielen Vorträgen, Veröffentlichungen und Medienbeiträgen
vermitteln Prognos-Experten Ihre Kompetenz.Die Prognos: Fokus Zukunft
– Orientierung für das Morgen
Prognos
Prognosentwickelt
entwickelt––auf
aufder
derBasis
Basisfundierter
fundierterAnalysen
Analysen
und
undPrognosen
Prognosen––interdisziplinär,
interdisziplinär,unvoreingenommen
unvoreingenommen
und
undunabhängig
unabhängigProblemlösungen
Problemlösungenzu zuZukunftsfragen
Zukunftsfragen
für
für internationale Kunden aus Wirtschaftund
internationale Kunden aus Wirtschaft undPolitik.
Politik.
Die
DieStärke
Stärkeder
derPrognos
Prognosliegt
liegtininder
derumfassenden
umfassenden
Analyse
Analyseund
undBewertung
BewertungvonvonZukunftstrends
Zukunftstrendsdurch
durch
WAS WIR TUN
systematische
systematischeVernetzung
Vernetzungvon vonnatur-,
natur-,geistes-
geistes-und
und
sozialwissenschaftlichen
sozialwissenschaftlichenErkenntnissen.
Erkenntnissen.Die Zukunft ist vielschichtig
Deutschland Report, World Reports, Transport Report,
Zukunftstrends
Zukunftstrendsder
derPolitik
Politikund
undMärkte
Märkte
Prognos Zukunftsforum, Trenddinner, Konferenzen
Innovation der Systeme
Innovation der Systeme
Zukunft
Zukunftder
derGlobalisierung
Globalisierungvon
vonWirtschaft,
Wirtschaft,Finanzen,
Finanzen,
Arbeit,
Arbeit,Soziales
Sozialesund
undBildung
Bildung
Energie-,
Energie-,Umwelt-,
Umwelt-,Ver-
Ver-und
undEntsorgungswirtschaft
Entsorgungswirtschaft
Strategie
Strategieund
undOrganisation
Organisation––Public
PublicManagement
Management
Zukunft
Zukunftder
derMedien
Medien
Konvergenz der Kommunikationstechnologien
Konvergenz der Kommunikationstechnologien
Zukunft
Zukunftvon
vonVerkehr
Verkehrund
undInfrastruktur
GANZHEITLICH
Infrastruktur
Zukunft
Zukunftder
derRegionen
Regionen
mediareports
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung undRegionalentwicklung
und Regionalentwicklung
Daten
Datenund
undFakten
Faktenzur
zurEntwicklung
Entwicklung
von Wirtschaft und Bevölkerung
von Wirtschaft und Bevölkerung„Wer plant, braucht eine Vorstellung von der Zukunft.
Die Prognos Reports helfen uns, diese Vorstellung zu
entwickeln.“
Prof. Dr. Norbert Walter, Chefvolkswirt der Deutsche Bank Gruppe
Der Deutschland Report
Die umfassende Entscheidungshilfe
zur Zukunft der Bundesrepublik auf
der Grundlage eines konsistenten
Szenarios
Die Prognos mediareports
Das Planungspaket zu den Kommuni-
kations- u. Medienmärkten: 7 Themen-
reports und der Premiumreport für den
integrierten Überblick
Die World Reports
Kurz-, Mittel- und Langfristprognosen
zu Volkswirtschaften und Märkten
für 90% der Weltwirtschaft
REPORTS
Der European Transport Report
Analyse- und Prognosedaten zur
Entwicklung der Verkehrsnachfrage
im Personen- und Güterverkehr in 22
europäischen LändernÖkonomische Rahmendaten
Erwerbspersonen/Bevölkerung
%
15
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
-1
9
20
-2
4
25
-2
9
30
-3
4
35
-3
9
40
-4
4
45
-4
9
Männer
50
-5
4
55
-5
9
60
-6
4
65
Erwerbsquoten Deutschland
+
2000
15
Alter
-1
9
20
-2
2020
4
25
-2
9
30
-3
4
35
-3
9
40
-4
4
45
-4
9
50
Frauen
-5
4
55
-5
9
60
-6
4
65
+
ARBEITSKRÄFTEArbeitskräfte Deutschland 2020: -5 Mio unter 50, +5 Mio über 50
15 45
2000 2020
12 36
Mio Personen
9 27
6 18
ARBEITSKRÄFTE
3 9
0 0
20-29 30-39 40-49 50-64 insgesamt
AlterEntwicklungstrends
Fragen des Wandels der Erwerbsbevölkerung lassen sich nur
im Kontext gesamtbetrieblicher Strategien diskutieren.
n Die „demographische Frage“ ist nur in wenigen
Unternehmen als strategisches Handlungsfeld verankert.
n Unternehmerisches Ziel ist, Leistungs-, Innovations- und
Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten bzw. zu verbessern.
n Nur in diesem Kontext lassen sich Strategien und
Maßnahmen diskutieren, die sich mit der Sicherung der
Wissensbasis, der Aufbau- und Ablauforganisation,
Führungsinstrumenten und Qualifikationspotentialen
beschäftigen.Die (Innovations-) Strategie entscheidet über den
Unternehmenserfolg.
(Unternehmens)Standortfaktoren
Zufällige Wirtschafts-
Ereignisse politische
Organisations-, Rahmenbe-
Innovations- dingungen
kultur
Strategie Strategie
INNOVATIONSTRATEGIE
Know-How
Innovations-
Personen u. Externe
tätigkeit
Organisa- Kontakte
tionen
Strategie Finanzierungs- Strategie
möglichkeiten
nach: Teece 1998
Industriestruktur
(Wettbewerber, Abnehmer etc.)Unternehmen im 21. Jahrhundert
Haupttrend: Verwissenschaftlichung und Globalisierung
n Beschleunigung: schnellere Abfolge der Innovationszyklen
n Erweiterung von Service- und Dienstleistungsangeboten
n Notwendigkeit zu interdisziplinären Kooperationen
(intern und extern, national und international)
UNTERNEHMEN
n hoher Wettbewerbsdruck:
Kosten / Preise, Qualität, time to marketArbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im 21. Jahrhundert
n Schnellerer Verfall des Wissens
n Notwendigkeit zu lebenslangem Lernen
n Hohe Anforderungen an:
ARBEITNEHMER / -INNEN
• fachliche Qualifikationen
• Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme
• kommunikative Kompetenzen und
• sprachliche FähigkeitenProzesswissen und Fachwissen bilden das Spannungsfeld
betrieblichen und individuellen Handelns.
hoch
Prozesswissen
Fachwissen
neu
Aktualisierung
Fachwissen
WISSEN
alt
niedrig t
ErwerbsbiographieBetriebliche Rahmen- bedingungen des Personalmanagements
Anforderung an Organisationsstrukturen
n Förderung von Interdisziplinarität und funktionsüber-
greifender Zusammenarbeit (Kombination von
Erfahrungswissen mit neuen Wissensinhalten)
n Systematische Organisation des inner- und
zwischenbetrieblichen Wissenstransfers (Wissenstransfer
findet im konkreten Produktentwicklungsprozess statt)
n Auflösung starrer Strukturen: erhöhte Flexibilität
STRUKTUREN
n Dezentralisierung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten
n Kundenorientierung als Leitbild der OrganisationAnforderung an Unternehmenskultur
n Etablierung von neuen Leitbildern:
Neue Innovations- und Managementleitbilder (z.B.
managing diversity) berücksichtigen das Know how und
die Entwicklungspotentiale aller Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.
n Veränderungsdynamik als aktiven Gestaltungsprozess
begreifen und auf allen Unternehmensebenen
implementieren.
n Veränderungsanreize schaffen und gleichzeitig Sicherheit
und Orientierung vermitteln.
KULTURAnforderungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
n Kontinuierliche Aktualisierung des Wissens
(lebenslanges Lernen)
n Erweiterung der Kompetenzen: Betreuung der Produkte
über gesamten Entwicklungs- und Lebenszyklus
n Soziale Kompetenzen in komplexen Prozessen:
Wachsende Bedeutung von Erfahrungswissen
ANFORDERUNGEN
n Notwendigkeit zu mehr Eigenverantwortung und
Selbststeuerung
(prozessbezogen, Karriere-, Laufbahnplanung)In der Vergangenheit war die Abstimmung zwischen
betrieblichem Innovations- und Personalmanagement häufig
unzureichend.
Grundwiderspruch:
n Formal hohe Bedeutung des Innovationsmanagements und des
UNTERSUCHUNGSBEFUND
Wissenstransfers
Aber:
n Personalmanagement nimmt in der strategischen Unter-
nehmensentwicklung zumeist einen geringen Stellenwert ein
n Teambildungsprozesse vernachlässigen die Integration von
Erfahrungs- und Prozesswissen
n Personalentwicklungsplanung und Rekrutierungsstrategien sind nach
wie vor altersselektivStrategien für das Innovations- und Personalmanagement
Innovative Unternehmen: nutzen die Potentiale aller
Belegschaftsmitglieder
n Unternehmensstrategie:
Innovationsziele und Personalpolitik miteinander abstimmen.
SOUVERÄNE INNOVATOREN
n „Souveräne Innovatoren“:
technisch – marktlich - personalpolitisch.
n Demographie:
Innovative Betriebe lösen das “Problem ältere Mitarbeiter” nicht
ausschließlich durch Ausgliederung und Vorruhestand,
sondern durch Integration in alle betrieblichen Prozesse.Umsetzung in eine innovations- und personalorientierte
Unternehmensstrategie
n Notwendigkeit der präventiven Ausrichtung und engeren
Verzahnung von betrieblichen Innovations- und Personalstrategien
n stärkere Koordination und Kooperation
n ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilden per se keine
„Problemgruppe“
n Förderung der Bereitschaft der Mitarbeiter, Veränderungsprozesse
aktiv zu gestalten
STRATEGIE
n Neuorganisation von Teambildungsprozessen mit dem Ziel der
Zusammenführung unterschiedlicher Wissenskulturen
n erforderliche Moderation und Begleitung von Maßnahmen und
ProzessenGood Practice-Elemente eines innovationsorientierten
Personalmanagements
Organisationsebene: Individuelle Ebene:
n Projektorientierte n Langfristige Laufbahnplanung
Organisationsformen (horizontal/vertikal)
n Horizontale KuK-Strukturen n Fähigkeit zur Prozess- und
(Kooperationsmanagement) Technologiebeherrschung
n Simultaneous Engineering n Förderung cross-funktionaler
GOOD PRACTICE
Kompetenzen
Teamebene:
n Teamempowerment n Anforderungsbezogene
Qualifizierung ohne
n Erzeugung von komple- Altersmarken
mentärem Wissen durch
Teambildung n Dynamische Fähigkeiten
n Modifizierte LeistungssystemeInnovationsorientiertes Personalmanagement muss
unterschiedliche Handlungsebenen berücksichtigen.
Strategie
Mittelfristige
Perspektiven
HANDLUNGSEBENEN
entwickeln
Interdiszi- Veränderungs-
plinarität dynamik
ermöglichen gestalten
Struktur KulturFazit
Schon heute ist es erforderlich, Strategien zu entwickeln, die
ein Überleben in der Zukunft ermöglichen
Erforderliche Schritte
n „Junge und Mittelalte“ heute qualifizieren, um morgen leistungsfähige,
ältere Arbeitnehmer zu haben
n Ausbildung als Basis einer langfristig orientierten Lernkultur
ZUKUNFTSSTRATEGIEN
n stärkere Orientierung auf grenzüberschreitende Kooperation in
Technologieentwicklung und Personalpolitik
n internationales Arbeitskräftepotential als zusätzliche Ressource
begreifen
n konjunkturelle Schwankungen durch Rotationsmodelle kompensierenMichael Astor Prognos AG Dovestrasse 2-4 D-10587 Berlin Telefon +49 (0)30-39922-850 Telefax +49 (0)30-39922-801 michael.astor@prognos.com www.prognos.com
Sie können auch lesen