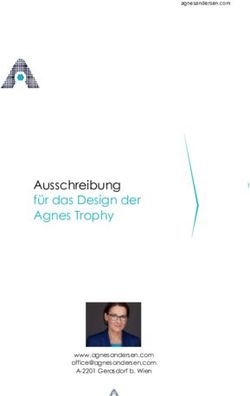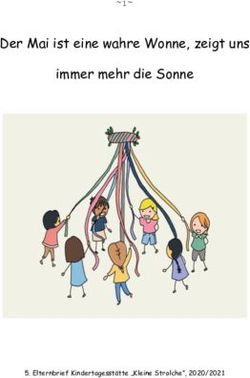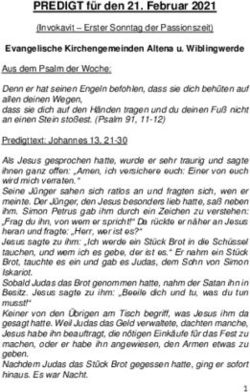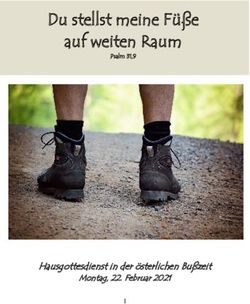Aufgaben D RS Klasse 9 bis zum 8.2.2021
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Aufgaben D RS Klasse 9
bis zum 8.2.2021
1. Unterlagen für „Nathan und seine Kinder“ vollständig bereitstellen.
2. Buch mitbringen
3. Eines der beiden Gedichte von J.W.v. Goethe auswendig lernen und
die dazugehörigen Angaben genau lesen und stichpunktartig
aufschreiben (Es folgt eine schriftliche LK zum Text und den Angaben, je
nach Stundenplan 8.2.? 9.2.? 10.2,?)
Willkommen und Abschied
ist eines der Sesenheimer Lieder von Johann Wolfgang Goethe. Es zählt zu
seinen berühmtesten Gedichten und erschien (noch ohne Titel) erstmals 1775
in der „Damenzeitschrift“ Iris. Die zweite Fassung erschien 1789
als Willkomm und Abschied. In der Werkausgabe 1810 erschien
das Gedicht dann zum dritten Mal, und erstmals unter dem Titel Willkommen
und Abschied, unter dem es heute bekannt ist.
Entstehung
Goethe schrieb das vierstrophige, durchgehend im Kreuzreim stehende Liebeslied in
seiner Straßburger Zeit, wohl im Frühling 1771 damals sehr hingerissen von
der Sessenheimer Pfarrerstochter Friederike Brion.
Ähnlich wie das kurz zuvor niedergeschriebene Mailied wird es noch der Sturm-und-
Drang-Zeit der deutschen Dichtung zugerechnet. Der rasche Wechsel der Gefühle
und Eindrücke und der ekstatische Schluss können dies rechtfertigen.
Inhalt
Das Gedicht ist aus der Perspektive eines Jünglings geschrieben, der in der
Vergangenheitsform von einem Treffen mit seiner Geliebten erzählt. In aufgewühlter
Stimmung beschreibt das lyrische Ich zunächst die beängstigende nächtliche
Landschaft, durch die es reitet; darauf wird ekstatisch die Begegnung mit dem –
direkt angesprochenen – Mädchen und schließlich in einem ständigen Wechsel von
Freude und Schmerz der Abschied geschildert.
Text
Der von Goethe mehrfach überarbeitete Text lautete in der frühesten Form,[2] bei der
das Mädchen den Geliebten noch bis zu seinem Pferd begleitet:
Es schlug mein Herz, geschwind, zu Pferde!
Es war getan fast eh gedacht.
Der Abend wiegte schon die Erde,
Und an den Bergen hing die Nacht;
Schon stand im Nebelkleid die Eiche
Ein aufgetürmter Riese, da,
Wo Finsternis aus dem Gesträuche
Mit hundert schwarzen Augen sah.Der Mond von einem Wolkenhügel
Sah kläglich aus dem Duft hervor,
Die Winde schwangen leise Flügel,
Umsausten schauerlich mein Ohr;
Die Nacht schuf tausend Ungeheuer,
Doch frisch und fröhlich war mein Mut:
In meinen Adern welches Feuer!
In meinem Herzen welche Glut!
Dich sah ich, und die milde Freude
Floß von dem süßen Blick auf mich;
Ganz war mein Herz an deiner Seite
Und jeder Atemzug für dich.
Ein rosenfarbnes Frühlingswetter
Umgab das liebliche Gesicht,
Und Zärtlichkeit für mich - ihr Götter!
Ich hofft es, ich verdient es nicht!
Doch ach, schon mit der Morgensonne
Verengt der Abschied mir das Herz:
In deinen Küssen welche Wonne!
In deinem Auge welcher Schmerz!
Ich ging, du standst und sahst zur Erden
Und sahst mir nach mit nassem Blick:
Und doch, welch Glück, geliebt zu werden!
Und lieben, Götter, welch ein Glück
Weblinks
Wikisource: Willkommen und Abschied (1775) – Quellen und Volltexte
Wikisource: Willkommen und Abschied (1827) – Quellen und Volltexte
Einzelnachweise
1. ↑ Vermutung von Erich Trunz (Hrsg.): Goethes Werke. Hamburger Ausgabe, Bd. I, Christian Wegner, Hamburg 1948,
S. 453.
2. ↑ Nach der Abschrift aus Friederike Brions Nachlass. Siehe Erich Trunz (Hrsg.): Goethes Werke. Hamburger
Ausgabe, Bd. I, Christian Wegner, Hamburg 1948, S. 28 f.Prometheus
ist der Titel einer Ode oder Hymne Johann Wolfgang von Goethes. Das Werk gehört zu seinen
bekanntesten Gedichten und ging aus dem gleichnamigen Dramenfragment hervor.
Entstehung
Prometheus wurde zwischen 1772 und 1774 verfasst. Wie auch die anderen Hymnen Mahomets
Gesang, Ganymed, An Schwager Kronos entstand dieses Werk in Goethes Sturm-und-Drang-
Zeit. Friedrich Heinrich Jacobi druckte die Hymne erstmals in seiner Schrift „Über die Lehre
des Spinoza in Briefen an den Herrn Moses Mendelssohn“ unautorisiert und anonym ab. Goethe
nahm sie erst 1789 in seine neu edierten Schriften auf und ließ sie zusammen mit der Ganymed-
Ode erscheinen. Die Form der Hymne (oder Ode) ist die lyrische Ausdrucksform, die dem Sturm
und Drang am ehesten gerecht wird, denn in ihr treten mythische Figuren auf, die als
Repräsentanten der Künstler des Sturm und Drang betrachtet werden können und die somit das
Dilemma von Kunst und Leben verkörpern. Ein Hauptanliegen des Sturm und Drang ist das
Überwinden von überkommenen Autoritäten, und damit kann Prometheus als programmatisch für
diese Epoche gesehen werden.
Bei einer Hymne handelt es sich normalerweise um einen Lobgesang; dieses Prinzip wird aber
hier ins Gegenteil verkehrt, denn Prometheus preist die Götter keineswegs, sondern erhebt eine
Klage gegen sie, die von Vorwürfen, aber auch Spott geprägt ist. Er spricht Zeus rebellisch, ja
verachtungsvoll an und vergleicht ihn mit einem Kind, das seine Wut an der Welt auslässt, wie
ein Knabe, der „Disteln köpft“:
Bedecke deinen Himmel, Zeus,
Mit Wolkendunst,
Und übe, dem Knaben gleich,
Der Disteln köpft,
An Eichen dich und Bergeshöhn; […]
Prometheus will die Götter entthronen. Er sieht in ihnen mitleidlose, schmarotzerische und
neidische Gestalten, die auf erbärmliche Weise von Rauchopfern der Menschen abhängig sind.
Diese Thematik ist typisch für die Epoche des Sturm und Drang, in der der Begriff
des Genies eine etwas andere Bedeutung hatte als heute: Der geniale, schöpferische Mensch
sprengt – nach damaliger Auffassung – alle Fesseln und Beschränkungen und erstarkt an
Schicksalsschlägen, was auch heißt, dass er ihnen nicht ausweicht.
Allerdings muss die Prometheus-Ode nicht grundsätzlich als eine Absage an die Religion
aufgefasst werden, sondern kann auch als Projektionsfläche für die Lehre, nach der Gott in allen
Dingen der Welt existiert, der damaligen Zeit gelesen werden.
Form
Das Gedicht ist (bis auf den drittletzten und letzten Vers, welche dadurch herausgehoben
werden) reimlos in freien Rhythmen geschrieben, die sich bei Goethe insbesondere in der Lyrik
seiner Sturm-und-Drang-Zeit finden. Die Form unterstreicht so die Aussage des Gedichts. Die
vielen Unregelmäßigkeiten in der Form spiegeln die für den Sturm und Drang typische
Gefühlsbetontheit und Kühnheit des Helden wider.
Prometheus
Bedecke deinen Himmel, Zeus,
Mit Wolkendunst
Und übe, dem Knaben gleich,
Der Disteln köpft
An Eichen dich und Bergeshöhen!
Mußt mir meine Erde
Doch lassen stehen
Und meine Hütte die du nicht gebaut,
Und meinen Herd,
Um dessen Glut
Du mich beneidest.Ich kenne nichts Ärmeres
Unter der Sonn als euch, Götter!
Ihr nähret kümmerlich
Von Opfersteuern
Und Gebetshauch
Eure Majestät
Und darbtet, wären
Nicht Kinder und Bettler
Hoffnungsvolle Toren.
Da ich ein Kind war,
Nicht wußte, wo aus noch ein,
Kehrt ich mein verirrtes Auge
Zur Sonne, als wenn drüber wär
Ein Ohr, zu hören meine Klage,
Ein Herz wie meins,
Sich des Bedrängten zu erbarmen.
Wer half mir
Wider der Titanen Übermut?
Wer rettete vom Tode mich,
von Sklaverei?
Hast du nicht alles selbst vollendet,
Heilig glühend Herz?
Und glühtest jung und gut,
Betrogen, Rettungsdank
Dem Schlafenden da droben?
Ich dich ehren? Wofür?
Hast du die Schmerzen gelindert
Je des Beladenen?
Hast du die Tränen gestillet
Je des Geängsteten?
Hat nicht mich zum Manne geschmiedet
Die allmächtige Zeit
Und das ewige Schicksal,
Meine Herrn und deine?
Wähntest du etwa,
Ich sollte das Leben hassen,
In Wüsten fliehen,
Weil nicht alle Blütenträume reiften?
Hier sitz ich, forme Menschen
Nach meinem Bilde,
Ein Geschlecht das mir gleich sei,
Zu leiden, zu weinen,
Zu genießen und zu freuen sich
Und dein nicht zu achten,
Wie ich!de.wikipedia.org
Christian Winther: »Prometheus« - Samlede Digtninger, 2. Bind (1860) Wi
Ich wünsche gutes Gelingen.
Bleibt gesund.
Vergesst die Unterlagen nicht, sie sind wichtig für die
Literaturarbeit in der Woche ab 8.2.2012!
Es grüßt A. Laarz 11.01.2021Sie können auch lesen