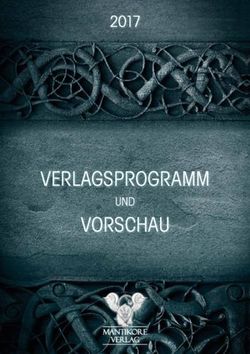Ausdruck vor dem "Ausdruck". Notation, (e)motion und die mittelalterliche "Kultur der Geste"
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Ausdruck vor dem »Ausdruck«.
Notation, (E)motion und die mittelalterliche
»Kultur der Geste«
Die beinahe komplementäre Beziehung der weder je vollständig bewiesenen, noch
aber falsifizierten Deutung der Cheironomie durch Sachs und Hickmann bereitet
zunächst aber einen historiographisch vielversprechenden Ansatz, die Rolle der
multimodalen Funktion musikalischer Hand- und Körperbewegungen in der euro-
päischen Musikgeschichte weiter zu verfolgen. Ausgegangen werden kann dabei
sogar von der persönlichen Beziehung zwischen Sachs und Oskar Fleischer, einem
seiner akademischen Lehrer und Amtsvorgänger als Leiter der Berliner Instrumen-
tensammlung.34 Fleischer leitete schon in seinen Neumen-Studien von 1895, die
eine langjährige Auseinandersetzung mit dem katholischen Gregorianik-Forscher
Peter Wagner zur Folge hatten, aus ihrer Deutung als Akzentzeichen den cheirono-
mischen Ursprung adiastematischer Neumensymbole ab. Demzufolge zeigte »der
Chordirigent […] durch eine aufsteigende Handbewegung einen aufsteigenden
Tonschritt an [und] durch eine absteigende Handgebärde bezeichnete er eine fal-
lende Tonbewegung«, so dass »durch die Bewegungen der Hand […] eine einfache
Melodie in die Luft geschrieben werden« konnte und die für die »einzelnen Gebär-
den jener bewegten Schrift« gebräuchliche Bezeichnung Neuma auf die Notations-
zeichen überging.35 In der eingangs erläuterten doppelten Optik der historischen
Aneignung und psycho-physischen Aktualisierung älterer Musik erscheint es als
aufschlussreich, dass auch Fleischer sich in den 1920er Jahren herausgefordert
sieht, seine bereits in eine deiktisch-zeichenhafte Funktion der Handbewegung
mündenden Überlegungen durch zeitgenössische Referenzen zu ergänzen:
Neumen nannte und nennt man die stenographieartigen Zeichen, mit denen das
Mittelalter seine Melodien niederschrieb, indem man, ähnlich wie der Stift des Pho-
nographen auf der Wachsplatte, die Auf- und Abbewegungen des Kehlkopfes beim
Singen schriftlich abmalte. Dieses Nachmalen nennt man Cheironomie.36
34 Vgl. zu Fleischers wissenschaftlichem Wirken auch Alfred Berner: »Die alte Musikinstru-
menten-Sammlung in Berlin«, in: Wege zur Musik herausgegeben anlässlich der Eröffnung des
neuen Hauses, hg. vom Staatlichen Institut für Musikforschung Preußischer Kulturbesitz
Berlin, Berlin (SIM) 1984, S. 11–123, darin S. 49–74.
35 Oskar Fleischer: Neumen-Studien. Abhandlungen über mittelalterliche Gesangstonschriften.
Theil 1. Über Ursprung und Entzifferung der Neumen, Leipzig (Fleischer) 1895, S. 39 f.
36 Oskar Fleischer: Die Germanischen Neumen als Schlüssel zum altchristlichen Gregorianischen
Gesang, Frankfurt (Frankfurter Verlags-Anstalt) 1923, S. 1. Bereits der Titel des inmitten
der Inflationswirren erschienenen Buchs weist auf das Engagement ihres (zumal seit der
Zusammenarbeit mit dem alldeutschen Prähistoriker Gustaf Kossina) nach rechts driften-
Tobias Robert Klein - 9783846759455
Downloaded from Brill.com10/22/2021 12:14:59AM
via free access42 Alte Musik
In der hier angedeuteten medientechnologischen Analogie zur im Geschäfts- und
Verwaltungswesen verbreiteten Stenographenschrift, vor allem aber zu den Schall-
schwingungen des Phonographen manifestieren sich Spuren von Fleischers zwanzig
Jahre früherem, in einer heftigen Kontroverse mit Carl Stumpf resultierenden Enga-
gement für ein obskures photo-phonographisches Aufnahmegerät. Nicht nur den
»Aufnahmeapparat mit seiner Membrane und dem daransitzenden Spiegelchen«
beschrieb der enthusiasmierte Musikhistoriker 1903 als Nachbildung des menschli-
chen Gehörs (»wobei die Membrane das Trommelfell, das an einem Hebelstiel sit-
zende Spiegelchen das Hammerknöchelchen und der Lichtstrahl sozusagen den
Gehörnerv vertritt«), sondern auch die Schallwiedergabe wird als »Abbild der
Sprachwerkzeuge des Menschen« erklärt: »Die geschlitzte Membrane stellt die
Stimmbänder dar, der aufgesetzte Schalltrichter ist innen wie die Mundhöhle gebil-
det und mit einer fleischartigen Masse zur Abdämpfung der Eigentöne des Tubus
ausgekleidet«.37 So wenig Fleischers auf das cheironomische Modell gestützte und
bereits von Hugo Riemann kritisierte38 diastematische Lesart adiastematischer Neu-
men heute noch ernstlich verteidigt wird, so schärft die wissensgeschichtliche Kon-
textualisierung solcher Holz- und Nebenwege jedoch das Bewusstsein für eine Di-
mension der Neumenschrift, die auch zu Zeiten eines selbst die Musikologie
usurpierenden »pictorial hype« nach wie vor mit körperlich-motionalen Prozessen
zu rechnen hat. Zu den zahlreichen Volten der Forschungsgeschichte gehört näm-
lich auch, dass ausgerechnet der deutschnationale Musikhistoriker Fleischer sich als
einziger Neumeninterpret für die erst in jüngster Zeit wieder ausführlich untersuch-
den Verfassers im Kreis um das völkische Magazin Die Sonne hin, wenngleich die eingangs
entwickelte Analogie von Neumen- und Phonographenschrift gerade kein gestörtes Ver-
hältnis zur technologischen Moderne zeigt.
37 Oskar Fleischer: »Photophonographie«, in: Zeitschrift der Internationalen Musikgesellschaft 4
(1902/3), S. 301–308. Vgl. für Stumpfs Replik »Die Demonstration in der Aula der Berli-
ner Universität am 6. Februar 1903«, in: Zeitschrift der Internationalen Musikgesellschaft 5
(1903/03), S. 431–443 sowie ferner Fleischers wenig glückliche Reaktion Zur Photophono-
graphie: Eine Abwehr, Berlin (Selbstverlag) 1904. Der von Fleischer propagandistisch unter-
stützte Prager Techniker Emmanuel Cervenka gab vor, mittels der photoplastischen Vertie-
fung von Klangkurven (im Cliché-Verfahren) die durch die Reflektion eines zunächst zu
einer mit einem Spiegel verbundenen Membran gelenkten Lichtstrahls auf eine photosensi-
tive Platte entstehen, eine gegenüber dem Grammophon verbesserte Wiedergabequalität zu
erzielen. Stumpf witterte sowohl aufgrund erheblicher Unstimmigkeiten bei der auf die
Verwendung konventioneller Grammophonplatten zurückgreifenden Präsentation des Ge-
räts als auch der durch das Ätzverfahren prinzipiell unvermeidlichen klanglichen Unschär-
fen einen handfesten Betrugsversuch. Ein ähnliches Gerät ist später, wenngleich eben gera-
de nicht zum Zwecke der Klangwiedergabe, sondern dem Detailstudium photographisch
fixierter Klangkurven, in dem von Carl Seashore geleiteten »Iowa laboratory for the psycho-
logy of music and speech« verwendet worden. Vgl. Milton Methfessel: Phonophotography in
Folk Music. American Negro Songs in New Notation, Chapel Hill (University of North Caro-
lina Press) 1928.
38 Hugo Riemann: Handbuch der Musikgeschichte, Leipzig (Breitkopf & Härtel) 31923, Bd. 2,
S. 83–86.
Tobias Robert Klein - 9783846759455
Downloaded from Brill.com10/22/2021 12:14:59AM
via free accessAusdruck vor dem »Ausdruck« 43
ten melodisch-räumlichen Handbewegungen der indischen Musiktraditionen inte-
ressierte39 und posthum zudem zu einer wichtigen theoretischen Anregung für Ad-
ornos Erwägungen zur »Sinnesgeschichte der musikalischen Schrift«40 avancierte.
In der weiteren Forschung zur europäischen Neumennotation wurden und
werden aufgrund der erheblichen Heterogenität der verschiedenen Typen mit un
terschiedlicher Überzeugungskraft verschiedene Positionen41 zur Herkunft und
Bedeutung ihrer Symbole vertreten: Adaptation alexandrinischer prosodischer
Akzentzeichen (wie accutus, grave, circumflex), die Übernahme byzantinischer auf
dem Akzent basierender Modelle, cheironomische Handgesten, Verwendung von
im karolingischen Scriptorum zur Textbetonung gebrauchter Punktuationszeichen
oder der Rückgriff auf für melodische Kurzformeln stehende ekphonische Symbo-
le. Kenneth Levy verband dieses Deutungsproblem heuristisch mit der ebenso um-
strittenen Frage nach dem geographischen Ursprung der Neumensymbole.42 So
erklärte Froger43 die Entstehung geographischer Varianten zunächst aus einer ver-
lorenen Urquelle, zwischen denen sich erst später wieder Beziehungen und Quer-
verbindungen etablieren. Corbin und Cardine44 betonen hingegen die im 9. Jahr-
hundert zwischen Rhein und Seine erfolgte Aufzeichnung von Lektionen, Tropen
und Sequenzen,45 während Leo Treitler, Helmut Hucke und Theodore Karp auf die
Bedeutung der parallel zur allmählichen Verschriftlichung über 900 hinaus wichti-
gen oralen Transmission verwiesen.46 Levy selbst vertritt dabei die gegen die Exis-
39 Matt Rahaim: »Gesture and melody in Indian vocal music«, in: Gesture 8 (2008), S. 325–
347.
40 Adorno: Zu einer Theorie der musikalischen Reproduktion (Anm. 4), S. 230–234.
41 Vgl. Nancy Phillips: »Notationen und Notationslehren von Boethius bis zum 12. Jahrhun-
dert«, in: Thomas Ertelt/Frieder Zaminer (Hg.): Die Lehre vom einstimmigen liturgischen
Gesang (= Geschichte der Musiktheorie, Band 4), Darmstadt (WBG) 2000, S. 293–623,
dort zahlreiche weitere Literaturhinweise zu den verschiedenen Theorien.
42 Kenneth Levy: Gregorian chant and the Carolingians, Princeton (Princeton University Press)
1998, S. 109–139.
43 [Dom Jacques Froger]: Le graduel romain. Edition critique, Bd. 4/2 (Le texte neumatique:
Les relations genéalogiques des manuscripts) Solesmes (Abbaye Saint-Pierre) 1962, S. 92.
44 Dom Eugène Cardines vor allem für die Choralpraxis folgenreiche Gregorianische Semiolo-
gie, Solesmes (Les Éditions de Solesmes) 2003 (ital. Original 1968), besonders S. 3–4 ver-
bindet für seine Erklärung der Genese der Neumennotation als eine Form verschriftlichter
Gesten die Ableitung einzelner Symbole aus Akzentzeichen (virga, tractus) und der sprach-
lichen Punktuation (oriscus, quilisma) mit dem systematischen Prinzip »eine Melodie
durch einen Gestus zu übermitteln und den Gestus durch ein Schriftzeichen zu fixieren.«
45 Solange Corbin, »Les notations neumatique en France à l’epoque carolingienne«, in: Revue
d’ Histoire de l’eglise en France 38 (1952), S. 22–42 und dies.: »Die Neumen«, in: Wulf Arlt
(= Palaeographie der Musik, Bd. 1/3, Köln (Volk) 1977, S. 22–42. Phillips (Anm. 41) ver-
wies in neuerer Zeit auf die Goten in Spanien und Südgallien als eine kulturvermittelnde
und bisher »am meisten übersehene Karolingische ›Ressource‹« (S. 524).
46 Vgl. Helmut Hucke: »Towards a New Historical View of Gregorian Chant«, in: Journal of the
American Musicological Society 33 (1980), S. 437–467 sowie Leo Treitler: »Reading and Sin-
ging. On the Genesis of Occidental Music-Writing«, in: Early Music History 4 (1984), S. 135–
208 und Theodore Karp: Aspects of Orality and Formularity in Gregorian Chant, Evanston
Tobias Robert Klein - 9783846759455
Downloaded from Brill.com10/22/2021 12:14:59AM
via free access44 Alte Musik
tenz einer gemeinsamen Neumen-Urquelle gerichtete These der Entstehung von
Schriftzeichen schon vor der späteren diviso imperii im Verlauf des 9. Jahrhun-
derts.47 Aus der oralen Überlieferung entwickelt sich demnach zunächst die
schreibökonomische paleo-frankische Notation, die nicht zwischen punctum und
virga differenziert. Erst nach 800 folgen mit zusätzlichen Strichen bei Podatus und
Torculus versehene »gesturale« Typen, die sich parallel zu den zunächst fortbeste-
henden älteren Notationsformen herausbilden. Der frühere Typus wäre somit eine
einfache, positionierte und damit zur schnellen graphischen Übertragung vokaler
Gesten geeignete Form, während die neuere Notation den lebendigeren melodi-
schen Fluss repräsentiert – was auch die von der semiologischen Choralexegese
stets betonte Gesturalität dieser Zeichen plausibler erscheinen lässt. Die Herausbil-
dung eines konjunkten, nuancenarmen und adiastematischen Neumentypus er-
scheint in dieser Perspektive als eine Entwicklung, bei der leicht zu memorierende
»concretised, reified entities« auf einen »gestural mindset« zurückgeführt werden.
»Charts that were vivid as memory aids and easily animated as hand-and-arm mo-
tions for guiding performance.« Die mmenotechnische Funktion führt schließlich
zur allmählichen Verfestigung gestisch bestimmter Formen:
I return here to the two fundamental neume-types – Type 1/graphic and Type 2/
gestural, which I have distinguished, not as styles or ductus but as processes or me-
thods. Now the promulgators of the Type 2 noted archetype supplied a model that
was gesturally conceived. My point is that the gestural method itself may have encou-
raged a bypassing of the model’s specific neume-shapes in favour of neumations that
were continuously fresh ›re-gesturings‹ of the well-remembered Gregorian melos.
Each step in the writing process, each notational act, each ligature, each neume set
down, would be the manifestation of a gestural impulse. […] The resulting neuma-
tions would reflect personal and local choices as to what was notationally accurate and
vivid.48
Doch wies andererseits Helmut Hucke schon in den 1970er Jahren sämtliche der
ein Jahrhundert zuvor von Pater Ambrosius Kienle angeführten Belege49 für eine
cheironomische Beteiligung der Hand an der Aufführung des cantus planus, die
(Northwestern University Press) 1998, dort besonders zur Bedeutung spezifischer Formeln
für die orale Überlieferung die Kapitel »Aspects of Early Gregorian Orality« (S. 1–58) und
»Formulaic Usage in Melodic Chant: A Chronological Approach to Second-Mode Tracts«,
S. 99–134.
47 Eine wichtige Rolle für die weitere Argumentation spielt hier die von Ewald Jammers und
besonders Jacques Handschin in seinem Aufsatz »Eine alte Neumenschrift«, in: Acta Musi-
cologia 22 (1950), S. 69–96 beschriebene punktartige paleofrankische St. Armand Traditi-
on.
48 Levy: Gregorian chant (Anm. 42) S. 138 f.
49 Ambrosius Kienle: »Notizen über das Dirigieren mittelalterlicher Gesangschöre«, in: Vier-
teljahrsschrift für Musikwissenschaft 1 (1885), S. 158–169. Weitere potentielle Belegstellen
bei Michel Huglo: »La chironomie médiévale«, in: Revue de Musicologie 49 (1963), S. 153–
171.
Tobias Robert Klein - 9783846759455
Downloaded from Brill.com10/22/2021 12:14:59AM
via free accessAusdruck vor dem »Ausdruck« 45
durch Gebärden »das was laut wird auf hundertfältige Weise stützt«50, als aus dem
Zusammenhang gerissene Missverständnisse zurück.51 Bereits in der frühchristli-
chen Literatur sieht Hucke keinerlei ausreichenden Belege mehr für die von Moc-
quereaus metrischer Choraldeutung und Fleischers Neumen-Studien,52 aber auch
späteren Forschern wie Stäblein, Jammers oder Wellesz übernommene These der
Entwicklung der Neumenschrift aus cheironomischen Handzeichen. Vollends die
für das Hochmittelalter von Kienle angeführten (und nicht in engerem Sinne mu-
siktheoretischen) Quellen erscheinen ihm unzureichend: Es handelt sich bei ihnen
zum einen um den Casus Sancti Galli Ekkehards IV, in dem Bischöfe während des
Osterfests nach Handzeichen singen (»ad modulos sequentiae pingendosrite
levasset«53). Außerdem führt Kienle die von Hucke kaum kommentierte Ordo des
Beroldo aus dem Mailand des 12. Jahrhunderts (»Mediante manu et voce sencen-
sionem antiphonae, et ancensioionem«) und schließlich die Gemma animae de di-
vinis officiis des Honorius Augustodinensis an. In letzterer erscheint ein »Praecentor
qui cantantes manu et voce incitant« – übrigens mit einem von keinem der bishe-
rigen Kommentatoren beachteten Bezug zum Knechtslohngleichnis des Lukas-
Evangeliums (Kap. 17, 7–10) – der gleich einem »servus qui boves stimulo mimans
dulci voce bobus jubilat« agiert.54 Die Unsicherheit besteht vor allem darin, ob das
Verb »incitare« auf mehr als ein die im Vergleich zum »praecentor« unwissenden
Sänger antreibendes Einsatzzeichen verweist.
Berücksichtigt werden muss allerdings zunächst, dass Huckes Darstellung sich
primär gegen das in der sich von musikwissenschaftlicher Forschung distanzieren-
den Choralpraxis noch immer verbreitete Konstrukt einer aus der Antike schadlos
übernommenen »gregorianischen Cheironomie« richtet. Dies schließt zwar eine
unmittelbar gestisch-deiktische, keineswegs aber einen z. B. bei Symbolen wie dem
Quilisma durchaus naheliegenden motorisch-gestischen Ursprung (im Sinne der
Umsetzung psychischer Entladung in Schrift) aus. Ferner ist aus einer übergreifen-
den kulturgeschichtlichen Perspektive zu bedenken, dass die körperbestimmte Zei-
chengebung in der Tat als ein zentrales Instrument der Kommunikation theologi-
50 Walter Benjamin: »Der Erzähler«, in: ders.: Gesammelte Schriften, hg. von Hermann Schwep-
penhäuser und Rolf Tiedemann, Bd. 2/2, Frankfurt am M. (Suhrkamp) 1977, S. 438–465,
hier S. 464.
51 Helmut Hucke: »Die Cheironomie und die Entstehung der Neumenschrift«, in: Die Mu-
sikforschung 32 (1979), S. 1–16.
52 André Mocquereau: Paléographie musicale, Solesmes (Impr. Saint-Pierre) 1889; Oskar Flei-
scher: Neumen-Studien (Anm. 35) 1895.
53 »Modulus« stände in Huckes Lesart für die Melodie, während das Verb »pingere« eher un-
gebräuchlich erscheint. Es könnte figurativ im Sinne von »fingere« verstanden werden, aber
wäre auch dann nicht auf Handzeichen, Winke und dgl. (»neumas«) bezogen, sondern auf
»modulus«.
54 Honorius Augustodinensis: Gemma Animnae Sive De divinis officiis et antiquo ritu missarum
Gemma Animae: Patrologia Latina in: Patrologia Latina, hg. v. Jacques-Paul Migne, Bd. 172,
Paris (Migne) 1844 ff, Sp. 571–738, hier Sp. 549 C.
Tobias Robert Klein - 9783846759455
Downloaded from Brill.com10/22/2021 12:14:59AM
via free access46 Alte Musik
scher, sozialer und politischer Verhältnisse im europäischen Mittelalter fungierte,55
das Jacques Le Goff selbst als »Kultur der Geste«56 beschrieb: Haltung und Bewe-
gung von Kopf oder Händen verkörpern im Zusammenhang des Gottesdiensts, in
Herrschaftsgesten wie dem Eidschwur, in Klosterregeln und bisweilen auch weltli-
chen Tänzen die Ordnung von Körper und Seele und dienen der Kommunikation
ebenso mit Gott wie mit der sozialen Umwelt. Die Gebärde mag dabei gelegentlich
sogar als Beweis der Gottesergebenheit gelten – erinnert sei hier an die Einteilung
der Eucharistie in verba bzw. facta oder opera, zu denen gestus, motus und actus
gehören. Die Bewegung des Körpers nach außen (foris) wird dabei als Ausdruck
der inneren Bewegung der Seele (intus) betrachtet, also als Resultat und Zeichen
innerer Vorgänge, und kann ihrerseits durch stetige Disziplinierung jenes Äußeren
positiv beeinflusst werden.
Die Diskussionen der Körperbewegung kreisen über mehrere Jahrhunderte um
die Frage ihrer Ausgrenzung, Unterwerfung oder Integration: Der ethische Begriff
des »gestus« fungiert dabei sowohl als Synonym wie auch als Teilbereich des kon-
zeptuell weiter reichenden Terminus »motus«: Damit partizipiert die Gestik einer-
seits an der gerade für die spekulativ-mathematische Musiktheorie relevanten Ordo
der Planetenbewegung und befindet sich zugleich in einem ambivalenten Verhält-
nis zur Mobilität im Sinne ihrer Vergänglichkeit. Durch das Fortwirken der anti-
ken Rhetorik steht der Terminus »gestus« schließlich auch in permanenter Span-
nung zu den ausschweifenden Zuckungen der »gesticulatio« und den sich ebenso
unwillkürlich-impulsiv wie magisch-wunderhaft der menschlichen Vernunft ent-
ziehenden »gesta«. Eine weitere Ausdifferenzierung wird im Zuge der sich im
13. Jahrhundert ausbildenden Hof- und Laienkultur erreicht, die – ohne dass trotz
der Konkurrenz zur Schrift von einer linearen Auflösung der gestischen Diszipli-
nierung des Körpers die Rede sein kann – im Kontext des Aufschwungs religiöser
Mystik zugleich mit einem partiellen Auftrieb für rasche Körperbewegungen ein-
her geht.
Substantiell ist von solchen Wandlungen zunächst der »chanson de geste« be-
troffen, eine Gattungsbezeichnung, in der sich die im Altfranzösischen vom in
dividuellen Gestus absehende genealogisch-historische Bedeutung der »geste« mit
körperlicher Routine kreuzt. Ob diese Zweideutigkeit noch für Johannes de Gro-
cheos den »antiquis et civibus laborantibus et mediocribus minstrari« darzubieten-
den »cantus gestualis« in Anspruch zu nehmen ist, wie u. a. Schmitt behauptet,57
erscheint angesichts der funktionalen Erklärung der Gesänge als Erholung von
55 Vgl. Jean-Claude Schmitt: La raison des gestes dans l’Occident médiéval, übers. v. Rolf Schu-
bert und Bodo Schulze als Die Logik der Gesten im europäischen Mittelalter, Stuttgart (Klett-
Cotta) 1992 sowie Edgar Bierende/Sven Bretfeld/Klaus Oschema (Hg.): Riten, Gesten, Ze-
remonien. Gesellschaftliche Symbolik in Mittelalter und Früher Neuzeit (= Trends in Medieval
Philology, Band 14) Berlin (de Gruyter) 2008.
56 Jacques Le Goff: La Civilisation de l’Occident médiéval, Paris (Arthaud) 1964, S. 440.
57 Schmitt: Logik der Gesten (Anm. 55), S. 269.
Tobias Robert Klein - 9783846759455
Downloaded from Brill.com10/22/2021 12:14:59AM
via free accessAusdruck vor dem »Ausdruck« 47
gewohnter Arbeit (»dum requiescunt ab opere consueto«58) allerdings nicht hin
reichend belegt. Gerald J. Brault spricht in seiner analytischen Edition des Rolands-
lieds von einem impliziten »gestural script« (im Sinne eines Regiebuches), das der
immer auch von Musik begleiteten Darbietung solcher Epen unterliegt: »With or
without his viol, the jongleur surely mimicked certain scenes in Turoldu’s poem,
grimacing and raising his voice in imitation of Ganelon’s anger at Roland’s sarcastic
rejoinder, facing or even stepping from side to side to impersonate speakers in a
dialogue.«59
Derartige körperliche und vokale Gebärden lassen sich jedoch nicht nur für den
»chanson de geste« und ähnliche episch-dramatische Genres,60 sondern auch für
den Vortrag des einstimmigen höfischen Liedes der okzitanischen Troubadour be-
legen. So thematisiert z. B. ein Trauergesang (planh) des Aimeric de Belenoi explizit
seine während der Darbietung von Schmerz verzerrte Stimme.61 Gemeinsam mit
anderen trans- und paratextuellen Elementen, die erst mit der multiauktorialen
Zuschreibung und Zusammenstellung der Gesänge zu Codices und Chansonni-
ers62 in den Hintergrund treten, dürfen sie als nicht in der Überlieferung, wohl
aber ihrer performativen Präsenz mit Musik und Sprache gleichrangige Charakte-
ristika gelten:
Many nonmusical, nonverbal components of performance that are now irrecoverable
were as much part of the song as the melody and text, and were probably embedded
in its early reception: the performers’ appearance and gestures, their relationship to
the audience, their present or absent patrons.63
Gerade in Fällen, in denen musikalische und körperliche Vorgänge konzeptuell
und kognitiv zusammenfallen, schlägt sich die verbale Erwähnung gestischer Akti-
58 Ernst Rohloff: Der Musiktraktat des Johannes De Grocheo, Leipzig (Reinecke) 1943, S. 50.
Vgl. auch Doris Stockmann: »Musica vulgaris bei Johannes de Grocheio«, in: Beiträge zur
Musikwissenschaft 25 (1983), S. 3–56, dort S. 35–38.
59 Gerald J. Brault: The Song of Roland. An Analytical Edition, Bd. 1, University Park/London
(Pennsylvania State University Press) 1978, S. 113.
60 So verweist Suzanne Fleischman: »The Non-Lyric Texts«, in: F. R. P. Akehurst/Judith M.
Davis (Hg.): A Handbook of the Troubadours, Berkeley (University of California Press) 1995,
S. 174 auf die in »chanson de geste« und Heiligenlegende gleichermaßen verbreiteten »asi-
des, reptitions, extensive use of direct speech (dialogue), expressive sounds and sound ef-
fects« sowie »[the] use of motion and gestures, and tense switching.«
61 Vgl. Poésies du troubadour Aimeric de Belenoi, hg. von Maria Dumitrescu, Paris (Societé des
Anciens Textes Français) 1935, S. 114f. : »Chantar m’ave tot per aital natura/Cum lo signes,
que chanta ab dolor/Quan mor: et ieu chan planhen mon senhor.« Zur Diskussion der
Stelle für die Aufführungspraxis vgl. Ian Parker: »The performance of troubadour and trou-
vere songs. Some Facts and Conjectures«, in: Early Music 5 (1977) 2, S. 184–208, hier
S. 193.
62 Vgl. Marisa Galvez: Songbook. How Lyrics Became Poetry in Medieval Europe, Chicago (Uni-
versity of Chicago Press) 2012.
63 Susan Boynton: »Troubadour Song as Performance: A Context for Guiraut Riquier’s ›Pus
sabers no’m val ni sens‹«, in: Current Musicology 94 (2012), S. 7–36, hier S. 7.
Tobias Robert Klein - 9783846759455
Downloaded from Brill.com10/22/2021 12:14:59AM
via free access48 Alte Musik
Abb. 6: Jaufre Rudel: vau de talant embroncs e clins
(Ich gehe vom Verlangen getroffen und gebeugt)
onen trotz der berechtigten Warnung vor einer semantischen Textdeutung im Sin-
ne des romantischen Kunstlieds64 durchaus auch in in der musikalischen Gestal-
tung der Gesänge nieder. Verwiesen mag – im Bewusstsein, dass es sich bei den
scheinbar objektiv notierten Linien, Bögen, Steigungen und Stufenbewegungen
um nicht mehr und nicht weniger als eine kognitiv-metaphorische Konzeptualisie-
rung ton-räumlicher Relationen handelt65 – auf die ähnliche Stellung des am Ver-
sende stehenden Wortes »clinar« (senken, beugen, niederdrücken usw.66) in Jaufré
Rudels »Lanquan li jorn son lonc en mai«, »Qui la vi en ditz« von Aimeric de Pe-
guilhan sowie einem anonym überlieferten Lai non par (»Finaments e jausents«).67
64 Hendrik van der Werf: »Music«, in: F. R. P. Akehurst (Hg.): A Handbook of the Troubadours,
Berkeley 1995, S. 143–145 und Matthias Bielitz: Musik als Unterhaltung, Bd. 4,2, Neckar-
gemünd (Männeles) 1998, S. 37–39.
65 Vgl. Marion Guck, »Analytical Fictions«, in: Music Theory Spectrum 16 (1994) 2, S. 217–
230 sowie Arnie Cox: »Hearing, Feeling, Grasping Gestures«, in: Anthony Gritten/Elaine
King (Hg.): Music and Gesture, Aldershot (Ashgate) 2006, S. 54 f. und Lawrence M. Zbi-
kowski: »Musical Gesture and Musical Grammar. A Cognitive Approach«, in: Anthony
Gritten/Elaine King (Hg.): New Perpectives on Music and Gesture, Farnham (Ashgate) 2006,
S. 83 f.
66 So schon nach François-Just-Marie: Lexique roman ou dictionnaire de la langue des trouba-
dours, Paris (Silvester) 1838, S. 14: clinar – lat. Clinare = courber, baisser. Vgl. auch die
entsprechenden Nachweise bei Emil Levy: Provenzialisches Supplement Wörterbuch, Bd. 2,
Leipzig (Reisland) 1898, S. 439 und Joan de Cantalausa: Diccionari General Occitan, Lo
monastèri de Rodés (Cultura d‘óc) 2003, S. 257.
67 Die Notenbeispiele sind hier nach der Edition in Ismael Fernandéz de la Cuesta/Robert
Lafont (Hg.): Las cançons dels trobadors, Tolosa (Inst. d’Estudis Occitans) 1979, S. 53 f.,
404–411 und 751–763 wiedergegeben.
Tobias Robert Klein - 9783846759455
Downloaded from Brill.com10/22/2021 12:14:59AM
via free accessAusdruck vor dem »Ausdruck« 49
Abb. 7: Aimeric de Peguilhan: car m’auci cli(n) (der ich mich vor ihr verneige)
Abb. 8: Anonymus: marits testa enclina (der Gemahl mit gesenkten Kopf )
Die primär mündliche Konzeption und Präsentation der Musik68 ist gerade an-
hand eines solchen, die Filter der verschiedenen Rezeptions- und Tradierungsstufen
einmal recht unbeschadet passierenden Gestaltungsmerkmals schwerlich von der
Hand zu weisen. Auch die berühmte Schilderung von Guillem de Peteus’ Erzäh-
lung seiner Erlebnisse in sarazenischer Gefangenschaft, bei der er »coram regibus et
68 Vgl. zentral hier noch immer die Überlegungen von Jörn Gruber: »Singen und Schreiben,
Hören und Lesen als Parameter der (Re-)Produktion und Rezeption des Occitanischen
Minnesangs des 12. Jahrhunderts«, in: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik
57/58 (1985), S. 35–51 zur auf Singen und Hören gerichteten (Re)-Produktion und Re-
zeption des »art de trobar«, denen gegenüber erst nach ihrem Verfall die von der literatur-
wissenschaftlichen Rezeption bis heute betonte Funktion von Notation und Lesen an Be-
deutung gewinnt. Der vom Verfasser auf dem Wiener Symposium »Many Kinds of Music:
A Cross-Cultural Enquiry« des Balzan Research Programms »Towards a global history of
music« (Oktober 2014) skizzierte Vergleich institutionalisierter westafrikanischer Preissän-
ger (Griots und Jali) mit der Stellung der Troubadour und/oder Joglar bietet eine heuris-
tisch fruchtbare Möglichkeit, gerade im Modus der »Performance« die Grenzen und Poten-
ziale einer historiographisch-interkulturellen Perspektivierung zu bestimmen: Beziehungen
bestehen hierbei sowohl in der Herstellung auktorialer Autorität (Razos und Vidas als an
fableau und Heiligenlegende orientierte Einleitungen, Diyamo als verbale Ankündigung ei-
nes Liedes, seiner Ausführenden und des narrativen Kontexts) als auch der Einschaltung
von Liedern an neuralgischen Punkten des intermedialen Vortrags epischer Texte. Eine fort-
laufend aktualisierte Assoziation zwischen Musik und Text ergibt sich ferner durch inter-
strophische Bezüge und Erwartungen zum Ablauf der Melodieteile bzw. beim Preisgesang
im Zuge eines durch Sprichworte, Preisnamen, Lieder und instrumentale Begleitpattern
etablierten intertextuellen Aktionsrahmens. Hier wie dort steht dabei die Erweiterung, Ver-
änderung und Verzierung melodischer Grundmotive im Mittelpunkt der »Performance«.
Tobias Robert Klein - 9783846759455
Downloaded from Brill.com10/22/2021 12:14:59AM
via free access50 Alte Musik
magnatis atque Christianis coetibus« durch »rhythmicis versibus cum facetis
modulationibus«69 brillierte, suggeriert eine der Formgestaltung zugrundeliegende
Erweiterung und Verzierung verbaler wie melodischer Motive.70 Assoziationen
zwischen Musik und Text entstehen dabei sowohl durch vorgeprägte Erwartungen
zur (strophischen) Abfolge der musikalischen Formteile71 als auch durch schritt-
weise Bedeutung an zusätzlicher Bedeutung gewinnende melodische Motive
(»marqueur sonore«72) in der Strophenmitte.
Einen deutlichen Kontrast zu den »gesticulationes« der höfischen Epik, die mit
dem liturgischen Gesang freilich ein transigentes Verhältnis von Musik und Spra-
che teilt, bildet die für das Verhältnis von Affekt und Innerlichkeit bedeutende
Beziehung von »cor und vox«, die Wolfgang Fuhrmanns Studie Herz und Stimme
der in der musikalischen Mediävistik lange Zeit dominierenden mathematisch-
theoretischen Defi nition der Musik entgegenstellt.73 Den historiographischen
Flucht- und Referenzpunkt dieser in zahlreichen Quellen nachweisbaren Polarität
bildet für ihn dabei vor allem die Empfindsamkeitsästhetik des 18. Jahrhunderts.
Auch eine Konfrontation mit dem noch später liegenden Diskurs der »Expression
of Emotions« etabliert allerdings eine heuristisch weiterführende Perspektive auf
die aus früh- und hochmittelalterlichen Quellen zur Musikausübung sprechende
Gebetsemotionalität, die sowohl als »lectio« wie auch als sensuelle »remoratio«
nach der Wiederherstellung des Lebens Jesu strebt. Dies rückt den liturgischen
Gesang zum einen in die Nähe der vielfältig überlieferten Gebetsposen,74 erklärt
vor allem aber zum Zwecke der Bewegung der Seele oder spirituellen Erweichung
des Herzens gebrauchte Termini, die als körperliche (»carnalis«) »Ausdrucksbewe-
gungen« fungieren, deren emotionale Authentizität über das mit offenen Misstrau-
en betrachtete mimisch-nachahmende Verhalten zugleich hinausweist. Wie eine
von Fuhrmann kaum direkt zitierte, im Literaturverzeichnis jedoch aufgeführte
Studie von Anders Ekenberg zeigen konnte, sehen schon karolingische Autoren wie
Hrabanus Maurus oder Smaragdus in seiner Diadema Monachorum eine zentrale
69 Jean Boutière/Alexander Herman Schutz/Irénée-Marcel Cluzel: Biographies des troubadours.
Textes provencaux des XIIIe et XIVe siècles, Paris (Nizet) 31973, S. 585.
70 Vgl. z. B. Parker: »Performance« (Anm. 61), S. 201–205; Elizabeth Aubrey: »Occitan Mo-
nophony«, in: Ross W. Duffin (Hg.): A Performer’s Guide to Medieval Music, Bloomington
(University of Indiana Press) 2000, S. 122–133, hier S. 124–126.
71 Boynton: »Troubadour Song as Performance« (Anm. 63) zu Guiraut Riquier sowie allge-
mein Elizabeth Aubrey: The Music of the Troubadours, Bloomington (Indiana University
Press) 1996, S. 237–273.
72 Christelle Chaillou: »Le ›marqueur sonore‹: un exemple de conjugaison subtile des mots et
des sons dans l’art de trobar«, in: Tenso 25 (2010), S. 36–62.
73 Wolfgang Fuhrmann: Herz und Stimme, Kassel (Bärenreiter) 2004.
74 Vgl. umfassend Rudolf Süntrup: Die Bedeutung der Liturgischen Gebärden und Bewegungen
in Lateinischen und Deutschen Auslegungen des 9. bis 13. Jahrhunderts (= Münstersche Mit-
telalter-Schriften, Band 37), München (Fink) 1978.
Tobias Robert Klein - 9783846759455
Downloaded from Brill.com10/22/2021 12:14:59AM
via free accessAusdruck vor dem »Ausdruck« 51
Aufgabe des Gesangs in der Erzielung religiöser Erschütterung.75 Einerseits wird
diese über einen den Bereich des verbal Darstellbaren76 transzendierenden Freu-
denschrei (»Jubilus«) im Gotteslob erzielt. Schon bei Gregor dem Großen ist vom
Lachen des Herzens (»risus cordi«) die Rede, welches körperliche Bewegung und
Affektation in sprachlich transzendenten Lobgesang überführt.
Jubilum vero dicimus, cum tantam laetitiam corde concipimus, quantam sermonis
efficacia non explemus; et tamen mentis exsultatio hoc quod sermone non explicat
voce sonat. Bene autem os risu impleri dicitur, labia jubilo, quia in illa aeterna patria,
cum justorum mens in exsultationem rapitur, lingua in cantum laudis elevatur. Qui
quoniam tantum vident, quantum dicere non valent, in risu jubilant, quia non exp-
lendo resonant quod amant.77
Eine solche Bewegung der ekstatischen emotionalen Erregung vom Körper über
das Liebe und Affektation empfindende Herz hin zur stimmlichen »Ausdrucksbe-
wegung« ist noch mehrere Jahrhunderte später bei dem Augustinermönch Hugo
von St. Viktor (ca. 1097–1141) zu verfolgen. Trotz der sehr umfänglichen Beschrei-
bung und Klassifikationen körperlicher Gesten in seiner Institutio Novitorum wer-
den diese mit dem in einem weiteren Traktat behandelten Gebet (De Modo Orandi)
bezeichnenderweise nicht in direkte Verbindung gestellt. Vielmehr geht dieses bei
Hugo im Anschluss an die seit der Zeit der Kirchenväter verbreitete tropologisch-
bildhafte Interpretation von Psalmtexten mit der Vision des herannahenden Gottes
in den emphatisch die Wortsprache übersteigenden Iubilus über:
Affectus enim hoc proprium habet, quo quanto major et ferventior intus est, tanto
minus foris per vocem explicari potest. Illud vero genus supplicationis, quod per sola
verba exprimitur, minorem quidem isto devotionem indicat, majorem autem illo,
quod nominibus simul et verbis, plena videlicet significatione pronuntiatur. Illud igi-
tur, quod solis nominibus fit, ad puram orationem pertinere videtur, quod solis verbis
ad exactionem; quod nominibus simul et verbis ad captationem. Ita ut pura oratio
magis in jubilum convertatur, et appropinquet Deo, perveniat citius, et efficacius
obtineat.78
Andererseits obliegt dem wissend dargebotenen (»sapienter psallente«) liturgischen
Gesang auch die Erzeugung einer »affectum pietas« – der bereits ausnehmend bei
Isidor von Sevilla thematisierten »Zerknirschung des Herzens« (»compunctio cor-
75 Anders Ekenberg: Cur Cantatur. Die Funktionen des liturgischen Gesangs nach den Autoren
der Karolinger-Zeit (Almquist & Wiksell) Stockholm 1987 (= Bibliotheca Theologicae
Practicae, Band 41), S. 122–141.
76 Zum Verhältnis verbaler und non-verbaler Elemente im Spannunsgfeld von »sensibilis« und
»rationabilis« allgemein Emmanuela Kohlhaas: Musik und Sprache im Gregorianischen Ge-
sang (= Beihefte zum Archiv für Musikwissenschaft, Band 49), Stuttgart (Steiner) 2001,
besonders S. 114–122 und S. 139–142.
77 Gregorius Magnus: Moralia in Iob, in: Patrologia Latina, hg. v. Jacques-Paul Migne, Bd. 75,
Paris (Migne) 1844 ff, Sp. 519–1162, hier Sp. 856 A-B.
78 Hugo St. Viktor: De Modo Orandi, in: Patrologia Latina, hg. v. Jacques-Paul Migne,
Bd. 176, Paris (Migne) 1844 ff, Sp. 977–987, hier Sp. 980 C-D.
Tobias Robert Klein - 9783846759455
Downloaded from Brill.com10/22/2021 12:14:59AM
via free access52 Alte Musik
dis«). Wenn der Fuldaer Abt Hrabanus Maurus in seiner Institutione Clericorum die
Aufgabe des liturgischen Gesangs in der solcherart zu erreichenden Überführung
der Seele in einen entsprechenden Zustand sieht (»cujus psalterium idcirco cum
melodia cantilenarum suavium ab Ecclesia frequentatur, quo facilius animi ad
compunctionem flectantur«79), ist für den Kontext dieser auch in späteren Ausein-
andersetzungen herangezogenen Äußerung die seit der Zeit der Kirchenväter the-
matisierte Verbindung der »compunctio« mit Tränen, Weinen und der Klage80 von
Bedeutung:
Compunctio cordis est humilitas mentis cum lacrymis et recordatione peccatorum, et
timore judicii. Ex genuino fonte compunctionis solent profluere lacrymae, id est,
dum mens operum suorum diligentius mala considerat, aut dum desiderio aeternae
vitae suspirat.81
Die von den verschiedenen karolingischen Autoren herausgestellten »Ausdrucks
bewegungen«, nämlich sowohl »Lachen« als auch »Weinen«, sind aber nun auch
jene körperlichen Zustände, die nach Hellmuth Plessner – und nur ein sich selbst
genügendes philologisches Gewissen erregt sich über das Zitat anthropologischer
Ausdruckstheorie inmitten früh-mittelalterlicher Traktate – nicht nur das Tier vom
Menschen scheiden, sondern diesen gerade auch in und mit der Erfahrung des
»Verlust[s] der Herrschaft« über den Körper zur akustischen Kommunikation und
Selbstfindung befähigen.
Im Unterschied zu Erröten oder Erbleichen, die ihnen verwandter sind als den Gebär-
den, drücken sie eine Antwort aus, was in ihrem Lautwerden manifest wird. Zeugt
dies auf der einen Seite für den eruptiven Einsatz, die einschneidende Tiefe der Des-
organisation und für die Ungehemmtheit des körperlichen Geschehens, so auf der
anderen Seite für die nicht zu übersehende soziale Komponente, die mit der Funktion
des Signals zwar nicht ganz falsch, aber doch sicher zu eng gefaßt ist. Man darf nicht
vergessen, daß dem Laut die Kraft der Selbstbestätigung innewohnt: man hört sich
selbst.82
79 Hrabanus Maurus: De institutione clericorum, hg. v. Alois Knöpfler, (= Veröffentlichungen
aus dem kirchenhistorischen Seminar München, Band 5), München: Lentner 1900, S. 91.
80 Vgl. Johannes Quasten: Musik und Gesang in den Kulturen der heidnischen Antike und christ-
lichen Frühzeit, Münster (Aschendorff ) 21973, S. 149 f.
81 Hrabanus Maurus: Ecclasiastica Disciplina Libri Tres, in: Patrologia Latina, hg. v. Jacques-
Paul Migne, Bd. 112, Paris (Migne) 1844 ff, Sp. 1191–1262, hier Sp. 1257B. Weitere Be-
legstellen bei Ekenberg, Cur Cantatur (Anm. 75), S. 129–131, der ausführlich auf Hraba-
nus eingeht. In einem auf das Buch Sirach bezogenen Kommentar seines Commentariorum
In Ecclesiasticum Libri Decem, in: Patrologia Latina, hg. v. Jacques-Paul Migne, Bd. 109,
Paris (Migne) 1844 ff, Sp. 763–1126, hier Sp. 910D lehnt der Fuldaer Abt einen Gebrauch
der Musik zu anderen Zwecken unmissverständlich ab.
82 Helmuth Plessner: Lachen und Weinen. Eine Untersuchung der Grenzen menschlichen Verhal-
tens (1941), in ders.: Gesammelte Schriften, hg. v. Günter Dux, Frankfurt a. M. (Suhrkamp)
1980 ff, Bd. 7 (Ausdruck und menschliche Natur), S. 203–390, hier S. 276.
Tobias Robert Klein - 9783846759455
Downloaded from Brill.com10/22/2021 12:14:59AM
via free accessAusdruck vor dem »Ausdruck« 53
Dieses psycho-soziale Motiv führt unmittelbar zur Erklärung des liturgischen Ge-
sangs (und dort besonders des Allelujas) als »quammodo angelis sociatur« (bei Sma-
ragdus), die als anagogische Spiegelung und rituelle Präsenz der himmlischen Ord-
nung83 bei Aurelianus Reomensis (»in hoc angelorum choros imitatur«84) ebenso
wie noch bei Bernhard von Clairvaux die Integration der »musica caelestis«85 in das
boethianische Musikmodell motiviert: »Nam quod psallentibus quoque dignanter
admisceri sancti angeli soleant«.86 Amalar von Metz beschreibt die Wirkung der in
verschiedenen Responsorien vergenommenen melismatischen Interpolationen –
das sogenannte »neuma triplex«87 – als aus einer musikalischen Akzentuierung des
verbal Unsagbaren resultierende Sistierung der syllabisch und wortbetont gepräg-
ten Zeiterfahrung und eine entsprechende mit dem gemeinschaftlichen Choralge-
sang einhergehende sensuelle Elevation wird noch in Abt Sugers berühmten Be-
richt von der Weihe der Kathedrale zu Saint Denis im Jahre 1144 bekräftigt.
Wiederholt werden durch den Gesang hervorgerufene und hier gewiss nicht nur
metaphorisch zu verstehende Freudensekstasen beschrieben. Beim Einblick in die
auf König Dagobert zurückgehenden Reliquienschreine werfen sich König und
Bischöfe nieder und mit »gaudio inestimabile psallebant et flebant« (erneut also
lachen, singen und weinen!) durchlaufen sie in der anschließenden Messfeier das
ephiphanische Gemeinschaftserlebnis des wie von den himmlischen Heerscharen
einstimmig intonierten Gotteslobs:
Qui omnes tam festiui tam sollempniter, tam diuersi tam concorditer tam propinqui
tam hilariter ipsam altarium consecrationem missarum sollempnem celebrationem
superius inferiusque peragebant, ut ex ipsa sui consonantia ex coherentia armonie
grata melodia potius angelicus quam humanus concentus estimaretur et ab omnibus
et ore acclamaretur.88
83 Ekenberg: Cur Cantatur (Anm. 75), S. 171–176.
84 Aurelianus Reomensis: Musica disciplina (= Corpus scriptorum de musica, Band 21), hg. v.
Lawrence Gushee, Dallas (American Institute of Musicology) 1975, S. 59.
85 Vgl. Reinhold Hammerstein: Die Musik der Engel, Bern (Francke) 21990, S. 125 f. und
Christian Kaden: Das Unerhörte und das Unhörbare. Was Musik ist, was Musik sein kann,
Kassel und Stuttgart (Bärenreiter/Metzler) 2004, S. 134.
86 Bernhard von Clairvaux: Sermones in Cantica canticorum, in: Patrologia Latina, hg. v. Jac-
ques-Paul Migne, Bd. 183, Paris (Migne) 1844 ff, Sp. 519–1162, hier Sp. 808 B.
87 Amalarii Episcopi opera liturgia omnia, hg. v. Jean Michael Hanssens, Vatikanstadt (Bibliote-
ca Apostolica Vaticana) 1948 ff, Bd. 3, S. 54. Vgl. zur weiteren Überlieferung und Wir-
kungsgeschichte des »neuma triplex« besonders Thomas Forest Kelly: »Neuma Triplex«, in:
Acta Musicologica 60 (1988), S. 1–30.
88 Abt Suger von Saint-Denis: »De Consecratione», in: ders.: Ausgewählte Schriften, hg. von
Andreas Speer und Günther Binding, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft)
2000, S. 242 und 248, dort auch die folgende Übersetzung der Passage: »Sie alle vollzogen
die Weihe der Altäre selbst sowie die feierliche Zelebration der Messen – oben wie unten –
in so festlicher Freude, so feierlich, in ihrer Verschiedenheit so einmütig, in ihrer Verbun-
denheit so heiter, daß aufgrund des Zusammenklangs und des Zusammenhalts ihrer Har-
monie der wohllautende Gesang eher eine Musik für Engel als der Menschen hätte gehalten
werden können und alle mit Herz und Mund ausriefen.« Vgl. zur theologisch-ideenge-
Tobias Robert Klein - 9783846759455
Downloaded from Brill.com10/22/2021 12:14:59AM
via free access54 Alte Musik
Wie aber verhalten sich zu diesen theologischen Motiven nun die bereits im Kon
text mit Sachs angeführten neurokognitiven Überlegungen zu »co-speech gestures«
und dem musikalischen Bewegungsverhalten? Auch wenn letzteres in der umfang-
reichen Literatur zur Aufführungspraxis des cantus planus nur eine geringe Rolle
spielt, scheint seine gleichsam statuarische Darbietung nur schwerlich vorstellbar.
Immerhin enthält die um die Mitte des 9. Jahrhunderts entstandene Musica Disci-
plina des Aurelianus Reomensis zumindest einen bislang als »cheironomisches Zei-
chen« wohl missinterpretierten Hinweis auf die Verbindung einer Neumenfigur
mit motorischen Impulsen. Die kognitive Linguistik erkannte in den 1990er Jah-
ren, dass die den Sprechvorgang ohne eine unmittelbar ikonische, metaphorische
oder deiktische Funktion gliedernden »gestural beats« (»small up and down or back
and forth flicks of one or both hands«) nur mittelbar mit verbalen Betonun-
gen verbunden sind, hingegen aber einer eigenen isochronen Segmentierung unter-
liegen. Als gedanklich auf diese Weise vorakzentuierte und vorweggenommene
Einsatzpunkte solcher regelmäßigen Pattern von Handbewegungen kommen be-
sonders sogenannte »nuclei«, d. h. die durch die Tonierung hervorgehobenen Kern-
elemente verbaler Phrasen in Frage.89 Für Aurelianus’ text- und sprachgebundene
Beschreibung der Betonung einer dreiteiligen Hakenneume (tristropha) auf dem
Reperkussionston des Gloria als Folge von Handschlägen erscheint eine solche
Funktion des als körperliches »re-enactment« der Trinitas beschriebenen Vorgangs
immerhin vorstellbar: »Sagax cantor, sagaciter intende, ut si laus nomino trino in-
tegra canitur, duobus in locis scilicet in xvu syllaba, et post, in quarta decima, trina
ad instar manus verberantis facias celerum ictum«.90
Dringend zu differenzieren sind andererseits die bis heute gern zitierten Überle-
gungen Joseph Smith van Waesberghes zur Funktion der Hand. In seinem Band
zur mittelalterlichen Lehre und Theorie der Musikerziehung für die Reihe der Mu-
sikgeschichte in Bildern stellt er die manuelle Bewegung zunächst in den Zusam-
menhang mit der Unterstreichung unserer »Gedanken und Gefühle« durch »Ge-
bärden unserer Hände«.91 Die aus den Ordenregeln der Benediktiner von Cluny
und Hirsau entnommene Gebärden- und Zeichensprache – sie dient primär der
Einhaltung des strikten Schweigegelübdes – wird von dem verdienten Mediävisten
schichtlichen Herleitung des »Una voce dicentes« auch Quasten: Musik und Gesang (Anm.
80), S. 95 f. und Süntrup: Liturgische Gebärden (Anm. 74), S. 455.
89 Evelyn McClave: »Gestural beats: The rhythm hypothesis«, in: Journal of Psycholinguistic
Research 23 (1994), S. 45–66.
90 Aurelianus Reomensis: Musica disciplina (Anm. 84), S. 123. Aurelian of Reóme: The Disci-
pline of Music, übers. von Joseph Ponte, Colorado Springs (Colorado Music Press) 1968,
S. 49 enthält die folgende Übersetzung: »Wisely observe, O wise singer, that if the praise to
the threefold name is sung in its entirety, in two places, that is, on the sixteenth syllable, you
make a threefold swift beat like the beating hand.« Vgl. auch Phillips: »Notationen und
Notationslehren« (Anm.41), S. 507.
91 Joseph Smith van Waesberghe: Musikerziehung: Lehre und Theorie der Musik im Mittelalter
(= Musikgeschichte in Bildern: Musik des Mittelalters und der Renaissance, Lieferung 3,
Band 3), Leipzig (VEB Deutscher Verlag für Musik) 1969, S. 23 f.
Tobias Robert Klein - 9783846759455
Downloaded from Brill.com10/22/2021 12:14:59AM
via free accessAusdruck vor dem »Ausdruck« 55
jedoch grob missverständlich gedeutet. Die irdische Vorwegnahme und Imitation
der sich auf das Gotteslob beschränkenden Engelscharen umfasst nicht etwa konti-
nuierliche Begleit- und Dirigierbewegungen, sondern ihr geht es um intuitiv mit
visuellen Assoziationen verbundene Verkörperungen von alltäglichen und liturgi-
schen Gegenständen, deren Beherrschung zugleich eine metasprachliche Identität
zwischen den im höchst unterschiedlichen Grade des Lateinischen mächtigen Fra-
tres stiftet.92 Der Hinweis auf das Armarium (also jenen Ort, wo auch Tonare und
Antiphonare zu finden sind) umschreibt die Geste eines den Choralgesangs zusam-
menhaltenden Einsatzzeichens der rechten Hand: »Pro signo Armarii, & Praecen-
toris, interiorem superficiem manus leva, & et move, sicut qui innuit in choro, ut
aequaliter ab omnibus cantetur«. Auch die Zeichen für das »Alleluja« (»Pro signo
alleluia leva manum et summitates digitorum inflexas quasi ad volandum move-
propter angelos, quia, ut creditur, ab angelis cantatur in celo.«93) müssen nicht, wie
van Waesberghe behauptet, während des Gesangs zur Ausführung gelangen:
Using hand signs, the precentor directed individual and communal participation in
the divine office and the liturgy of the mass […]. The novices learned to recognize for
common choir books, like antiphonaries, hymnals and psalters as well as those for
texts read during the mass, like missals, the Gospels and the Epistles.94
Für von Waesberghes Deutung des Zeichens als »Anweisung für die Gestik beim
Singen«95 gibt es daher keinen hinreichenden Beleg, eher liegt in seinem Charakter
als Analogie zum Engelsflug eine symbolische, emotional-anagogische, vielleicht
aber auch melodische Verkörperung vor. Das Alleluja entspricht wie oben darge-
stellt dem durch eine »rite des passage« gleichzukommenden Gotteslob der Engel.
Dies zeigt sich in ähnlicher Weise auch bei Zeichen für andere Teile der Liturgie,
wie etwa der gleichfalls eine formale Charakteristik aufnehmenden Geste für den
Tractus: »Pro signo Tractus, trahe manum per ventrem de deorsum, quod longum
semper significat, et contra os applica manum quod cantum.«96 Ebenso unklar ist
schließlich der bei von Waesberghe erwogene Bezug solcher Handzeichen zur »Ma-
nus Musicalis«. Deren von Karol Berger theoretisch wie kulturgeschichtlich kon-
textualisierte mmenotechnische Operationen97 stehen in keinem direkten Zusam-
92 Vgl. zuletzt und umfassend Scott G. Bruce: Silence and Sign Language in Medieval Monasti-
cism. The Cluniac Tradition c. 900–1200, Cambridge (Cambridge University Press) 2007.
93 »Für das Zeichen des Allelúia hebe die Hand und mit allen gebeugten Fingern bewege sie
gleichsam wie Flügel, ähnlich wie die Engel, weil man glaubt, daß die Engel im Himmel
dies singen.« Vgl. Walter Jarecki: Signa Loquendi der cluniacensistischen Signalisten, Baden-
Baden (Koerner) 1981, S. 132, 153, 198 und 262 und Bruce (Anm. 92): Silence and Sign
Language, S. 65
94 Bruce: Silence and Sign Language (Anm. 92), S. 87.
95 van Waesberghe: Musikerziehung (Anm. 91), S. 25.
96 »Für das Zeichen des Tractus ziehe die Hand am Bauch nach unten, welches immer die
Länge des Gesangs bedeutet und richte die Hand gegen den Mund.«
97 Karol Berger: »The Hand and the Art of Memory«, in: Musica Disciplina 35 (1981), S. 87–
120.
Tobias Robert Klein - 9783846759455
Downloaded from Brill.com10/22/2021 12:14:59AM
via free access56 Alte Musik
menhang zur klösterlichen Gebärdenkommunikation, wenngleich ihre didaktisch
eindrucksvollen Darstellungen durch die offensichtliche Disproportionalität eine
eigene expressive Suggestivkraft entfalten.98
Nun kennen wir anderseits jedoch aus der Zeit des Hochmittelalters sehr wohl
Klagen über eine unziemliche und im Sinne des Wortes überhand nehmende Ges-
tik beim Singen, die zu der immer wieder mit Augustinus begründeten Forderung
einer zur Gemeinschaft mit den Engeln führenden Affekterregung im eklatanten
Widerspruch stehen. Die Zisterzienser Bernhard von Clairvaux und Aelred von
Rievaulx beklagen (aus der Perspektive ihrer abgelegenen Reformorden) nicht nur
den mit dem Terminus »gesticulatio« belegten histrionischen Einsatz des Körpers
beim Hin- und Herdrehen und das (an frühere Überlegungen zum habitualisierten
Reflexverhalten anknüpfende) Krümmen der Finger zur Tonbewegung, sondern
auch den Missbrauch der Stimme. Gerade hierbei fällt bei Aelred sogar eine Ten-
denz zur expliziten »Entmusikalisierung«99 ins Auge, die jene inkriminierte Erwei-
terung der vokalen Register parallel zu geschlechtlichen Bildern als regredierenden
Rückfall in spasmodisches Schreien, Röcheln oder sogar dem Pferdegewieher ent-
sprechende Tierlaute charakterisiert:
Nunc vox stringitur, nunc frangitur, nunc impingitur, nunc diffusiori sonitu dilata-
tur. Aliquando, quod pudet dicere, in equinos hinnitus cogitur, aliquando virili vigo-
re deposito in feminae vocis gracilitates acuitur, nonnunquam artificuosa quadam
circumvolutione torquetur et retorquetur. Videas aliquando hominem aperto ore
quasi intercluso halitu exspirare, non cantare, ac ridiculosa quadam vocis interceptio-
ne quasi minitari silentium; nunc agones morientium, vel exstasim patientium imita-
ri. Interim histrionicis quibusdam gestibus totum corpus agitatur, torquentur labia,
rotant, ludunt humeri; et ad singulas quasque notas digitorum flexus respondet. Et
haec ridiculosa dissolutio vocatur religio; et ubi haec frequentius agitantur, ibi Deo
honorabilius serviri clamatur. Stans interea vulgus sonitum follium, crepitum cymba-
lorum, harmoniam fistularum tremens attonitusque miratur; sed lascivas cantantium
gesticulationes, meretricias vocum alternationes et infractiones non sine cachinno ri-
suque intuetur, ut eos non ad oratorium, sed ad theatrum, nec ad orandum, sed ad
spectandum aestimes convenisse.100
98 In den zahlreichen überlieferten Abbildungen erscheint die Hand als statisches, von einer
bewegten »Pathosformel« weit entferntes Memoriersystem (dem die Hexachordskalen im
zweifachen Sinne gleichsam eingeschrieben sind.) Körperlich-motionale Impulse entstehen
aus der durch den instruktiv-didaktischen Zweck freilich unmittelbar einsichtigen, über-
proportionalen Größe. Vgl. auch Aaron J. Gurjewitsch: Das Weltbild des mittelalterlichen
Menschen, München (Beck) 41989, S. 87–90.
99 Matthias Bielitz: Zur wertungsgeschichtlichen Bedeutung der liturgischen Epoche der Musik des
Mittelalters und zur Frage ihres Endes (= Musik als Unterhaltung. Beiträge zum Verständnis der
wertungsgeschichtlichen Veränderungen in der Musik im 12. und 13. Jhd., Band 2), Neckarge-
münd (Männeles) 1998, S. 205–207. Vgl. ferner Fuhrmann: Herz und Stimme (Anm. 73),
S. 232–236.
100 Aelred von Rielvaux: Speculum Charitatis, in: Patrologia Latina, hg. v. Jacques-Paul Migne,
Bd. 195, Paris (Migne) 1844 ff, Sp. 505–620, hier Sp. 571 B-D. Vgl. zur spezifischen Zis-
Tobias Robert Klein - 9783846759455
Downloaded from Brill.com10/22/2021 12:14:59AM
via free accessSie können auch lesen