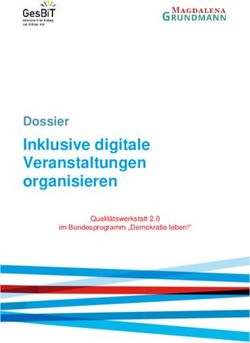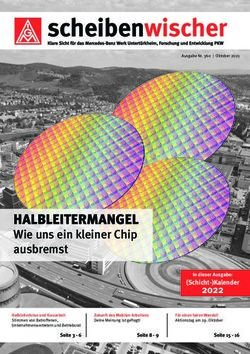"Baukunst am Rand des Unbetretbaren" (Rudolf Schwarz)
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Achim Hahn (Berlin) "Baukunst am Rand des Unbetretbaren" (Rudolf Schwarz) Gedanken zum Umgang mit dem Unverfügbaren Der Architekt will bauen. Das entspricht seinem Selbstverständnis. Er ist dem Bauen und seinen Möglichkeiten gegenüber grundsätzlich positiv und optimistisch eingestellt. Was aber bedeutet "negative" Architekturlehre? Diese Konzeption stellt eine Haltung zum Bauen fest, die sich dem Bauen verweigert, das Bauen bewusst negiert. Der Architekt kann nämlich mit Bau- aufgaben konfrontiert werden, die ihm unverfügbar sind. Das Unverfügbare wird dann zu einem eigenständigen Planungsinhalt und wirft einen eigen- willigen Blick auf das Ergreifen von Möglichkeiten des Bauens bzw. den Ver- zicht darauf. Der Aufsatz beschäftigt sich aus dieser Perspektive mit der Ar- chitekturlehre von Rudolf Schwarz (1897-1961), der in verschiedenen Einlas- sungen zur Baukunst eine kritische Position gegenüber einer aufgeklärten Moderne formuliert hat.1 http://www.archimaera.de ISSN: 1865-7001 urn:nbn:de:0009-21-52102 März 2021 #9 "Rückseiten" S. 11-26
1. Rudolf Schwarz und die Wahr- gumentierende Philosophen wie Wil-
nehmung der "Rückseite" der helm Kamlah7, Friedrich Kambar-
Moderne tel,8 Jürgen Mittelstraß9 sprachen und
sprechen in konstruktiver Absicht von
Ihrem eigenen Selbstverständnis nach "vernehmender Vernunft", führten den
kommt die Moderne an kein histo- "Widerfahrnischarakter des Lebens"
risches Ende, sondern begreift sich in in die Diskussion ein und stehen ei-
einer stetig-endlosen Zukunft.2 Was ner durchgängig rationalisierten Welt
das eigene Machen und Herstellen und ihrer "aufgeklärten", aber zum
angeht, kennt das moderne Selbst- Teil unkritisch gewordenen Wissen-
verständnis keine Orientierungs- bzw. schaft skeptisch gegenüber. Kamlah
Lösungsprobleme. Wenn nicht schon z.B. hat die Situation der Wissenschaft
heute, dann zweifelfrei in absehbarer dafür mitverantwortlich gemacht,
Zukunft wird es jeder auf positives Tat- dass der Glaube für die neuzeitliche
sachenwissen eingeschworenen Gesell- Moderne zwangsläufig wieder an Be-
schaft und ihrer Wissenschaft schon deutung gewonnen hat: "Aber erst die
gelingen, auch über das Unverfügbare moderne Wissenschaft führt eine Si-
schließlich zu verfügen. Das "Unver- tuation herauf, in der nun gerade das
fügbare" – das, was sich einem wis- Wissen skeptisch macht und mit der
senschaftlichen und technischen Zu- Geborgenheit der Religion Geborgen-
griff entzieht – ist nach dieser Logik heit überhaupt zerstört. Erst jetzt muß
nur auf Zeit unverfügbar. Die Welt gegen das Wissen der Glaube aufge-
aber, so haben Kritiker dieser naiven boten werden, wo das Leben-können
"Überzeugung" entgegnet, ist ja erst noch gerettet werden soll."10 Den "Be-
dadurch für die Wissenschaften be- griffen" Religion, Geborgenheit, Glau-
rechenbar geworden, dass diese das be, Leben u.a., wie sie lebenspraktisch
Unverfügbare, z.B. die leibliche Ge- von Bedeutung und in Gebrauch sind,
genwart des wissenschaftlichen Beo- müsste von den Wissenschaften expli-
bachters als Einflussgröße bei Expe- zit nachgeforscht werden, sollten nicht
rimenten, als bloßes Nebengeräusch die Lebenswelten der Menschen ver-
ihrer Messungen und Planungen un- passt werden. So werden auch aufge-
terschlugen. klärte Zeiten sich ihrer "Rückseiten",
die sich nicht als Tatsachen in Tabel-
Was unter dem Etikett "Moderne" (in len verbuchen lassen, bewusst, denn
Abgrenzung etwa zu einer "Postmo- sie kamen von diesem "Schatten" ihres
derne") eigentlich zu verstehen ist, da- Tuns und Handelns nicht mehr los,11
rüber ist bis vor nicht allzu langer Zeit und benannten die Verluste an ganz-
gefragt und gestritten worden.3 Die phi- heitlicher Betrachtung der mensch-
losophische Auseinandersetzung mit lichen Welt. Die Aufklärungsskepti-
der Neuzeit, die mit der Durchsetzung ker fragten zugespitzt: Ist dem wissen-
wissenschaftlicher Rationalität den schaftlich-technischen Verwalten und
Maßstab von Wissenswertem über- Betreiben der Welt wirklich alles ver-
haupt radikal verschob, setzte aller- fügbar?
dings bereits nach dem Ersten Welt-
krieg (u.a. Ernst Bloch, Walter Ben- Auch der Architekt Rudolf Schwarz,
jamin) und vermehrt während des dem es primär nicht um wissenschaft-
Zweiten Weltkriegs ein, als z.B. von liche Fragen ging, gehörte aus weltan-
einer Post- oder Nachmoderne noch schaulichen Gründen zu den Vernei-
gar nicht die Rede war. Sie ging oft nern dieser Frage. Er war Skeptiker
mit einer Kritik der Aufklärung ein- nicht aufgrund einer wissenschaft-
her. Bemerkenswerterweise wurde da- lichen Überzeugung. Seine Haltung er-
bei der Zusammenhang von "Mythos gibt sich aus seiner Lebensgeschichte
und Moderne"4 angesprochen und un- und den Orten, an denen er aufwuchs
tersucht. Prominente Schlagworte der und die er erlebte.12 Ein zentrales Le-
Diskussion, die nach dem Zweiten bensereignis betraf die in den 1920er
Weltkrieg sich fortsetzte, sind die von Jahren erfolgte Bekanntschaft und
der "Dialektik der Aufklärung"5 oder spätere Freundschaft mit dem katho-
der "Verschlingung von Mythos und lischen Priester und Religionsphilo-
Aufklärung"6 geworden. Andere nicht sophen Romano Guardini. Schwarz
von Marx und Hegel herkommende, nahm durchaus Gedanken des "mo-
sondern wissenschaftstheoretisch ar- dernen Bauens" (wie Reduktion auf das
12Rudolf Schwarz: St. Fronleich- Wesentliche) auf, lehnte jedoch jeden würfe sind. Es beginnt mit einer Leh-
nam, Aachen. 1929-30. "rationalistischen" oder "funktionalis- re vom Menschen, dem menschlichen
Foto. M. Chapey/ K.R. Kegler tischen" Baugedanken ab. In verschie- Leib, dem Auge des Menschen. Mies
2011/ 2021. denen Publikationen, die in der katho- van der Rohe, ein begeisterter Leser,
lischen Zeitschrift Die Schildgenossen schrieb aus Amerika: Das Buch, ob-
bis zu deren Verbot 1941 erschienen, wohl es sich dem Kirchenbau widme,
entwickelte er seine "Baukunst". Nach erhelle "die eigentlichen Fragen der
Krieg und Gefangenschaft nahm er Architektur überhaupt. […] Ich glau-
seine Publikationstätigkeit wieder auf. be, es sollte nicht nur von dem an Kir-
In seinen Veröffentlichungen hat er chenbau Interessierten gelesen wer-
das Recht, Architektur zu verweigern, den, sondern von jedem, dem die Ar-
gewissermaßen zu einem Prinzip sei- chitektur ein echtes Anliegen ist. Dies
ner Baulehre herausgestellt. ist mehr als nur ein wichtiges Buch
über Architektur, es ist tatsächlich
Schwarz soll in diesem Aufsatz als Bau- eines der wirklich bedeutenden Bü-
meister einer "negativen Architektur- cher […]".13 Damit reiht sich Schwarz'
lehre" vorgestellt werden. Für diesen Buch in die Veröffentlichungen von
bislang noch nicht unternommenen Adorno/Horkheimer und Kamlah
Versuch habe ich Schwarz' Werk ver- ein, die nach den Erfahrungen eines
gleichsweise selektiv gelesen. Dabei auf höchstem technischem Niveau ge-
möglicherweise auftretende Einseitig- führten Krieges grundsätzliche Fra-
keiten bitte ich mir nachzusehen. Es gen an das moderne Leben stellen
besteht nicht der Anspruch, dem Ge- und zugleich Weltanschauungen bis
samtschaffen von Schwarz auch nur auf ihren Grund, den Mythos, hinter-
ansatzweise gerecht geworden zu sein. fragen und beurteilen.
Schwarz' Buch Vom Bau der Kir- Schwarz nennt den Architektenberuf
che ist 1938 entstanden. Er hatte da- einen echten und wirklichen, weil er
mals schon Kirchenbauten und auch " für eine letzte, auf nichts mehr rück-
Privathäuser sowie eine Schule ge- führbare Haltung zur Welt" steht.
baut. Das Buch ist aber keine Bau- Auch andere Berufe stehen in dieser
oder Entwurfslehre. Es enthält "Plä- Reihe und haben "zwar noch immer
ne", die zugleich philosophische Ent- in ihrer Art ganze Welt, aber ihre Ord-
13nung klafft und die Welt wird 'einsei- Selbstverständnis und der "naiven"
tig'. Gerade das aber ist heute der Fall. Weltanschauung des Menschen folgen.
Das Erkennen nämlich, und zudem Das Bauen dürfe nicht bloß als ein Ma-
noch meistens das nach den Regeln chen, sondern müsse als das Erschaf-
der Wissenschaft, hat die andern Be- fen einer Welt verstanden werden. Es
rufe verdrängt. Es nimmt zuviel Platz ist eine schöpferische Tätigkeit, die
ein." (vBdK, S. 142) In solchen Einlas- sich am "Bau" des Menschen zu ori-
sungen zeigt sich Schwarz' kritische entieren habe. In einer Notiz aus dem
Haltung gegenüber einer aufgeklär- Jahr 1920 macht der Dreiundzwanzig-
ten Wissenschaft und ihren regelgelei- jährige auf Lebensgewohnheiten auf-
teten Erkenntnisformen, die das Gan- merksam, die ihre Bedeutsamkeit ein-
ze der menschlichen Existenz aus ih- büßen und aus der Welt verschwin-
rem Horizont eliminiert haben. Auf den, weil aufgeklärte Wissenschaft-
der dem einseitigen Autonomiebe- ler sie nicht mehr verstehen, mit ih-
wusstsein unsichtbaren "Rückseite" nen nichts mehr anfangen können, da
zeigen sich Wirklichkeiten, die den sie nicht in ihre Modelle passen. Da-
für alle Widerfahrnisse des Daseins bei geht insbesondere das lebenswelt-
offenen uralten Kulturdokumenten lich Selbstverständliche und Fraglose,
und vormodernen Großerzählungen alles nicht in wissenschaftliche Ka-
(Mythos, Religionen, Welt- und Kul- tegorien Aufzulösende verloren. Das
turentstehungsgeschichten) als be- aufgeklärte Denken akzeptierte nur,
deutsame Leere erschienen, als Sinn- für was es eigene Begriffe und Defi-
dimensionen des Nichtkönnens und nitionen bereithielt. Insbesondere die
des Loslassenkönnens, des Seinlas- "Welt der natürlichen Einstellung", die
sens. Der Mythos, so wird er heute von sich aus keine Veranlassung sieht,
verstanden, ist der Inbegriff sehr alter ihren Horizont "intellektuell" zu über-
Weisheitslehren, die selbst dem von schreiten, wird zu einer wesentlichen
sich überzeugten modernen Men- Quelle, um vormoderne Lebens- und
schen etwas Entscheidendes zur ver- Verhaltensweisen zu verstehen:
meintlich endlosen Reichweite seiner
Weltbemächtigung zu sagen haben: "Den vorchristlichen Völkern wurde
Es gibt Grenzen und Bedingtheiten, das Haus zum Weltmythos; das ist eine
die jeder menschlichen Praxis unver- Selbstverständlichkeit, über die man
fügbar sind, auch der technisch-wis- nicht viel nachdachte, das Leben selbst
senschaftlichen. Auch die "biblische war Grund genug, das richtige Verhal-
Aufklärung", in deren Horizont ten einzunehmen. Es gehörte die gan-
Schwarz sich bewegt, leistet nach ze intellektuelle Grobheit mit ihrer Pö-
Thomas Rentsch hier Orientierung:14 belhaftigkeit dazu, die Ehrfurcht vor
dem Gro[ß]en zu ersticken; was ihr üb-
"Zu der erwähnten Dimension tiefer rigens nur teilweise, in der Aufklärung
Aufklärung gehört neben der sinnkon- gelang."16
stitutiven Fehlbarkeit, der Unbedingt-
heit und Endgültigkeit auch die Per- Im Besinnen auf archaische Lehren
spektive fundamentaler menschlicher schreibt Schwarz: "Die natürliche Ge-
Bedürftigkeit, der Angewiesenheit auf stalt des Weltalls war Träger eines ewi-
die Mitmenschen, der Abhängigkeit gen Sinns. […] Gott hat sie nach dem
von den Anderen und ihrer Mithil- Plan der Ewigkeit errichtet und selbst
fe, ihrem Wohlwollen. Diese Dimensi- in dem uralten Kult an die heilige Son-
on wird in der Bibel vortheoretisch, le- ne liegt Wahrheit." (vBdK, S. 128 f.)
bensweltlich-praktisch in ihrer ganzen
Komplexität narrativ vergegenwär- 2. Über das "Nichts" und die
tigt." 15 Potentiale des Mythos
Man hat Rudolf Schwarz' Denken ein Sein Leben lang konfrontierte Schwarz
"baumeisterliches" genannt (Wolfgang sich und seine Zeitgenossen mit Existenz-
Pehnt). Sicher verfehlten wir seinen fragen, deren Bedeutsamkeit für das
Denkstil, unterstellten wir seiner Leh- Entwerfen und Planen er an vielen, vor
re einen architekturtheoretischen An- allem eigenen Beispielen anschaulich
spruch. Es geht ihm, dem Wahrheits- machte. Ein Verständnis von Unver-
sucher, um etwas anderes. Das Werk- fügbarkeit ist fest in seiner Weltan-
verständnis des Architekten sollte dem schauung verankert und wird in sei-
14Rudolf Schwarz: St. Fronleich- nen Bauten konkret. Er adressierte 'aus nichts'. Nicht in Bildern und Bau-
nam, Aachen. 1929-30. dieses Wissen insbesondere auch an ten, sondern zuerst in lebendigen Men-
Foto. M. Chapey/ K.R. Kegler den "modernen" Architekten, dem an- schen soll diese Erschaffung geschehen,
2011/ 2021. gesichts des ungeheuren wissenschaft- der Bau soll zuerst nur ihr Mittel sein
lich-technischen Fortschritts eigent- und nachher ihre Wirkung." (vBdK, S.
lich alles möglich geworden war. In 134). Wie der biblische Gott den Men-
dem obigen Zitat des jungen Schwarz schen aus dem "Nichts" geschaffen hat,
ist von der Fundierung des Bauens und so waren auch der Mensch und sein Bau-
Wohnens in einer sehr alten Großer- en ursprünglich vor ein "Nichts" gestellt,
zählung die Rede und zugleich von um darauf zu antworten. Die Rede vom
dem zum Scheitern verurteilten Ver- "Nichts" taucht bei Schwarz verschie-
such des modernen Denkens, die ori- dentlich auf. Augustinus, dessen Be-
entierende Bedeutsamkeit z.B. der bi- deutung für die katholische Theologie
blischen Erzählungen zu ignorieren. und die Philosophie des Mittelalters
Die Rede von der Un-Verfügbarkeit Schwarz bekannt war, hat den neu-
stellt etwas in Abrede, nämlich: alles platonischen Begriff des Nichts, der
sei dem Menschen verfügbar. Sie ne- es mit dem "Bösen" gleichsetzte, epo-
giert bewusst dieses Verständnis von chemachend umgedeutet. Wir dürfen
den unbegrenzten Möglichkeiten des davon ausgehen, dass sich Schwarz
Menschen. – Was ist mit der These von auf diese augustinische Neuinterpre-
der Negativität gemeint, wo taucht sie tation bezieht. Danach hat Gott den
zum ersten Mal deutlich auf? Das Wis- Menschen aus dem Nichts erschaffen.
sen der Verneinung und des "Nichts" Das erst gibt die Chance zu einer Ge-
ist Bestandteil einer mythischen Welt- stalt bzw. die Möglichkeit, maßvoll zu
auffassung. Um Schwarz an dieser gestalten. Leo Kobusch erläutert die-
Stelle zu verstehen, müssen wir nach se augustinische Lehre mit folgender
Aufgabe und Funktion des Mythos als Überlegung: "Da all jenes, das die 'Spur'
Speicher von "Weisheitswissen" fragen, von 'Maß, Form und Ordnung' erken-
die schon für eine Deutung des Wel- nen läßt, auf irgendeine Weise ist, kann
tanfangs und der Verknüpfung der auch die Materie nicht nichts sein, denn
Architektur mit diesem Anfang rele- sie ist zwar selbst formlos, aber doch
vant sind: "Die Welt soll gleichsam hin- durch Gottes Güte formbar."17 Diese
ter den ersten Schöpfungstag zurückge- augustinische Interpretation der Ma-
führt und dann neu erschaffen werden terie macht dem Baumeister Schwarz
15die Größe seiner Aufgabe und Ver- her betrachtet werden. Axel Horst-
antwortung für Maß, Form und Ord- mann spricht 1986 in einem philoso-
nung bewusst. Er schreibt: "Hüben ist phischen Überblickartikel vom "My-
die Welt und drüben unsägliche Ewig- thos als eines unvergangenen lebens-
keit, für die auch die Mystiker nur noch wichtigen Elements".19 Es gibt dem-
das Wort von dem 'Nichts' fanden, weil zufolge eine "mythische Vernunft"
dort nicht mehr gilt, was im Welten- (Franz Koppe),20 sie interessiert sich
raum gilt, oder vielmehr überaus al- nicht für das "Wie" (Verfügen über
les, so wie es in Gott ist, aller Worte Ursache-Folgen-Kausalitäten), son-
Urwort und aller Gestalten Urgestalt dern für das "Warum" (lebenswelt-
[…]." (vBdK, S. 27f.) "Die Gestalt wur- liche Orientierung). Franz Koppe hat
de mir zum Schlüssel der Baukunst", 1978 in einem Artikel zum Begriff des
schreibt Schwarz 1960 (K, S. 9). Noch "Mythos"21 festgestellt, dass der grie-
auf eine andere Weise wird der "An- chische Ausdruck Mythos im Deut-
fang" als Antwort auf eine "ursprüng- schen mit Wort, Rede, Erzählung, Fa-
liche Leere" für Schwarz bedeutsam. In bel übersetzt werden kann. Diese li-
Vom Bau der Kirche, macht Schwarz terarischen oder poetischen Weisen,
klar, dass er die Baukunstlehre aus etwas auszudrücken, haben die In-
der christlichen Großerzählung he- tention und auch die Kraft, "den Wi-
raus entwickeln will. Denn wenn die derfahrnissen des Lebens, insbes. dem
gesuchte Lehre weder Wissenschaft Leben als solchem und ganzem, ei-
noch Theorie (und auch keine Theo- nen Sinn zu geben".22 Vielfach geht es
logie) sein soll, dann ist sie Erzählung, in diesen Geschichten darum, den
Benennung, Geschichte des mensch- "Weltursprung" und auch den wei-
lichen Schicksals. Der Mythos gibt teren "Weltverlauf" zu beschreiben.
uns, so Schwarz, ein Bild davon, wie Diese Erzählungen geben Antworten
die Welt "im Anfang" war: "archaisch". auf Fragen, denen niemand auswei-
Archaisch meint einen Gegensatz zur chen kann. Koppe weist auf den Un-
theoretischen Weltursprungsidee rati- terschied in der Art und Weise der
onaler Naturlehren und moderner Na- Beschreibung hin, die "Welt zu erklä-
turwissenschaften: "Bauen heißt doch ren". So wurde Koppe zufolge das Er-
nicht, einen theoretischen Standpunkt zählen von Geschichten von den Wis-
beziehen […], sondern eine mensch- senschaften abqualifiziert und sollte
liche Lage klären und formen." (vBdK dem Erklären durch Tatsachen wei-
S. 32) Schwarz bekräftigt die Bindung chen. Die Naturwissenschaft tritt von
des Architekten an die dem Menschen Anfang an "im Namen überlegener, ra-
unverfügbare Ausgangssituation und tionaler Erklärungsmodelle" auf und
Ursprungslage, dass alles "Bauen" – propagiert eine Kritik, die den My-
Mensch, Natur, Architektur – aus dem thos "als naive, vorwissenschaftliche
"Nichts" erschaffen wurde, und setzt Weise der Naturerklärung darstellt".
diesen Anfang baumeisterlich um. Koppe hält diese Kritik für zum Teil
Schon zu Beginn der menschlichen verfehlt, da mythische Erklärungen
Welt ging es um ein "Bauen" in eine den Deutungsangeboten der Wissen-
ursprüngliche "Leere" hinein. Aus die- schaft nicht grundsätzlich widerspre-
ser Erkenntnis zieht er seine Kraft zum chen. Zwar müsse man gegenüber Le-
Formen und Gestalten. Der auf die- gitimationsmythen kritisch eingestellt
sem "Wissen"18 ruhende "baukünst- sein, wenn sie versuchen, Ideologien
lerische" Umgang mit der "Leere" be- zu rechtfertigen. Die Grundfrage sei
trifft Schwarz' gesamtes Schaffen. jedoch eine andere; im Mythos gehe
es um eine "positive Antwort auf das
Auch wenn Schwarz behauptet, der Sinndefizit gegenüber dem prinzipi-
Kirchenbau sei keine "kosmische My- ell Unverfügbaren, dem der Mensch,
thologie" und: "wer eine Kirche bau- insb. angesichts der Unaufhebbarkeit
en will, setzt keinen Mythos voraus" des existenziellen Zufalls, selbst in der
(vBdE, S. 151), so liegt doch der Grund vollkommensten Gesellschaft ausgelie-
seiner Überzeugung im Glauben an fert bleibt".23
eine heilige Erzählung. Wir haben
dazu schon zu Beginn unserer Aus- Um was geht es nun bei Schwarz? Wie
führungen das wissenschaftskritische geht er mit dem Sinndefizit moder-
Potential sowie die Sinnstiftung des ner Architektur um? Die poetische
Mythos angedeutet. Das soll nun nä- Einbildungskraft und Rede rekrutiert
16Rudolf Schwarz: St. Fronleich- auf Möglichkeiten einer Welterfah- "Urhebung lebendiger Form" (vBdK, S.
nam, Aachen. 1929-30. rung, die die Wissenschaft offensicht- 141). Sie bewährt sich in der mensch-
Foto. M. David/ K.R. Kegler lich sich nicht leisten darf und kann. lichen Aneignung, indem Menschen
2011/ 2021. Das echt Dichterische und überhaupt das Kirchengebäude in Gebrauch neh-
Künstlerische steht für einen Zugang men. Architektur verwirklicht Welt
zur Welt, der nicht per se allen Wissen- als das Ganze des Seienden. "[…] Kir-
schaften verschlossen bleiben. Schwarz che […] ist nicht nur gemauertes Ge-
interpretiert sein architektonisches häuse, sondern alles zusammen, Ge-
Entwerfen deshalb auch als ein dich- bäude und Volk, Leib und Seele, die
terisches.24 Er begreift das architekto- Menschen und Christus, ein gan-
nische Gestalten und Bilden als Dich- zes geistliches Weltall; ein Weltall zu-
ten im Gleichklang mit der Natur, in- mal, das immer aufs neue verwirk-
sofern deren Bau Vorbild ist. Das Ziel licht werden muß. Diese bauende Ur-
seines dichterisch-architektonischen tat meinten wir, den Vorgang, in dem
Schaffens sind "bewohnbare Bilder".25 Kirche lebendige Gestalt wird" (ebd.).
Sicher geht es Schwarz mit seiner Er- So steht der Architektenberuf, bes-
innerung an Urverhältnisse nicht um ser: das Schaffen des Baumeisters, " für
einen Legitimationsmythos, der sei- eine letzte, auf n i c h t s [Hvhg. A.H.]
ne Werklehre wie seine Werke in eine mehr rückführbare Haltung zur Welt"
Position versetzen, in der sie kritiklos (ebd.). Diesen hohen Anspruch muss
zu akzeptieren sind. Vielmehr gilt man zur Kenntnis nehmen, will man
es, über Wesen und Aufgabe der Ar- Schwarz' Baulehre gerecht werden.
chitektur und das Selbstverständnis
des Architekten in kritischer Distanz 3. Die Kunst, die Welt der
zur Moderne neu "aufzuklären". Die- Tatsachen zu überschreiten
ser kritischen Aufklärung geht es, wie
jeder anderen auch, um Erkenntnis. In einem Vortrag, den Schwarz 1951
Aber die Erkenntnis, von der Schwarz auf einer Tagung in Darmstadt gehal-
spricht, ist kein intellektueller Besitz ten hat, hat er das Schweigen des Archi-
von rational-technischen Hypothe- tekten als ein Versagen vor dem "Hö-
sen, sondern sie bewährt sich allein im heren" begründet und die Notwen-
Tun, in der entwerfenden und bauen- digkeit festgestellt, das positive Tatsa-
den Praxis. Sie ist insoweit praktische chenwissen zu überschreiten. Denn es
Erkenntnis. Baukunst, so Schwarz, ist geht um das Einlassen auf einen Er-
17fahrungs- und Denkhorizont, an den terungen des Philosophen Hans Blu-
alle technischen Antworten und Vor- menberg mit Schwarzschen Aussagen
schläge zur Bewältigung der Welt nicht auszuschmücken. Vielmehr will ich
heranreichen: "Haben wir das Über- sie als Hinweis nutzen, um Schwarz'
schießende heute? Sie sehen, wie un- Aussagen zum Handeln und Denken
ser Fragen, das eigentlich ein Fragen des Architekten in eine größere Debat-
nach architektonischen Dingen ist, te um das Unverfügbare einzuordnen.
diese architektonischen Dinge als Fra- Es geht um die Herausstellung und
gen transzendiert und dann in Gebiete Anerkennung von Seins- und Sinnbe-
stößt, wo der Architekt eigentlich nicht reichen, die dem menschlichen Planen,
mehr antworten kann."26 Auch an an- Machen und Herstellen verschlossen
derer Stelle wird den technischen Re- und entzogen sind. Der bauende Ver-
geln der Baukunst ein dringliches Tran- stand steht hier vor den Grenzen sei-
szendieren des überkommenen Regel- nes Wissens und Könnens. Um das be-
werks entgegengesetzt: "Der Städtebau- wusst zu machen, müssen in der Mo-
er muß sich gleichsam selbst überschrei- derne eingeschliffene Denk- und Ver-
ten und auf einen Standpunkt erheben, haltensgrenzen in Frage gestellt wer-
von dem aus er einsieht, was er tun den. Der Überstieg bietet dann, so der
soll." Transzendenz bedeutet den Weg Philosoph Thomas Rentsch, sensibi-
zu einer normativen und orientie- lisierende und orientierende Kompe-
renden Einsicht in das gebotene Ziel tenzen für die Identifizierung des Un-
des eigenen Tuns: "was er eigentlich verfügbaren.
planen soll".27 Transzendieren heißt
z.B. ganz konkret, "einen Plan zeich- "Zu den unverfügbaren, transpragma-
nen, in den [der Planer, A.H.] selber tischen Sinnbedingungen all unserer
eingeplant ist" (BdE, 13). Unsere These Vernunft und Praxis gehört zunächst
einer "negativen" Architekturlehre ist fundamental das, was die Bibel Ge-
hier Ausdruck von Schwarz' Kritik an schöpflichkeit, Kreatürlichkeit nennt.
den Untiefen der Aufklärung und der Die grundlegende praktische Einsicht,
Missachtung der Grenzen des Mach- die sich hier philosophisch reformulie-
und Verfügbaren, die nur in einem ren lässt, ist die Einsicht, dass wir uns
das menschliche Tun normierenden nicht selbst geschaffen, gemacht, herge-
Verständnis von Raum und Zeit ent- stellt haben, sondern dass wir – bei al-
kräftigt und aufgehoben werden kann. len wissenschaftlichen Erklärungsmög-
Auch seine Rede vom Unplanbaren lichkeiten – auf letztlich unerklärliche
gehört dazu. So sind Raum und Zeit Weise da sind."30
in transzendierender Perspektive auf
bestimmte Weise als verbunden zu se- Das Schaffen, Machen und Herstel-
hen. Hans Blumenberg beschreibt die- len kann so vom Kopf wieder auf die
sen Gedanken mit folgenden Worten: Füße gestellt werden. Negativ gesagt
geht es um das Verneinen der uneinge-
"Der Begriff T[ranszendenz] geht von schränkten Verfügbarkeit und Mach-
der Vorstellung einer Grenze des Ge- barkeit, um das Einziehen von Gren-
gebenen und Verfügbaren aus; jen- zen auf dem Gebiet planerisch-kon-
seits dieser Grenze wird eine hetero- struktiver Zweckrationalität – und
gene, unbedingte, nicht objektivierbare zwar Grenzen räumlicher und zeit-
Wirklichkeit angenommen, die deshalb licher Art. Oben sind wir schon auf
nicht als gleichgültig übergangen wer- das Phänomen der "Grenze" gesto-
den kann, weil alles diesseits der Gren- ßen. Schwarz interpretiert diese Gren-
ze Existierende in seinem Grunde von ze auch als "Schwelle" zum Unbetret-
ihr anhängig ist. […] Der Ausdruck baren. Auch seine Rede von einer
T[ranszendenz] bezeichnet sowohl die "absoluten Baukunst" gehört dazu.
absolute Differenz zwischen dem Be- (vBdK, S. 57-59)
dingten (Welt) und seinem Seinsgrund
als auch diesen Grund selbst, insofern
Für den Lehrer und Redner Schwarz
er sich jeder theoretischen Befragungentspricht das Unplanbare dem Unsag-
und praktischen Verfügbarkeit ent- baren. Auch das Aussagenkönnen des
zieht".28 Architekten kommt an seine Grenzen.
Schwarz spricht davon, es gehe ihm in
Es geht mir im Rahmen meines Textes seinen Schriften um "lebendige Wei-
nicht darum, die vorstehenden Erläu- sung" (vBdK, S. 150). Doch jede Leh-
18bare vom Unverfügbaren scheidet. Die
Schwelle ist integraler Bestandteil von
Rudolf Schwarz' "Lehre von den drei
Räumen". Der erste Raum beschreibt
die menschliche Alltagslandschaft, die
Welt, in der wir wohnen, arbeiten, un-
ser Leben führen. Ein zweiter Raum
wird als Gegend vor der Schwelle be-
zeichnet. Dieser Raum ist Grenze und
Öffnung zugleich. Der dritte Raum
oder die dritte Gegend, wie Schwarz
auch sagt, ist das "schlechthin Offene,
und da ist der Himmel", der Raum
der "Ewigkeit" (K, S. 24). Dieser drit-
te Raum ist unbetretbar. Doch auch
dieser Raum muss vom Baumeister
in seine Planung pragmatisch aufge-
nommen und praktisch gestaltet wer-
den, obwohl er absolut "unzugänglich"
ist. Das klingt für einen Entwerfer pa-
radox. In den Ausführungen zu sei-
nem ersten Kirchenbau beschreibt er
die Aufgabe, die drei Räume zu staf-
feln, so:
"Man könnte nun sagen, dieses Drit-
te sei in Fronleichnam [gemeint ist
die gleichnamige Kirche in Aachen,
A.H.] nicht da, dem Raum fehle jede
Durchlässigkeit, und also sei auch die
ewige Bewegung nicht in ihm vorgese-
hen. Aber man vergäße dabei die große
schneeweiße Stirnwand, die ohne Bild
und Teilung hinter dem Altar steht,
Rudolf Schwarz: St. Fronleich- re "endet am Rande, wo alle Dinge en- und vernähme nicht ihr bildloses
nam, Aachen. 1929-30. den, vor dem ewigen Abgrund" (S. 152). Schweigen, das doch in hohem Maße
Foto. R. Joss/ K.R. Kegler Die Lehrrede, so heißt es weiter, "ver- Bild ist. Sie setzt sich als Langwände
2011/ 2021. stummt in der großen Stille" (S. 153). und Rückwand fort, legt sich um die
Im Buch Kirchenbau heißt es: "Was Versammlung der Erde herum und ist
der Baumeister hinter der Schwelle un- ewiger Ort. Die Gemeinde ist rundum
ternimmt, muß jedes Mal eine Aussa- ausgesetzt in Ewigkeit und wird von ihr
ge sein, die den eigenen Widerruf in von allen Seiten durchwirkt, die Erde
sich enthält, menschliches Sagen und aber ist auf dem begehbaren Innen-
menschliches Versagen zugleich, denn raum zurückgehalten, die Wände des
hier versagen die irdischen Aussagen, Raums gehören nicht mehr zu ihr." (K,
hier verstummen die Worte." (K, S. 24). S. 29)
Dennoch muss der Bau rein praktisch
geschlossen werden. Er kann nicht auf Es geht Schwarz nicht um die intel-
robuste Außenmauern verzichten. lektuelle Bewältigung einer theore-
tisch zu lösenden Aufgabe. Es geht al-
Schwarz "negative" Architekturlehre lein um eine Besinnung der Möglich-
(wie ich seinen Umgang mit der Un- keiten und der Grenze des architek-
verfügbarkeit nenne) spricht also vom tonischen Vermögens. Das Ziel liegt
Unbetretbaren, vom Unzugänglichen, in einer gelingenden Praxis, näm-
vom Entzogenen, vom Unbewohn- lich die Menschen gut "zur Schwel-
baren, vom Unplanbaren. Im Zen- le" zu geleiten. Die jenseitige Gegend
trum des baumeisterlichen Tuns, d.h. ist "Geheimnis". Wir wissen irgend-
seiner Kunst, liegt das bewusste Ver- wie davon, das "Geheimnis" ist Teil
legen einer Schwelle. Nicht von einer unserer Wirklichkeit, und der Ar-
beliebigen Schwelle ist die Rede, son- chitekt soll seiner Ahnung vertrau-
dern von derjenigen, die das Verfüg- en, er kann es bloß in Demut hin-
19nehmen, niemals darüber verfügen. chitekt hier sein Tun demütig ganz in
"Was aber jenseits liegt, ist dem Künst- sich zurück und handelt situativ kom-
ler entzogen. Wie soll er zeigen, was petent.
noch keines Menschen Auge gesehen?"
(K, S. 24) Das "Geheimnis" tritt bei 4. Die Grenzen von Raum und
Schwarz als das dem Menschen Ent- Zeit: Das Unplanbare
zogene und darum auch architekto-
nisch Nicht-Zeigbare in Erscheinung. Zum Unplanbaren hat Rudolf Schwarz
Nähert sich der Weltmensch der einen eigenen Text verfasst, der zuerst
Schwelle, dann erwartet ihn das Of- 1947 in der Zeitschrift Baukunst und
fene. Weiter ist zu dieser Stelle nichts Werkform veröffentlicht wurde. Der-
zu sagen. Angesichts des Unfassbaren selbe Aufsatz beschloss auch das 1949
kann der Architekt weiter keine Aus- erschienene Buch Von der Bebauung
sage treffen. Sein Schweigen bezeugt der Erde: "Dieses Buch entstand unter
sein Versagen. "Die Welt bleibt auf mühsamen Umständen während des
der Schwelle und tut sich auf. Mit ar- Krieges drüben in Lothringen" (BdE,
chitektonischen Mitteln läßt sich noch S. 14), wo Schwarz als Landesplaner
dartun, daß der bewohnbare Raum tätig war.29 Der Architekturhistori-
im Schwellenort offen wird, etwas, in- ker Wolfgang Pehnt schreibt über das
dem man den Ring der Gemeinde dort Werk: Es "ist ein wahrhaft erstaun-
aufbricht, daß Gott ihn ergänze. Rein liches Buch, ein sonderbarer und groß-
baulich muß man den Bau ja schlie- artiger Text."31 Dieses Buch ist von
ßen, daß der Schutz vor dem Unwet- zwei planungstheoretischen Kapiteln
ter bietet, geistig aber muß er offenge- eingerahmt: dem Kapitel "Raumpla-
halten werden." (K, S. 24) Jenseits der nung" und dem mit der Überschrift
Schwelle liegt die Gegend des Unver- "Das Unplanbare". Es beginnt folgen-
fügbaren. Dennoch soll der Bau die dermaßen: "Es gibt ein neues Wort,
Transzendenz spürbar und erlebbar das heißt Raumplanung, und meint ei-
machen. Schwarz führt den gotischen nen neuen Zustand der Erde, den ge-
Dom an und erinnert an seine Erfah- planten, und eine neue Kunst, die die
rungen mit dem Straßburger Mün- Erde plant und bestellt, und meint
ster, das zur Heimatgemeinde seiner die Landschaft als Raum." (BdE, S. 7)
Kindheit gehörte. Der Kirchenbauer Schwarz stellt in diesem Buch die Fra-
sieht sich nicht technischen, sondern ge, ob denn die Erde überhaupt "die
normativen Entwurfsentscheidungen Art des Raums hat", ob "sie geplant
gegenübergestellt, mit denen er rech- werden kann […], einen Plan verträgt"?
nen muss und die er nicht zu igno- (ebd.). Der Ausblick darauf, dass die
rieren vermag, weil die Situation ihn ganze Erde zu einem Planungsge-
existentiell trifft. Zum Kirchenbau genstand werden könnte, ist Schwarz
sagt Schwarz: "Die Baukunst kommt, nicht geheuer: "Es hat auch eine Gren-
wie man so sagt, in ihre existentielle ze." (ebd.). Schwarz erinnert daran,
Situation." (K, S. 325). dass gerade das Sprengen von Gren-
zen zu jener Situation geführt hat, die
Auf die Herausforderung, das Ge- jetzt auf Planung dringt. Er spricht
heimnis der Schwellen- und Grenz- sich, angesichts der Erfahrungen mit
situation architektonisch auszudrü- den Folgen von ungesteuerter Indus-
cken, kommt er auch anlässlich eines trialisierung und planlosem Städte-
Vortrags während des Katholikentags wachstum, für Zurückhaltung und
in Köln (1956) zu sprechen, wo er für Mäßigung aus: "Der Behälter der Ge-
die Gestaltung der Festwiese verant- schichte, das ist der ihr karg zugemes-
wortlich war. Schwarz spricht diesen sene Raum, muß für wertvolle Inhalt
Raum an als die für den Menschen freigehalten bleiben, das andere, das
unbewohnbare und "unbetretbare Ge- noch nicht schlecht zu sein braucht,
gend hinter der Schwelle. Hier aber, wo aber Zeit und Raum fräße, muß ein-
der Bau ins Jenseits durchsichtig wird, geschränkt werden […]. Man muß die
ist er als nur noch bedeutendes Sinn- Geschichte vereinfachen, mit ihren
bild gefordert, denn hier beginnt ja das Mitteln haushalten, damit das Weni-
Unbewohnbare, der Bau überschreitet ge, das nottut, getan wird" (BdE, S. 9).
sich selbst und wird eine Aussage und Schon zu Beginn seiner Planungsleh-
reines Zeichen." (K, 252) Angesichts re taucht ein negatives Motiv auf. Die
des Unverfügbaren nimmt der Ar- bewusste Verneinung ungehemmter
20technischer Möglichkeiten des Ma- das um alles Denken herumliegt und es
chens und Bauens wird gefordert. Es im Maß s e i n e r E n d l i c h k e i t ein-
ist die Absage an ein modernes Den- hegt, die Erde und all ihre Dinge und
ken von Landschaft als Raum, das aus unter anderm sich selbst in ihre End-
Prinzip das Herstellen vor ein War- lichkeit einweisen." (BdE, S. 13; Hvhg.
ten und Unterlassen stellt. Schwarz A.H.) Der Planer muss in allem sei-
fasst sein Verständnis von Zukunft ne "Schöpferkraft" sich "mäßigen". Die
mit Hilfe eines Bildes, indem er vom Erde ist begrenzter Raum. Der Planer,
"Behälter der Geschichte" schreibt. Es der mit seinem Plan in die Zukunft
ist eine gegen den Zeitgeist gerichtete greift, muss wissen, dass es keine "ewi-
Perspektive, die die Gegenwartsstim- ge" Zukunft gibt, sondern dass die
mung bewusst überschreitet. Dieser Welt an ein Ende kommen wird. Was
"Behälter" ist eine Schöpfung, mit der nach diesem Ende geschieht, ist unge-
der Schöpfer "Zeit und Raum" zugelas- wiss. Er "soll die Welt und das Ende der
sen hat und beides ein Geschenk. Dem Welt planen […]. Dieser neue Künstler,
Menschen ist aufgegeben, mit "Zeit den wir meinen, steht an dem Grenz-
und Raum" pfleglich umzugehen. "Der saum der Erde – auch an diesem – und
Geschichtsbehälter füllt sich mit Kram tut, indem er tut, auch sein Untun, sein
und Wust und auch mit Dingen, neben Lassen und Scheiden." (BdE, S. 13)
denen, sind sie einmal eingelassen, an-
dere nicht aufkommen können" (ebd.). Wieder werden Architekt und Planer
Das ist die Erfahrung mit den Hinter- mit den Bedingtheiten ihrer Möglich-
lassenschaften des 19. und der ersten keiten konfrontiert. Schwarz macht
Hälfte des 20. Jahrhunderts. Voraus- klar, dass es sich dabei nicht um eine
setzung einer guten Raumplanung ist zufällige und momentane Grenze
aber ein Bewusstsein von Endlichkeit: knapper Mittel und Ressourcen han-
"Enttäuscht kehrten die Menschen aus delt, die die wissenschaftlich-technischen
ihrer vermeinten Unendlichkeit heim Progressivkräfte demnächst mit Sicher-
ins Begrenzte. Alles war endlich, sie heit hinter sich gelassen haben werden.
selbst waren endlich, eingesetzt in eine Die Grenze, von der er spricht, liegt jen-
endliche Welt, um Endliches an ihr zu seits eines ungehemmten Fortschritts-
wirken." Der "Geschichtsbehälter" ent- denkens. Das muss einer Zeit, die an ein
hält nur eine endliche und begrenzte unaufhaltsames technologisches und
Welt. Die (Lebens-)Zeit des Menschen technisches Problemlösen glaubt, als
ist endlich, sein (Lebens-)Raum be- pure Provokation erscheinen.
grenzt. Aber auch die Dinge, mit de-
nen der Mensch sich umgibt, unterste- 5. Fazit und ein Vorschlag
hen der Begrenztheit und Endlichkeit.
"[D]ie Grenze gab auch jedem Ding Was hat es mit dem Unverfügbaren
wieder sein Maß" (BdE, S. 9). bzw. Unplanbarem auf sich? Das Ori-
entierungswissen, dem es auch um das
Das Maß, ein Zentralbegriff des Ent- Unverfügbare geht, lässt es vernünftig
werfens und Planens, muss also am und klug erscheinen, sich auf Gren-
unbedingten Wissen32 der Grenze ge- ze, Maß und Unplanbares zu besin-
nommen werden. Existentielle wie na- nen und die Haltung des Architekten
türliche Begrenzungen, ebenso die zu seinen Möglichkeiten auf eine "an-
Endlichkeit von Mensch, Zeit und dere" Weise zu denken. Dafür hat uns
Raum sind dem bauenden Verstand Rudolf Schwarz mit seiner "negativen"
unverfügbar. Er muss sie hinnehmen, Baulehre unmissverständlich sensibi-
da der "Weltenerbauer" die "Menschen lisiert und ein Beispiel gegeben. Wir
endlich ersann" (BdE., S. 15). So wer- werden Zeugen einer religiösen Le-
den in diesem Buch zur Raumordnung bensform und ihrer Orientierungs-
die "Endlichkeit" und ihr Pendant verhältnisse. Ein daran kritisch an-
das "Maß" zu weiteren Zentralwor- knüpfender normativer Umgang mit
ten der "negativen" Architekturleh- den Grundlagen der Architektur ver-
re. Es geht um die Planung der Erde, spricht aber nur dann erfolgreich zu
der Schöpfung. Der Planer "soll die Ge- sein, insofern das Unterscheidungs-
schöpfe großziehen und auch um seine wissen zwischen dem Verfügbaren
Kunst rundum eine andere umfäng- und dem Unverfügbaren als eigen-
liche K u n s t des Beendens legen und ständiges Entwurfskönnen anerkannt
all sein Denken in ein Bedenken betten, wird. Was ist das für ein Wissen, das
21zwischen dem Verfügbaren und dem verfügbare thematisiert wird. Unser
Unverfügbaren unterscheidet? Man Alltagsverstand weiß sehr gut, dass es
kann wissenschaftlich nicht bewei- Bedingtheiten gibt, die dem mensch-
sen, dass es das Unverfügbare tatsäch- lichen Handeln entzogen sind. Jeder
lich gibt. Aber es ist für uns Menschen Lebensentwurf, jede Lebensplanung
vernünftig, das Unverfügbare uns zur orientieren sich an einer letztlich un-
Gewissheit zu bringen. gewissen Zukunft, für die sie gemeint
sind. So stellt sich jedem Entwerfer,
Entwerfen ist eben nicht nur Tun, auch dem professionellen, die Fra-
sondern die Kompetenz des Archi- ge, wie er überhaupt vernünftig auf
tekten zeigt sich auch im Lassen, im die Zukunft, deren Wirklichkeit un-
begründeten Verzicht und Einsicht in zugänglich und nicht vorhersehbar
die Grenzen menschlicher Möglich- ist, reagieren soll. Unsere Lebenser-
keiten. Damit sind nicht ein Scheitern fahrung mahnt zu Gelassenheit und
aus Geldmangel, uneinsichtige Bau- hofft aus Erfahrung auf ein gutes Ge-
herren oder handwerkliche Unfähig- lingen. Indem man aber (wie eini-
keit gemeint. Es liegt immer eine aufs ge Denker der Moderne) die Zukunft
Neue zu entscheidende Problemsi- zur immerwährenden Gegenwart er-
tuation vor, da der Eingriff in Natur, klärt, lässt sich das Kommende allen-
Landschaft und räumlicher Lebens- falls rational-instrumentell, d.h. ins
welt eine Zäsur bedeutet, die nicht um Heute übersetzt: modisch meistern.
irgendeines Fortschrittswillens unsere Hier muss ein Umdenken einsetzen.
Aufmerksamkeit verdient. Was "Fort- Der Eingriff in Natur- und Kultur-
schritt" eigentlich ist oder sein soll, verhältnisse wird seit der Neuzeit als
welche Art von Fortkommen oder technisches bzw. zweckrationales Ver-
Wandel gewünscht wird, diese Fra- halten und Handeln aufgefasst und
gen müssen offen und intersubjektiv durchgeführt.34 Dabei unterstellt die-
besprochen werden. Schwarz zeigt, ses Agieren, dass Natur und Kultur un-
dass das Tun des Architekten sich begrenzt verfügbar sind. Das entspre-
nicht gedanken- und hilflos vom tech- chend eingestellte Entwerfen und Pla-
nischen und/oder ästhetischen Mach- nen geht mit dieser Haltung die anste-
barkeitsoptimismus bestimmen las- henden Bau- und Planungsprobleme
sen sollte.33 Der Planer darf sich nicht an und bezieht sich allein in tech-
hinter der Technik, hinter einem Re- nischer Weise auf die Welt. Denn der
gelwerk, Sachverhältnissen und deren Homo faber ist gewohnt, aktivisch-au-
Zwänge oder unglaubwürdig gewor- tonom die Welt in seinen Griff zu neh-
dene Traditionen verstecken und mei- men. "Ein Akteur hat Zwecke, auf die
nen, so notwendigen Entscheidungen er gleichsam schon vor allem Han-
auszuweichen. Schwarz bietet mit sei- deln gerichtet ist und nun tritt er in die
ner "negativen" Architekturlehre nicht Welt ein und findet […] geeignete Mit-
nur eine Orientierung, sondern for- tel zur Realisierung dieser Zwecke."35
dert eine "dritte Raumordnung". Sie Aber Zwecke und Mittel des architek-
sei dem Planer die schwerste, "denn tonischen Tuns, die an dem besonde-
er kann die Welt ja nicht planen ohne ren Handlungsziel, die Welt bewohn-
sich selbst zu entwerfen" (BdE, S. 12). bar zu gestalten, je zu bemessen sind,
Auch wenn wir uns seine Glaubens- lassen sich nicht deduktiv rational-lo-
vorstellungen und "mythischen" Her- gisch bestimmen. Jede Entwurfssitu-
leitungen nicht zu eigen machen kön- ation ist anders, neu und einzigartig.
nen, bleibt die Aufforderung rich- Dem Entwerfer widerfahren situative
tig und wichtig, der eigenen Gewiss- Einmaligkeiten: Menschen, Orte, Ge-
heiten sich bewusst zu werden und als genden, Stimmungen, historischer
Architekten die Reichweite der eige- Augenblick, sie alle müssen erst noch
nen Handlungskompetenz kritisch zu entdeckt werden. Auch der Entwer-
überprüfen. fer mit seiner Lebensgeschichte muss
der neuartigen Konstellation und ih-
Welche Bedeutung kann das Wissen ren Gegebenheiten angepasst begeg-
des Unverfügbaren überhaupt für ein nen. Ihm sind ja die Erfahrungen,
zeitgemäßes Selbst- und Entwurfsver- die er während eines Planungspro-
ständnis haben? An dieser Stelle ist zesses erst noch "machen" wird, voll-
festzuhalten, dass beileibe nicht allein kommen ungewiss.36 Das Ganze der
in religiösen Lebensformen das Un- Umstände unseres Handelns ist uns
22Rudolf Schwarz: St. Fron- nicht verfügbar. Ein situativ vernünf- rich Kambartel führt methodische
leichnam, Aachen. 1929-30. tiges Handeln kann hier nicht darin Überlegungen an, wenn er etwa an-
Foto. K.R. Kegler 2011/ bestehen, die Anweisungen einer hi- regt, "Einsichten durch Argumente
2021. storisch freischwebenden und ano- 'herbeizuführen'."38 Darin sieht er ei-
nymen Zweck-Mittel-Kausalität aus- nen Weg, das Unverfügbare nicht als
zuführen. Vielmehr muss der Ent- etwas objektiv Unfassbares abzuweh-
werfer auf Grund der Einsicht in das ren, sondern es zuversichtlich-hin-
Unverfügbare selbständig entscheiden, nehmend in unsere Lebenspraxis zu
was jeweils zu tun ist.37 Nur so bekom- integrieren und folglich das Streben,
men wir überhaupt die Ziele unseres darüber verfügen zu müssen, argu-
Handels wieder in die eigene Hand. mentativ zu unterlassen. Mein Vor-
Das kann zum Beispiel heißen, dass schlag: Wir sollten in der Entwurfs-
wir bereits bei der Formulierung un- arbeit weder uns vom Unverfügbaren
seres Planungsziels Unsicherheiten hilf- und begriffslos überwältigen las-
und Bedingtheiten seiner Umsetzbar- sen noch versuchen, es zu "entmystifi-
keit und Erreichbarkeit kommunika- zieren". Besser, so scheint mir, könnte
tiv berücksichtigen sollten. Werden es damit gehen, wenn wir bei der an-
aber Architekten und Planer über- stehenden Neufassung des Verständ-
haupt in Studium und Ausbildung nisses von Handeln (Entwerfen, Pla-
damit konfrontiert, wie sie Wege der nen) auch dem Unverfügbaren unter
Einsicht in das Unverfügbare fin- Aufbietung guter Gründe seinen un-
den und beschreiten können? Fried- bedingten Ort einräumten.
23Anmerkungen: 6 Jürgen Habermas: "Die 16 Schwarz zitiert bei Hasler
Verschlingung von Mythos und (vgl. Anm. 1), S. 203, Anm. 392.
1 An Sekundärliteratur zu Aufklärung. Bemerkungen zur
Schwarz habe ich drei Arbeiten Dialektik der Aufklärung – nach 17 Theo Kobusch: [Artikel]
herangezogen: Wolfgang Pehnt: einer erneuten Lektüre". In: "Nichts, Nichtseiendes". In:
Rudolf Schwarz 1897-1961. Bohrer 1983 (vgl. Anm. 4), S. Historisches Wörterbuch der
Architekt einer anderen Moderne. 405-431. Philosophie, Band 6. Basel 1984.
Ostfildern-Ruit 1997; Thomas Sp. 835.
Hasler: Architektur als Ausdruck 7 Wilhelm Kamlah: Der Mensch
– Rudolf Schwarz. Zürich, Berlin in der Profanität. Versuch einer 18 Schwarz selbst hat sich,
2000; Alexander Henning Smolian: Kritik der profanen durch ver- soweit ich sehe, nicht mit der
Weltanschauung und Planung am nehmende Vernunft. Stuttgart Unterscheidung zwischen
Beispiel des Architekten und Stadt- 1949 und Wilhelm Kamlah: Glauben und Wissen auseinan-
planers Rudolf Schwarz. Aachen Philosophische Anthropologie. dergesetzt. Es ist also fraglich,
2014. In diesen Publikationen Sprachkritische Grundlegung und welches der beiden Ausdrücke
finden sich ausführliche Angaben Ethik. Zürich 1972. an dieser und ähnlicher Stellen
zu Leben und Werk von Schwarz, passend ist. Ich weise auf
so dass ich auf entsprechende 8 Friedrich Kambartel: folgende Auslegung hin: "Die
Hinweise verzichten kann. Die "Über die Gelassenheit. Zum neueste protestantische und ka-
drei schriftstellerischen Haupt- vernünftigen Umgang mit dem tholische Theologie sieht keinerlei
werke von Schwarz werde ich Unverfügbaren." In: Philosophie Gegensatz zwischen G.[lauben]
folgendermaßen abkürzen: Vom der humanen Welt. Frankfurt und W.[issen]. Während einige
Bau der Kirche, 2. Aufl. Heidelberg a.M.1989. jedoch die Grenze zwischen
1947, mit vBdK; Die Bebauung der beiden beachtet wissen möchten,
Erde, Heidelberg 1949, mit BdE; 9 Jürgen Mittelstraß: "Das bemühen sich andere energisch
Kirchenbau, Heidelberg 1960, Verfügbare und das Unverfüg- und eine 'Restitution des Und
mit K. Anschließend gebe ich die bare". Paderborn 2000. [https:// zwischen G. und W.' bzw. stellen
Seitenzahl des jeweiligen Buchs, www.hnf.de/veranstaltungen/ fest, daß in jedem G. auch ein W.
dem das Zitat entnommen events/paderborner-podium/ und eine Gewißheit, wenn auch
wurde, an. glaube-in-der-wissensge- nicht im Sinne der Mathematik
sellschaft/mittelstrass.html] und der Naturwissenschaft liegt,
2 Vgl. Hans Robert Jauß: Abgerufen am 18.2.2020. oder empfehlen den G. sogar als
Literarische Tradition und Korrektur an der Wissenschaft."
gegenwärtiges Bewußtsein der 10 Wilhelm Kamlah: "Sokrates Ulrich Dierse: [Artikel] "Glauben
Modernität. In: Hans Steffen und die Paideia" (1949). In: und Wissen". In: Historisches
(Hg.): Aspekte der Modernität. Von der Sprache zur Vernunft. Wörterbuch der Philosophie,
Göttingen1965, S. 150-197; Philosophie und Wissenschaft Band 3. Basel 1974, Sp. 653.
Hans Ulrich Gumbrecht: in der neuzeitlichen Profanität. Unterstellen wir einmal, dass
[Artikel] "Modern, Modernität, Zürich 1975. S. 45-85. S. 81. Schwarz mit dieser Auslegung
Moderne". In: Otto Brunner u.a. zufrieden gewesen wäre.
(Hg.): Geschichtliche Grundbe- 11 Vgl. Karl R. Kegler: "Zu den
griffe. Band 4. Stuttgart1993, S. Rückseiten der Architektur". 19 Axel Horstmann, [Artikel]
93-131. Das gleichnamige Manuskript "Mythos, Mythologie". In:
wurde mir vom Autor freund- Historisches Wörterbuch der
3 Vgl. Wolfgang Welsch: licherweise zur Verfügung Philosophie Band 6. Basel 1984,
Unsere postmoderne Moderne. gestellt. Sp. 313.
Weinheim 1987; "Postmoderne.
Eine Bilanz". MERKUR. Deutsche 12 Vgl. dazu und zum 20 Vgl. Franz Koppe: "Mythi-
Zeitschrift für europäisches Folgenden Smolian 2014 (vgl. sche Vernunft?" In: Jürgen Mit-
Denken. Hg. v. Karl Heinz Bohrer Anm. 1). telstraß/ Manfred Riedel (Hg.):
und Kurt Scheel. Heft 9/10. 52. Vernünftiges Denken. Studien
Jg. Sept./Okt. 1998. 13 Ebd., S. 131 zur praktischen Philosophie und
Wissenschaftstheorie. Berlin/
4 Karl Heinz Bohrer (Hg.): 14 Vgl. Thomas Rentsch: "Die New York 1978, S. 301-326.
Mythos und Moderne. Frankfurt Entdeckung der Unverfüg-
a.M. 1983. barkeit". In: Transzendenz und 21 Franz Koppe: [Artikel]
Negativität. Religionsphilosophie "Mythos". In: Enzyklopädie
5 Max Horkheimer, Theodor und ästhetische Studien. Berlin, Philosophie und Wissenschafts-
W. Adorno: Dialektik der Aufklä- New York 2011. S. 6-13. theorie. 5. Band. Stuttgart 2013.
rung. Philosophische Fragmente S. 483-486.
(1947). Frankfurt a.M. 1969. 15 Ebd. S. 10
2422 Ebd., S. 483. und Raum. Das Darmstädter und das Denken der Technik.
Gespräch 1951. Braunschweig Bielefeld 2008, S. 128.
23 Ebd., S. 484. 1991. S. 86.
36 "[D]er Mensch hat niemals
24 "Bau [des Menschen, A.H.] 27 Ebd., S. 187. alle Bedingungen seines Han-
lebt in vielerlei Räumen, er hat delns in der Hand, nicht einmal
den Raum seiner Techne und 28 Hans Blumenberg: [Artikel] die Faktizität, die sein Leben,
auch seiner reinen Bedeutung, "Transzendenz". In: Religion in seine Gegenwart – mit allen
er hat seinen Dienst, den man Geschichte und Gegenwart Bd. 6, seinen Vorstellungen, Wünschen
gerne als Zweck mißversteht, und S. 990. und Hoffnungen – ausmacht."
er hat seinen lebendigen Inhalt, Mittelstraß 2000 (vgl. Anm. 9).
die Menschen, die in dem Raum 29 Rentsch 2011 (vgl. Anm. 14),
allerlei unternehmen, und es ist S. 7. 37 Damit beziehe ich mich auf
nicht gesagt, daß sich alles in Überlegungen zur Ethik, die
kongruenten Gestalten begibt. 30 Vgl. Smolian 2014 (vgl. Wilhelm Kamlah vorgebracht
Große Dichtung ist da zu tun, daß Anm. 1). hat. Vgl. Kamlah 1972 (vgl.
all diese vielerlei Räume zu einer Anm. 7).
gemeinsamen Form übereinkom- 31 Pehnt 1997 (vgl. Anm. 1), S.
men." K, S. 8f. 112. 38 Kambartel 1989 (vgl. Anm.
8), S. 94. Der Landschaftstheo-
25 So bestimmt er in einem 32 Vgl. Anm. 3. retiker und Philosoph Karsten
Vortrag, "daß es Wesen und Berr macht in Anschluss an
Aufgabe der Baukunst ist, 33 Vgl. Martin Seel: Bestimmen Kambartel den Vorschlag, "das
bewohnbare Bilder zu schaffen." und Bestimmenlassen. Anfänge Unverfügbare zu akzeptieren
K, S. 248. Vgl. Achim Hahn: einer medialen Erkenntnistheo- und sich auf das Verfügbare zu
"Dimensionen der Einbildungs- rie. Frankfurt a.M. 2002. konzentrieren", vgl. "Philoso-
kraft (für Karsten Harries)". In: phische Praxis und die Idee des
Wolkenkuckucksheim. 12. Jg., 34 Vgl. Hans Freyer: Theorie guten Lebens". In: Hans Friesen,
Heft 1, August 2007. des gegenwärtigen Zeitalters. Karsten Berr (Hg.): Dimensionen
Stuttgart 1958. Praktizierender Philosophie.
26 Rudolf Schwarz: "Das Anlie- Essen 2003, S. 83.
gen der Baukunst". In: Mensch 35 Andreas Luckner: Heidegger
25Sie können auch lesen