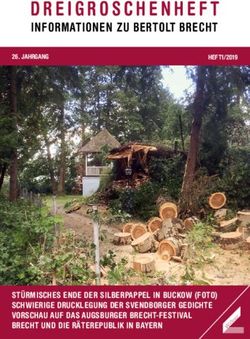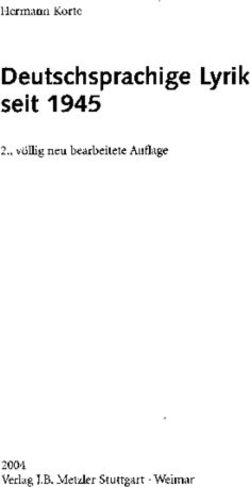Bert Brechts Lyrik Außenansichten - Hans Vilmar Geppert
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Inhalt
1 Vorwort: „Stehend an meinem Schreibpult“
Außenansichten von Bert Brechts Lyrik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 „Warum soll mein Name genannt werden?“
Ein lyrisch-politisches Programm im Exil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3 „Sieh den Balken dort!“
Zur Sinnlichkeit der Chiffren in Bert Brechts Lyrik . . . . . . . . . . . . . 29
4 „Ach wie solln wir nun die kleine Rose buchen?“
Bert Brechts Lyrik und die Tradition der Moderne . . . . . . . . . . . . . . 49
5 „Verwisch die Spuren!“
Bert Brechts Lesebuch für Städtebewohner im Mediendialog . . . . . . . . 69
6 „Ein kräftiges WENN NICHT“
Zur Logik des Engagements in Bert Brechts Lyrik . . . . . . . . . . . . . . . 101
7 „Vergnügungen“
Dialektik als kreative Alltagslogik im Kinderbuch, in der Werbung
und in Bert Brechts später Lyrik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
8 „Warum sehe ich den Radwechsel mit Ungeduld?“
Zur Kontinuität der Argumentation in Bert Brechts
Buckower Elegien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Anhang
Bert Brechts Buckower Elegien neu geordnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163„Ach wie solln wir nun die kleine Rose buchen?“
4 Bert Brechts Lyrik und die Tradition der Moderne
Unter den späten Gedichten von Bert Brecht befindet sich eines, über das ich
mich schon seit einiger Zeit immer ein bisschen ärgere. Daher will ich es auch
Ihnen nicht vorenthalten:
Beim Anhören von Versen
Des todessüchtigen Benn
Habe ich auf Arbeitergesichtern einen Ausdruck gesehen
Der nicht dem Versbau galt und kostbarer war
Als das Lächeln der Mona Lisa.
(15.300)1
Hier ist vieles unpassend: Solche Gedichte schreibt Brecht nicht oft und nach
dem Exil immer seltener. Das Gedicht ist auch ein bisschen dümmlich: Benns
große Wirkung auch über die so genannten „Intellektuellen“ hinaus ist
erwiesen. Und vor allem ist Benn nicht „todessüchtig“. Er redet gar nicht
oft vom Tod, und wenn, dann immer, schon seit seinen frühen expressio-
nistischen Gedichten, in einem ausgesprochen vitalistischen Sinn:
Und sinkt der letzte Falter in die Tiefe
die letzte Neige und das letzte Weh,
bleibt doch der große Chor, der weiterriefe:
die Himmel wechseln ihre Sterne − geh.
Der Tod erscheint als ein bloßer Übergang im Gesamt evolutionärer Prozesse;
über jeden Tod hinaus führt innerweltliche Transzendenz, ein größeres
„Leben“ als das je eigene:
Die Fluten, die Flammen, die Fragen −
und dann auf Asche sehn:
„Leben ist Brückenschlagen
über Ströme, die vergehn.“2
Auch im Mittelvers des programmatischen Gedichts Statische Gedichte, auf das
ich gleich eingehen werde, nimmt Benn eher die Haltung des stoischen Weisen
1 Zur Zitierweise vgl. oben Kap. 1, Anmerkung 2.
2 Gottfried Benn, Gesammelte Werke. Hrsg. Von Dieter Wellershoff, Wiesbaden 1960, Bd. 1,
S. 344 (Epilog 3).50 „Ach wie solln wir nun die kleine Rose buchen?“
ein, der den Tod weder fürchtet noch ersehnt und ihn gelassen erwartet, als die
irgendeiner „Sucht“ nach ihm.
Wer dagegen auffallend viel vom Tod, vom Gestorbensein, von der Hölle,
vom Abschiednehmen und Vergessenwerden dichtet, ist – Brecht selbst. Dass
ein Intellektueller von der „Arbeiter-Klasse“, die er sucht, „belächelt“ und
verkannt wird − „In der Welt, die ich mir wünsche, komme ich nicht vor [. . .]
Strebend nach einem Kollektiv, verlasse ich ein Kollektiv“3; Benn dagegen
beansprucht das Recht zum Monolog und erhebt die Distanz zum Prinzip −, ja,
dass der Weise geradezu verlacht wird, ist ebenfalls etwas, was Brecht selbst
beschäftigt: „Ha! Ha! Ha! lachten die Kunden des Sokrates [. . .]“ (1183/
15.299), so beginnt gleich das in der „kleinen“ Werkausgabe der Benn-Ver-
spottung folgende späte Gedicht, das Elisabeth Hauptmann noch den Buckower
Elegien zugeordnet hatte.4 Es scheint ja überhaupt ein Gesetz zu sein: Wenn
Dichter über Dichter reden, dann reden sie immer auch über sich selbst.
Gibt es also vielleicht zwischen den beiden Antipoden der deutschen
Nachkriegslyrik, Benn und Brecht, nach denen man früher geradezu ver-
schiedene Epochen einteilte,5 tiefer liegende Gemeinsamkeiten und Zusam-
menhänge, so etwas wie einen verborgenen Dialog der Gegenthesen, oder
eben ganz allgemein „moderne“ gemeinsame Voraussetzungen ihrer im
Ergebnis freilich ganz verschiedenen Poetik? Diese Frage ließe sich, wenn
überhaupt, nur im größeren Kontext der Frage nach „Bert Brechts Lyrik und
die Tradition der europäischen Moderne“ beantworten. Zu dieser Moderne hat
Benn sich immer bekannt, er hat sie nach dem Krieg wesentlich propagiert.
Aber wie steht es mit Brecht?
Für die Forschung war und ist das weithin ein Tabu-Thema.6 In dem lange
prägenden Standard-Werk von Hugo Friedrich Die Struktur der modernen
Lyrik (1956) kam Brecht als Lyriker nicht vor.7 Und umgekehrt schienen
Brecht-Forscher lange irgendwie stolz darauf zu sein, Baudelaire oder Rilke
3 Bertolt Brecht, Gesammelte Werke in 20 Bänden. Hrsg. vom Suhrkamp Verlag in Zusammen-
arbeit mit Elisabeth Hauptmann, Frankfurt/M. 1967; Supplementbände zur Werkausgabe.
Gedichte aus dem Nachlaß. Hrsg. von Herta Ramthun, Frankfurt/M. 1982, Bd. 3, S. 244.
4 Bertolt Brecht, Gesammelte Werke, Bd. 10, S. 1018.
5 So etwa und prägend Walter Hinck, (Hrsg.), Gedichte und Interpretationen. Bd. 6: Gegenwart.
Stuttgart 1982, S. 14.
6 Auf alle Fälle ist die Sorge, dass eine „Annäherung seines [Brechts] Begriffs politischer Lyrik an
die Konzeption autonomer Kunst“ und der Versuch, „hinter dem Ideologen Brecht den
Dichter aufzuspüren“, dass dies eine „Entpolitisierung“, „Vereinnahmung“ und „ideologische
Anpassung“ mit sich bringe (Klaus-Detlef Müller, Bertolt Brecht. Epoche – Werk – Wirkung.
München 2009, S. 187), diese Sorge scheint mir unbegründet. Die moderne autonome
Ästhetik bildet, davon bin ich überzeugt, die Voraussetzung politisch-kommunikativer
Wirkung in Brechts Lyrik, auf alle Fälle in seinen besten Gedichten.
7 Hugo Friedrich, Die Struktur der modernen Lyrik. Erweiterte Neuausgabe, Hamburg 1967.Bert Brechts Lyrik und die Tradition der Moderne 51
oder Benn nicht zu kennen. Dagegen hat z. B. Michael Hamburger immer
wieder auf die europäisch-modernen Züge in Brechts Lyrik hingewiesen, in
einzelnen Interpretationen, in Querverweisen (Rimbaud und Brecht, Brecht
und Apollinaire, Ezra Pound, William Carlos Williams) und kontinuierlich auf
immerhin zehn von 406 Seiten seines Buches The Truth of Poetry (1969)/
deutsch: Die Dialektik der modernen Lyrik (1972), später: Wahrheit und Poesie
(1985):
Der Unterschied zwischen einer primär auf Entdeckung ausgehenden oder experi-
mentellen Lyrik und einer Lyrik, deren primäres Anliegen ihre Funktion als Kom-
munikationsmedium ist [. . .] der Unterschied ist also ein gradueller.8
Ich möchte mich dem anschließen und noch einen Schritt weiter gehen: Nicht
nur gibt es Zusammenhänge und Übergänge. Das sogenannte Moderne, also
z. B. die „Anarchie der Imagination“, das Ausspielen der ästhetischen Nega-
tionen und Entautomatisierungen, die Offenheit des Kunstwerks, das im
Prinzip radikale Experiment, ist in Brechts Gedichten, auf alle Fälle in den
gelungensten, Voraussetzung seines kommunikativen, sozialen und politischen
Engagements, natürlich nicht die einzige, aber eine wesentliche und unver-
zichtbare.
Man könnte nun so vorgehen, dass man der Entwicklung Brechts folgt und
so z. B. den Spuren des Expressionismus nachgeht, ein Verfahren, das Brecht
mit Sicherheit in der Tradition der europäischen Moderne zeigen würde. Ich
wähle aber heute einen eher essayistischen, auf alle Fälle direkteren und
hoffentlich anschaulicheren, eben einen komparativen Weg:
Etwa zur Zeit der Buckower Elegien (1953), auf die und ihr, vorsichtig
gesagt,9 mögliches lyrisches Umfeld ich mich konzentrieren möchte, ent-
standen ganz unabhängig voneinander Gedichte verschiedener Autoren, in
denen zentrale Strukturen der modernen Lyrik bewusst rekonstruiert wurden,
und indem ich diese Texte zu denen Brechts in Beziehung setze, aus dem Dialog
der Gegensätze heraus, möchte ich versuchen, mich meinem Thema und
meiner These zu nähern.
8 Michael Hamburger, Die Dialektik der modernen Lyrik. Dt. von H. Fischer, München 1972,
S. 245, vgl. ebd. ff.; im bewussten Anschluss an Hamburger und kritisch gegenüber Friedrich
(vgl. S. 7 ff.) hat z. B. auch Dieter Lamping (Moderne Lyrik. Eine Einführung. Göttingen 1991)
den Begriff so erweitert, dass Brecht und überhaupt die „politische Lyrik“ darin Platz haben
(vgl. v. a. S. 42 ff.), aber in der Dichotomie: „realistische“ gegen „symbolistische“ Tradition
scheint mir dann doch das Modell der „Antipoden“ weiter zu leben.
9 Vgl. v. a. zur Zyklusfrage auch unten Kap. 8 „Warum sehe ich den Radwechsel mit Ungeduld?“ Zur
Kontinuität der Argumentation in Bert Brechts „Buckower Elegien“.52 „Ach wie solln wir nun die kleine Rose buchen?“
Gottfried Benn
Statische Gedichte
Entwicklungsfremdheit
ist die Tiefe des Weisen,
Kinder und Kindeskinder
beunruhigen ihn nicht,
dringen nicht in ihn ein.
Richtungen vertreten,
Handeln,
Zu- und Abreisen
ist das Zeichen einer Welt,
die nicht klar sieht.
Vor meinem Fenster,
− sagt der Weise, −
liegt ein Tal,
darin sammeln sich die Schatten,
zwei Pappeln säumen einen Weg,
du weißt, − wohin.
Perspektivismus
ist ein anderes Wort für seine Statik:
Linien anlegen,
sie weiterführen
nach Rankengesetz, −
Ranken sprühen, −
auch Schwärme, Krähen,
auswerfen in Winterrot von Frühhimmeln,
dann sinkenlassen −,
Du weißt − für wen. [1943]10
Gottfried Benns späte Gedichte kreisen nicht um den Tod, sondern um das
Nichts – obwohl dieses selbst selten genannt wird. Nur vor diesem Hinter-
grund sind die vielfältigen Realien und Ideen, Alltägliches und Abendlän-
disches, Symbolisches ebenso wie Banales, thematisierbar: „Perspektivismus“
entsteht, indem alles was ist, auch anders sein oder nicht sein könnte. Die Kunst
lebt nun von dieser Fähigkeit zur Negation − das umschreiben die ersten beiden
Verse −, denn nur so erhält das Zusammenführen des Heterogenen, der „Benn-
Ton“, Ausdrucks- und Erkenntniswert: „Linien anlegen, / sie weiterführen /
nach Rankengesetz, − / R a n k e n s p r ü h e n .“ Benns Form ist dann vielleicht
der sich aufhebender Magnetfelder vergleichbar, „Statik“ hieße „Nullpunkt
vielfältiger Dynamik“, und insbesondere vermag so das an den Widersprüchen
10 Gottfried Benn, Gesammelte Werke, Bd. 1, S. 236; wirksam rezipiert wurden diese Gedicht
freilich erst in den 50er und frühen 60er Jahren, der so genannten lyrischen „Benn-Zeit“.Bert Brechts Lyrik und die Tradition der Moderne 53
der Zeit leidende „späte Ich“, das „verlorene“ aber auch „gezeichnete“, also
stigmatisierte Ich aus der Kraft zur Negation heraus sein Selbstbewusstsein zu
erhalten:
Durch soviel Formen geschritten
durch Ich und Wir und Du
[. . .]
es gibt nur zwei Dinge: die Leere
und das gezeichnete Ich.11
Wie auch immer, für Brecht – dieser Gegensatz bleibt natürlich relevant – ist
die bloße Künstlerexistenz, die als solche angenommen wird, angenommen
ohne Illusionen über die Realität, nicht genug. Aber wenn für ihn, das ist sein
Credo seit langem, Kunst Teil allgemeiner, realitätsverändernder Praxis ist,
dann ist auch für ihn das Einkalkulieren des Nichts Teil seiner poetischen und
politischen Strategie:
[. . .]
Wenn die Irrtümer verbraucht sind
Sitzt als letzter Gesellschafter
Uns das Nichts gegenüber.
(426/13.189)
Das ist so lakonisch allgemein formuliert, dass es für Brecht genauso hart gilt
wie für Benn oder, neben vielen anderen, etwa schon für Baudelaire („je
cherche le vide le noir et le nu“).12 Weitergedacht heißt das: Alles, was wir
behaupten und für wahr halten, also dann z. B. durchaus auch der Sozialismus,
so wie wir ihn bis jetzt kennen und erfassen, gilt unter der Voraussetzung seiner
Negierbarkeit; es könnte sich als Irrtum erweisen; also nur wenn wir diesen
Gedanken zulassen, aber freilich nicht aus ihm allein, gewinnen wir eine
notwendige Dimension dafür, sinnvoll für die Wahrheit, auch die des Sozia-
lismus zu arbeiten.
Geh ich zeitig in die Leere
Komm ich aus der Leere voll.
Wenn ich mit dem Nichts verkehre
Weiß ich wieder, was ich soll.
(1125/15.223)
11 Ebd., S. 342, vgl. S. 215 oder S. 231 („Noch einmal so sein“) oder S. 345 („Die vielen Dinge“).
12 (Ich suche das Leere, das Schwarze und das Nackte) Charles Baudelaire, Oeuvres complètes.
Hrsg. von C. Pichois, Éditions de la Pléiade, Paris 1975, S. 75 (Das Gedicht Obsession gilt als
Kontrapunkt zum programmatischen Communications). Sofern nichts anderes vermerkt ist,
stammen alle Übersetzungen von mir.Sie können auch lesen