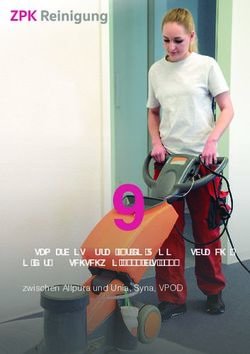Biologische Risiken und Gefahren - CUSSTR
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Kapitel 12: Biologische Risiken und Gefahren
Einleitung
Biologische Risiken und Gefahren ergeben sich aus dem Umgang mit biologischen Organis-
men oder mit Mikroorganismen. Mikroorganismen weisen sehr unterschiedliche Pathogenitä-
ten und Virulenzen auf und können daher bei Menschen, Tieren und Pflanzen Unannehmlich-
keiten und schwere oder sogar tödliche Krankheiten verursachen. Einige Mikroorganismen
können auch irreversible Veränderungen in der Umwelt bewirken. Die Organismen können
durch Mikroorganismen kontaminiert sein, von denen einige für Mensch und Tier potenziell
pathogen sind.
Die jüngsten Ereignisse mit SARS, Vogelgrippe, Milzbrand und der Gefahr von Bioterroris-
mus haben die Behörden vorsichtiger gemacht, und die Kontrollen in den Instituten, die mit
potenziell gefährlichen Mikroorganismen arbeiten, wurden verstärkt.
Kontaminations- und Infektionsmöglichkeiten
Mikroorganismen können einen Organismus, namentlich den menschlichen Körper, über ver-
schiedene Wege befallen, und zwar über Mund, Nase, Ohren, Augen, Schnitt- und Brand-
wunden.
Sie können sich auch an der Hautoberfläche oder in den Schleimhäuten (HNO-Bereich, Geni-
talbereich) entwickeln.
Befall und Infektionen können auf verschiedene Weisen erfolgen:
• über die Verdauungswege (d.h. durch Einnahme, es ist daher verboten zu trinken, zu es-
sen, zu rauchen, mit dem Mund zu pipettieren)
• über die Haut oder die Augen (z.B. durch Absorption durch die Haut oder Spritzen in die
Augen
• über die Atemwege (z.B. durch Inhalation von Aerosolen, die während der Arbeit entste-
hen)
• über den transkutanen Weg (über Biss-, Schnitt- oder Stichwunden)
Alle diese Wege kommen auch in Frage, wenn man mit einem kontaminierten Gegenstand,
der es eigentlich nicht sein sollte, in Berührung kommt: Türgriffe, Fenstergriffe, Kühl-
schrankgriffe, Schubladengriffe, Telefonhörer, verschiedene Dokumente, Wasserhahn, Werk-
zeuge und Instrumente usw.
Nach einem Kontakt mit Allergenen (Sporen, Tierhaare, verschmutztes Streu, Pflanzen, Pol-
len usw.) kann es auch zu Allergien kommen.
Aus diesen Gründen sind beim Umgang mit Mikroorganismen einige Vorsichtsmassnahmen
angezeigt oder sogar zwingend (vgl. Gute Laborpraxis).
CUSSTR / August 2005 – Es gilt die aktualisierte Internetversion. 2Kapitel 12: Biologische Risiken und Gefahren
Bakterienkultur:
Flüssige Kultur und Kultur in Petrischale Inkubator – Rührwerk für flüssige Kulturen
Definitionen
Begriffserläuterungen im Sinne der verschiedenen Verordnungen im Zusammenhang mit der
biologischen Sicherheit:
a. Organismen: Zelluläre oder nichtzelluläre biologische Einheiten, die fähig sind, sich zu
vermehren oder genetisches Material zu übertragen, insbesondere Tiere, Pflanzen und
Mikroorganismen; ihnen gleichgestellt sind Gemische und Gegenstände, die solche Ein-
heiten enthalten.
b. Mikroorganismen: Zelluläre oder nichtzelluläre mikrobiologische Einheiten, die fähig
sind, sich zu vermehren oder genetisches Material zu übertragen, insbesondere Bakterien,
Algen, Pilze, Protozoen, Viren und Viroide; ihnen gleichgestellt sind Gemische und Ge-
genstände, die solche Einheiten enthalten, sowie Zellkulturen, Humanparasiten, Prionen
und biologisch aktives genetisches Material.
c. Gentechnisch veränderte Mikroorganismen: Mikroorganismen, deren genetisches Mate-
rial durch gentechnische Verfahren nach Anhang 1 (SAMV) so verändert worden ist, wie
dies unter natürlichen Bedingungen durch Kreuzen oder natürliche Rekombination nicht
vorkommt.
d. Geschlossenes System: Einrichtung, die durch physikalische Schranken oder durch eine
Kombination physikalischer mit chemischen oder biologischen Schranken den Kontakt
der Mikroorganismen mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern begrenzt oder ver-
hindert.
CUSSTR / August 2005 – Es gilt die aktualisierte Internetversion. 3Kapitel 12: Biologische Risiken und Gefahren
e. Umgang: Jede beabsichtigte Tätigkeit mit Mikroorganismen, insbesondere das Verwen-
den, Verarbeiten, Vermehren, Verändern, Nachweisen, Transportieren, Lagern oder Ent-
sorgen.
f. Umgang mit Organismen in der Umwelt: Jede beabsichtigte Tätigkeit mit Organismen,
bei der bestimmungsgemäss oder üblicherweise Organismen in die Umwelt gelangen,
insbesondere das Verwenden, Verarbeiten, Vermehren, Verändern, Durchführen von
Freisetzungsversuchen, Inverkehrbringen, Transportieren, Lagern oder Entsorgen.
g. Exposition: Jede Situation, in welcher ein Kontakt mit Mikroorganismen möglich ist, der
die Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gefährden kann.
h. Inverkehrbringen: Jede Abgabe von Organismen an Dritte im Inland für den Umgang in
der Umwelt, insbesondere das Verkaufen, Tauschen, Schenken, Vermieten, Verleihen
und Zusenden zur Ansicht, sowie die Einfuhr für den Umgang in der Umwelt; nicht als
Inverkehrbringen gilt die Abgabe zur Durchführung von Freisetzungsversuchen.
Tiere: Tierseuchen
Tierseuchengesetz (TSG) vom 1. Juli 1966 (Stand am 29. Juni 2004) (SR 916.40): Art. 1
1. Tierseuchen im Sinne des vorliegenden Gesetzes sind die übertragbaren Tierkrankheiten,
die:
a. auf den Menschen übertragen werden können (Zoonosen);
b. vom einzelnen Tierhalter ohne Einbezug weiterer Tierbestände nicht mit Aussicht auf
Erfolg abgewehrt werden können;
c. einheimische, wild lebende Tierarten bedrohen können;
d. bedeutsame wirtschaftliche Folgen haben können;
e. für den internationalen Handel mit Tieren und tierischen Produkten von Bedeutung
sind.
2. Der Bundesrat bezeichnet die einzelnen Tierseuchen. Er unterscheidet dabei hochanste-
ckende Seuchen (Liste A des Internationalen Tierseuchenamtes) und andere Seuchen. Als
hochansteckend gelten Seuchen von besonderer Schwere hinsichtlich:
a. der schnellen Ausbreitung, auch über die Landesgrenzen hinaus;
b. der gesundheitlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen;
c. der Auswirkungen auf den innerstaatlichen oder internationalen Handel mit Tieren
und tierischen Produkten.
CUSSTR / August 2005 – Es gilt die aktualisierte Internetversion. 4Kapitel 12: Biologische Risiken und Gefahren
Rechtsgrundlagen
Wichtigste gesetzliche Grundlagen
ESV: Verordnung vom 25. August 1999 über den Umgang mit Organismen in geschlossenen
Systemen (Einschliessungsverordnung, ESV) (SR 814.912) (Stand vom 23. November 1999)
SAMV: Verordnung vom 25. August 1999 über den Schutz der Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer vor Gefährdung durch Mikroorganismen (SR 832.321) (Stand vom 23. November
1999)
GTG: Bundesgesetz vom 21. März 2003 über die Gentechnik im Ausserhumanbereich (Gen-
technikgesetz) (SR 814.91)
Epidemiengesetz: Bundesgesetz vom 18. Dezember 1970 über die Bekämpfung übertragba-
rer Krankheiten des Menschen (SR 818.101) (Stand vom 2. August 2000)
FrSV: Verordnung vom 25. August 1999 über den Umgang mit Organismen in der Umwelt
(Freisetzungsverordnung,) (SR 814.911) (Stand vom 22. Dezember 2003)
StFV: Verordnung vom 27. Februar 1991 über den Schutz vor Störfällen (Störfallverord-
nung,) (SR 814.012) (Stand vom 28. März 2000)
CartV: Verordnung vom 3. November 2004 über den grenzüberschreitenden Verkehr mit
gentechnisch veränderten Organismen (Cartagena-Verordnung,) (SR 814.912.21)
Sicherheitsvorschriften und -massnahmen
Um das Personal und andere Personen vor allfälligen Erkrankungen sowie um die Umwelt
zu schützen, ist es angezeigt, biologische und gentechnisch veränderte Krankheitserreger
einzuschliessen.
Allgemeine Sicherheitsmassnahmen (Art. 10 ESV)
1. Wer mit gentechnisch veränderten oder pathogenen Organismen in geschlossenen Syste-
men umgeht, muss zum Schutz von Mensch und Umwelt die in Anhang 4 (ESV) aufge-
führten allgemeinen Sicherheitsmassnahmen sowie die nach Art der Anlage und Klasse
der Tätigkeit erforderlichen zusätzlichen Sicherheitsmassnahmen ergreifen.
2. Einzelne der in Anhang 4 (ESV) aufgeführten zusätzlichen Sicherheitsmassnahmen kön-
nen geändert, ersetzt oder weggelassen werden, wenn
O nachgewiesen wird, dass bei einer bestimmten Tätigkeit der Schutz von Mensch und
Umwelt trotzdem gewährleistet ist und
O das zuständige Bundesamt die Abweichungen bewilligt hat.
CUSSTR / August 2005 – Es gilt die aktualisierte Internetversion. 5Kapitel 12: Biologische Risiken und Gefahren Anforderungen an den Umgang mit Organismen in geschlossenen Systemen Sorgfaltspflicht (Art. 4 ESV und FrSV) 1 Wer mit Organismen in geschlossenen Systemen umgeht, muss jede nach den Umständen gebotene Sorgfalt anwenden, damit die Organismen, ihre Stoffwechselprodukte und Abfälle den Menschen und die Umwelt nicht gefährden können. 2 Insbesondere sind die entsprechenden Vorschriften sowie die Anweisungen und Empfehlun- gen der Abgeberinnen und Abgeber zu befolgen. Pflicht zum Umgang in geschlossenen Systemen (Art. 5 ESV) 1 Der Umgang mit gentechnisch veränderten oder pathogenen Organismen muss in geschlos- senen Systemen erfolgen, ausser wenn mit solchen Organismen nach der Freisetzungsverord- nung vom 25. August 1999 in der Umwelt umgegangen werden darf. 2 Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) kann vorschreiben, dass diese Verordnung oder einzelne ihrer Bestimmungen für weitere Organismen, die auf Grund ihrer Eigenschaften, ihrer Verwendungsart oder Verbrauchsmenge die Umwelt oder mittelbar den Menschen gefährden können, gilt. Insbe- sondere kann es vorschreiben: a. welcher Gruppe diese Organismen zuzuordnen sind; b. welche Sicherheitsmassnahmen und anderen Anforderungen für den Umgang mit diesen Organismen erfüllt werden müssen Bundesbewilligungen im Bereich der Biosicherheit Aufzeichnungs-, Melde- und Bewilligungspflicht (Art. 9 ESV) 1 Wer mit gentechnisch veränderten oder pathogenen Organismen umgeht, muss die Angaben nach Anhang 3: a. aufzeichnen und nach Abschluss der Tätigkeit noch während fünf Jahren aufbewahren oder aufbewahren lassen; b. auf Anfrage den Vollzugsbehörden zur Verfügung stellen. 2 Wer mit gentechnisch veränderten Organismen umgeht, muss: a. jede erstmalige Tätigkeit der Klasse 1 melden; b. jede Tätigkeit der Klasse 2 melden; c. jede Tätigkeit der Klasse 3 oder 4 bewilligen lassen. 3 Wer mit pathogenen, nicht gentechnisch veränderten Organismen umgeht, muss: a. jede erstmalige Tätigkeit der Klasse 2 melden; b. jede Tätigkeit der Klasse 3 oder 4 bewilligen lassen; besteht die Tätigkeit im Analysieren von klinischem Material (medizinisch-mikrobiologische Diagnostik) und ist sie nicht mit Forschung verbunden, so genügt eine Bewilligung der erstmaligen Tätigkeit. 4 Dabei gilt als erstmalige Tätigkeit: a. die erstmalige Tätigkeit in einer bestimmten Anlage; b. jede Tätigkeit, die im Vergleich zu einer bereits gemeldeten Tätigkeit das Risiko für den Menschen und die Umwelt wesentlich verändert, insbesondere wenn ein Organismus mit wesentlich anderen Eigenschaften verwendet wird. CUSSTR / August 2005 – Es gilt die aktualisierte Internetversion. 6
Kapitel 12: Biologische Risiken und Gefahren 5 Eine gemeldete Tätigkeit darf sofort aufgenommen werden, ausser wenn es sich um eine erstmalige Tätigkeit der Klasse 2 handelt. Eine solche darf erst aufgenommen werden, wenn das zuständige Bundesamt (Art. 16): a. innerhalb von 45 Tagen nach Einreichung der Meldung keine Einwände erhebt oder b. bereits früher mitteilt, dass keine Einwände vorliegen. 6 Die Meldungen und Bewilligungsgesuche sind bei der Kontaktstelle Biotechnologie des Bundes (Art. 15) in der verlangten Anzahl Exemplare einzureichen. [...] Pflanzen: Allgemeine Schutzmassnahmen Artikel 8 der Verordnung vom 5. März 1962 über Pflanzenschutz (Pflanzenschutzverord- nung, PSV) (SR 916.20) (Stand vom 15. Februar 2000):1 1. Das Halten, Verwahren oder Verbreiten von im Inland meldepflichtigen Schädlingen und Erregern von Pflanzenkrankheiten in allen ihren Formen und Stadien ist verboten (Schäd- lingsliste vgl. Anhang I). 2. Verboten ist auch das Halten oder Vermehren von Pflanzen oder Pflanzenteilen, die von den genannten Schädlingen und Krankheiten befallen sind. Verseuchte oder verdächtige Ware (Pflanzen, Pflanzenteile oder Pflanzenerzeugnisse) darf weder eingelagert noch in Verkehr gebracht werden. 3. Das Bundesamt für Landwirtschaft kann für die wissenschaftliche Forschung Ausnahmen bewilligen und diese an Bedingungen und Auflagen knüpfen. Vgl. auch Verordnung vom 25. Januar 1982 über die Meldung von gemeingefährlichen Schädlingen und Krank- heiten (SR 916.201) (Stand vom 26. Januar 1999).2 1 Anm. d. Übers.: Aufgehoben. 2 Anm. d. Übers.: Aufgehoben. CUSSTR / August 2005 – Es gilt die aktualisierte Internetversion. 7
Kapitel 12: Biologische Risiken und Gefahren Verantwortung für die biologische Sicherheit Anhang 4 der ESV, der sich auf Artikel 10 bezieht, verankert namentlich die Verpflichtung für jeden Betrieb, der gentechnisch veränderte oder pathogene Organismen verwendet, min- destens eine Person, die für die Überwachung der biologischen Sicherheit verantwortlich ist, anzustellen; diese Person (Biosicherheitsverantwortlicher, Biosafety Officer, BSO) muss so- wohl in fachlicher Hinsicht als auch in Sicherheitsfragen über ausreichende Kenntnisse zur Erfüllung ihrer Aufgabe verfügen. Aufgaben der Betriebsleitung Das Unternehmen muss eine für die biologische Sicherheit verantwortliche Person anstellen, deren Pflichtenheft erarbeiten, ihre Stellung innerhalb des Betriebs festlegen, ihr die zur Er- füllung ihrer Aufgabe nötigen Ressourcen zur Verfügung stellen (Zeit, Budget usw.) und sie gegebenenfalls von anderen Aufgaben entlasten. Qualifikationen und Ausbildung der für die Biosicherheit verantwortlichen Person Die/der Biosicherheitsverantwortliche muss über folgende Qualifikationen verfügen: - Kenntnisse der guten mikrobiologischen Praxis, Erfahrungen mit den molekularbiologi- schen Techniken (wenn für das Unternehmen wichtig) - Universitäts- oder Hochschulabschluss oder mehrere Jahre Laborerfahrung - spezifische Kenntnisse im Bereich der den Bedürfnissen des Unternehmens angepassten Biosicherheit Die für die Biosicherheit verantwortliche Person muss den von den zuständigen Bundesstellen durchgeführten Grundausbildungskurs für Biosicherheitsverantwortliche besucht haben. Sie muss ihre Kenntnisse und ihr Wissen auf den spezifischen Gebieten der Biosicherheit, die ihr Unternehmen betreffen, regelmässig vertiefen. Aufgaben des Biosicherheitsverantwortlichen (BSO) (unvollständige Aufzählung) Die für die Biosicherheit verantwortliche Person muss: - eine interne Struktur aufbauen, die Biosicherheitsverantwortliche pro Abteilung oder For- schungsgruppe umfasst - ein Programm ausarbeiten, das Regeln, Verfahren und spezifische Massnahmen umfasst, die im Unternehmen umzusetzen sind, um die biologische Sicherheit zu gewährleisten - die Verantwortlichkeiten im Zusammenhang mit diesen Regeln, Verfahren und Massnah- men festlegen - das Sicherheitsprogramm regelmässig aktualisieren - das Sicherheitsprogramm der Direktion zur Genehmigung und Inkraftsetzung vorlegen - das Sicherheitsprogramm mit denjenigen Programmen koordinieren, die in anderen Berei- chen zur Anwendung kommen (Chemie, Strahlenschutz, Brandbekämpfung, Arbeitsmedi- zin, Transportwesen usw.) - die für das Unternehmen geltenden Regeln, Verfahren und Massnahmen den verschiede- nen Situationen anpassen: Art der verwendeten Organismen, Art der ausgeführten Tätig- keiten, Risikoklasse. Die Methoden und Räumlichkeiten müssen diesen Situationen ange- passt sein. CUSSTR / August 2005 – Es gilt die aktualisierte Internetversion. 8
Kapitel 12: Biologische Risiken und Gefahren
Der oder die BSO muss insbesondere:
1. das Personal informieren und sensibilisieren
2. Weisungen aufstellen
3. periodisch Weiterbildungen organisieren
4. für alles, was Eröffnungen, Mitteilungen, Bewilligungsgesuche, Sicherheitsmassnahmen
usw. betrifft, den Kontakt zu den Behörden sicherstellen
5. die Forschungsverantwortlichen in allem unterstützen, was die Risikobeurteilung, die
Klassierung der Tätigkeiten, die Wahl und die Umsetzung der tätigkeitsbezogenen Si-
cherheitsmassnahmen betrifft, und die Umsetzung dieser Massnahmen kontrollieren und
gegebenenfalls korrigieren
6. wenn nötig, den Unterhalt und die Dekontaminierung der Apparate und Anlagen, welche
die Biosicherheit beeinträchtigen könnten, kontrollieren
7. die nötigen Sicherheitsmassnahmen für Bauarbeiten, Umbauten und Umzüge definieren,
wenn die Biosicherheit garantiert werden muss
EU-Recht
Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. März 2001 über die ab-
sichtliche Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die Umwelt und zur Aufhebung der Richt-
linie 90/220/EWG des Rates
Richtlinie 2000/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. September 2000 über den
Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit
Richtlinie 90/679/EWG des Rates vom 26. November 1990 über den Schutz der Arbeitnehmer gegen
Gefährdung durch biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit sowie Änderung dieser Richtlinie vom
12.10.1993 (93/88/EWG)
Richtlinie 90/219/EWG des Rates vom 23. April 1990 über die Anwendung genetisch veränderter
Mikroorganismen in geschlossenen Systemen
Internationales Protokoll über die biologische Sicherheit
(Cartagena-Protokoll)
Das Protokoll von Cartagena befasst sich mit der biologischen Sicherheit im Zusammenhang
mit dem Übereinkommen über die biologische Vielfalt. Das am 11. September 2003 in Kraft
getretene Protokoll ist das erste völkerrechtlich verbindliche Übereinkommen über den grenz-
überschreitenden Transport, die Handhabung und den Umgang mit gentechnisch veränderten
Organismen (GVO). Es soll ein angemessenes Schutzniveau sicherstellen, um nachteilige
Auswirkungen auf die Bewahrung und nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt zu ver-
meiden. Dabei wird auch die menschliche Gesundheit berücksichtigt. Ein Schwerpunkt ist vor
allem der grenzüberschreitende Verkehr.
Das Protokoll kann auf der folgenden Internetadresse eingesehen werden: http://biodiv.org/biosafety/
CUSSTR / August 2005 – Es gilt die aktualisierte Internetversion. 9Kapitel 12: Biologische Risiken und Gefahren
Hauptgefahren
Anforderungen an den Umgang mit gentechnisch veränder-
ten oder pathogenen Organismen
Risikobewertung (Art. 8 ESV)
1. Wer mit gentechnisch veränderten oder pathogenen Organismen in geschlossenen Syste-
men umgeht, muss vorher die möglichen Schäden für den Menschen und die Umwelt, das
Ausmass der Schäden sowie die Wahrscheinlichkeit, mit der diese eintreten, bewerten
(Risikobewertung). Mögliche Schäden sind insbesondere:
a. Krankheiten bei Menschen, Tieren oder Pflanzen;
b. lästige oder schädliche Einwirkungen infolge Ansiedlung oder Verbreitung der Orga-
nismen in der Umwelt;
c. lästige oder schädliche Einwirkungen infolge natürlicher Übertragung von Genen auf
andere Organismen.
2. Die Risikobewertung umfasst:
a. die Zuordnung der verwendeten Organismen zu den Gruppen anhand der Liste nach
Artikel 22 oder auf Grund eigener Abklärungen nach den Kriterien von Anhang 2.1;
b. die Abklärung, ob die verwendete Kombination von Empfängerorganismen und Vek-
toren in der Liste der biologischen Sicherheitssysteme (Art. 22) aufgeführt ist und
c. die Beurteilung der vorgesehenen Tätigkeit nach den Kriterien von Anhang 2.3 und ih-
re Zuordnung zu einer Klasse.
3. Das Risiko ist neu zu bewerten, wenn die Tätigkeit wesentlich ändert oder wesentliche
neue Erkenntnisse vorliegen.
4. Handelt es sich um eine Tätigkeit, bei der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Mikro-
organismen ausgesetzt sein können, so kann die Risikobewertung nach dieser Verord-
nung mit der Risikobewertung nach den Artikeln 5–7 der Verordnung vom 25. August
1999 (SAMV) über den Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor Gefähr-
dung durch Mikroorganismen kombiniert werden
CUSSTR / August 2005 – Es gilt die aktualisierte Internetversion. 10Kapitel 12: Biologische Risiken und Gefahren
Risikogruppen und Tätigkeitsklassen
Gruppen von Mikroorganismen (Art. 3 SAMV 3) (vgl. Tabelle am Ende des Kapitels)
1. Die Mikroorganismen werden in vier Gruppen eingeteilt. Massgeblich für die Einteilung
ist das Risiko, das sie nach dem Stand der Wissenschaft aufweisen, d. h. die schädigen-
den Eigenschaften, insbesondere die Pathogenität für Menschen, und die Wahrschein-
lichkeit, dass diese Eigenschaften zur Wirkung kommen.
2. Die Gruppen werden wie folgt umschrieben:
a. Gruppe 1: Mikroorganismen, die kein oder ein vernachlässigbar kleines Risiko auf-
weisen;
b. Gruppe 2: Mikroorganismen, die ein geringes Risiko aufweisen;
c. Gruppe 3: Mikroorganismen, die ein mässiges Risiko aufweisen;
d. Gruppe 4: Mikroorganismen, die ein hohes Risiko aufweisen.
Vgl. auch Art. 6 der Verordnung über den Umgang mit Organismen in geschlossenen Systemen (Einschlies-
sungsverordnung, ESV)
Liste der eingeteilten Mikroorganismen und der biologischen Sicherheitssysteme (Art. 4
Abs. 1 SAMV)
Das Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) führt öffentlich zugängliche
Listen, in denen die Mikroorganismen in eine der vier Gruppen eingeteilt und die biologi-
schen Sicherheitssysteme aufgeführt sind.
Diese Listen können auf folgender Internetadresse eingesehen und heruntergeladen werden:
http://www.bag.admin.ch/themen/d/index.htm
Klassen von Tätigkeiten (Art. 7 ESV)
1. Die Tätigkeiten mit Organismen in geschlossenen Systemen werden nach ihrem Risiko
für den Menschen und die Umwelt in vier Klassen eingeteilt.
2. Die Klassen werden wie folgt umschrieben:
a. Klasse 1: Tätigkeit, bei der kein oder ein vernachlässigbar kleines Risiko besteht;
b. Klasse 2: Tätigkeit, bei der ein geringes Risiko besteht;
c. Klasse 3: Tätigkeit, bei der ein mässiges Risiko besteht;
d. Klasse 4: Tätigkeit, bei der ein hohes Risiko besteht.
Diese Klassierungen erfolgen aufgrund verschiedener Kriterien:
§ Möglichkeit einer Infektion beim Menschen im Anschluss an eine Kontamination und
ausreichende Anzahl von Keimen, um die Infektion zu verursachen
§ Biologische Stabilität des Mikroorganismus in der Umgebung
§ Übertragungsart des Krankheitserregers
§ Immunitätszustand der Bevölkerung (d.h. Prozentsatz der bereits infizierten Bevölke-
rung)
§ Risiko für die Gesundheit des Einzelnen sowie Gefahr für die Gesamtheit
§ Möglichkeit einer Behandlung oder Bestehen einer Schutzimpfung
Vgl. auch Art. 7 und 8 ESV
CUSSTR / August 2005 – Es gilt die aktualisierte Internetversion. 11Kapitel 12: Biologische Risiken und Gefahren Wechsel der Tätigkeitsklasse Jede Kategorie entspricht einer Biosicherheitsstufe (Biosafety Level, BSL), einem bestimm- ten Einschliessungsniveau, einer bestimmten Anzahl Massnahmen im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Mikroorganismen. Es ist darauf zu achten, dass es nicht zu Verwechslun- gen zwischen Risikogruppe und Tätigkeitsklasse kommt: Ein Mikroorganismus der Gruppe 2 kann je nach Umgang beispielsweise zur Tätigkeitsklasse 3 gehören (vgl. Art. 8 ESV oder SAMV). Umgang mit unbekannten Mikroorganismen Bei der Isolierung unbekannter Mikroorganismen vom Patienten oder von einer natürlichen Umgebung aus besteht immer das Risiko, dass der Laborant mit Erregern in Kontakt kommt. Es müssen somit alle Vorsichtsmassnahmen getroffen werden, um ihn und seine Arbeitskol- leginnen und Arbeitskollegen zu schützen. Pflanzen Für die Pflanzen und somit für die Umwelt besteht das Hauptrisiko bei der Arbeit mit Pflan- zenpathogenen und/oder GVO darin, dass Krankheiten oder neue Gene freigesetzt werden können. Das Risiko für den Menschen ist vor allem eine Pollenallergie. Durch den direkten Kontakt mit gewissen Pflanzen besteht auch das Risiko von Vergiftungen, Allergien oder Schädigungen von Haut und Schleimhäuten. Bei Fragen: http://www.toxi.ch/ger/welcome.html Tiere Organismen, z.B. von wilden Tieren, können von Parasiten, Viren, Bakterien, Rickettsien oder Pilzen befallen sein, die den Laboranten beeinträchtigen können. Eine Übertragung kann durch Einnahme, Bisse, Stiche, Kratzer, bei direktem Hautkontakt, über die Schleimhäute (Augen, Nasenschleimhaut) usw. erfolgen. Es müssen somit alle Vorsichtsmassnahmen getroffen werden, um die Laborantin oder den Laboranten sowie ihre Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen zu schützen. Tiertechniker werden für den korrekten Umgang mit Tieren und in Bezug auf die gebräuchli- chen Vorsichtsmassnahmen geschult. Vgl. auch Tierseuchenverordnung (TSV) vom 27. Juni 1995 (Stand vom 15. Mai 2001) (SR 916.40). Vgl. auch Home-Page des CNRS: - bezüglich Tierexperimente: http://www.cnrs.fr/SDV/Dept/expanim.html - bezüglich auf Menschen übertragbare Zoonosen: http://www.cnrs.fr/SDV/Dept/zoonosescom.html CUSSTR / August 2005 – Es gilt die aktualisierte Internetversion. 12
Kapitel 12: Biologische Risiken und Gefahren
Allgemeine Weisungen
Allgemeine Sicherheitsmassnahmen
Allgemeine Sicherheitsmassnahmen (Art. 8 SAMV)
1. Der Arbeitgeber muss zum Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor Gefähr-
dung ihrer Sicherheit und Gesundheit durch Mikroorganismen alle Massnahmen treffen,
die nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und den ge-
gebenen Verhältnissen angemessen sind.
2. Der Arbeitgeber ist insbesondere verpflichtet:
a. die Mikroorganismen auszuwählen, die das kleinste Gefährdungspotenzial aufwei-
sen;
b. dafür zu sorgen, dass möglichst wenige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Um-
gang mit Mikroorganismen haben oder Mikroorganismen ausgesetzt sind;
c. Arbeitsverfahren und technische Massnahmen so zu gestalten, dass die Ausbreitung
von Mikroorganismen am Arbeitsplatz möglichst vermieden wird;
d. die Verfahren für die Entnahme, die Handhabung und die Verarbeitung von Proben
menschlichen oder tierischen Ursprungs festzulegen;
e. Vorkehren für die Schadensbewältigung und -begrenzung bei Unfällen oder Zwi-
schenfällen mit Mikroorganismen zu treffen;
f. Abfälle so zu sammeln, zu lagern und zu beseitigen, dass die Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer nicht gefährdet werden.
3. Der Arbeitgeber muss kollektive oder, wo dies nicht oder nur teilweise möglich ist, indi-
viduelle Schutzmassnahmen treffen. Insbesondere muss er dafür sorgen, dass:
a. den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern geeignete Schutzausrüstung und Schutz-
kleidung zur Verfügung steht;
b. die notwendigen Schutzausrüstungen sachgerecht aufbewahrt, nach Möglichkeit vor
Gebrauch, auf jeden Fall aber nach Gebrauch überprüft und gereinigt werden und vor
erneutem Gebrauch nötigenfalls in Stand gestellt oder ersetzt werden;
c. Arbeitskleider und persönliche Schutzausrüstungen, die möglicherweise durch Mik-
roorganismen kontaminiert wurden, beim Verlassen des Arbeitsbereichs abgelegt
und vor Durchführung der Massnahmen nach Buchstabe d getrennt von anderen
Kleidungsstücken aufbewahrt werden;
d. die möglicherweise durch Mikroorganismen kontaminierten Kleider und persönli-
chen Schutzausrüstungen gereinigt und nötigenfalls desinfiziert werden.
4. Der Arbeitgeber muss durch Hygienemassnahmen dafür sorgen, dass Mikroorganismen
weder die betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gefährden noch auf Perso-
nen ausserhalb des Arbeitsplatzes übertragen werden. Er muss zudem dafür sorgen, dass
den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern geeignete Waschanlagen zur Verfügung ste-
hen, in denen die erforderlichen Wasch- und Dekontaminationsmittel vorhanden sind.
5. Überdies muss er für Räume, in denen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die
Gefahr einer Kontamination durch pathogene Mikroorganismen besteht, ein Ess-, Trink-,
Rauch-, Schnupf- und Schminkverbot aussprechen sowie durchsetzen. In solchen Räu-
men dürfen auch keine Nahrungsmittel aufbewahrt werden.
CUSSTR / August 2005 – Es gilt die aktualisierte Internetversion. 13Kapitel 12: Biologische Risiken und Gefahren
Präventivmassnahmen
Zur Eingrenzung von Unfallrisiken können bestimmte Massnahmen getroffen werden:
1. Ausbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Theorie (Grundkenntnisse im Bereich
der Biosicherheit) und Praxis (Gute Laborpraxis); diese Ausbildung muss aktualisiert und
aufgefrischt werden
2. Installation angemessener technischer Anlagen und Geräte (z.B. mikrobiologische Si-
cherheitswerkbank der Klasse II oder je nach Bedarf der Klasse III)
3. Einrichten geschlossener Räumlichkeiten.
4. Abgabe geeigneter Schutzkleidung (z.B. Kittel, Handschuhe, Brillen usw.)
5. Medizinische Präventionsmassnahmen (Eignungsuntersuchung, Impfung, ärztliche Auf-
sicht usw.)
6. Ausarbeiten eines Wartungsplans für die Apparate und Anlagen sowie eines Programms
über die Reinigung und Desinfektion der Räumlichkeiten und Arbeitsplätze.
CUSSTR / August 2005 – Es gilt die aktualisierte Internetversion. 14Kapitel 12: Biologische Risiken und Gefahren
Gute Laborpraxis
Zu jeder Risikokategorie gehören einige Vorsichtsmassnahmen, die getroffen werden
müssen.
Allgemeine Sicherheitsmassnahmen (Art. 10 Abs. 2 ESV und Tab. 1 bis 4 im Anhang zur ESV)
1. Zusätzlich zu den allgemeinen Sicherheitsmassnahmen sind, je nach Art der Anlage und
Klasse der Tätigkeit, Massnahmen der Sicherheitsstufen 1 bis 4 zu ergreifen:
Nach Tabelle Nr. Art der Anlage, in der die Tätigkeiten ausgeführt werden:
1 Forschungs- und Entwicklungslaboratorien, Analysen von klinischem
Material
2 Anzuchträume und Gewächshäuser
3 Anlagen mit Tieren
4 Produktionsanlagen
2. Die einzelnen Sicherheitsmassnahmen müssen dem Stand der Sicherheitstechnik entspre-
chen.
Auszug aus Tabelle 1: Zusätzliche Sicherheitsmassnahmen für Tätigkeiten in Forschungs-
und Entwicklungslaboratorien sowie für Analysen von klinischem Material:
Sicherheitsmassnahmen Sicherheitsstufe
1 2 3
Gebäude
Arbeitsbereich abgetrennt -- -- +
Arbeitsbereich so abgedichtet, dass Begasung -- -- (+)
möglich ist
Warnzeichen Biogefährdung -- + +
Zugang zum Arbeitsbereich eingeschränkt -- + +
Zugang zum Arbeitsbereich über Schleuse -- -- +
Sichtfenster oder andere Vorrichtung zur Beo- -- -- +
bachtung des Arbeitsbereichs
atmosphärischer Unterdruck des Arbeitsbe- -- -- +
reichs gegenüber der unmittelbaren Umgebung
Zu- und Abluft zum Arbeitsbereich HEPA- -- -- +
gefiltert (Abluft)
Ausrüstung
Oberflächen gegen Säuren, Laugen, Lösemittel + + +
und Desinfektionsmittel resistent (Werkbank) (Werkbank) (Werkbank +
Fussboden)
mikrobiologische Sicherheitswerkbank -- (+) +
Massnahmen gegen die Aerosolbildung -- + +
(minimieren) (verhindern)
Autoklav vorhanden -- + +
(im Gebäude) (im Labor)
CUSSTR / August 2005 – Es gilt die aktualisierte Internetversion. 15Kapitel 12: Biologische Risiken und Gefahren
Duschmöglichkeiten -- - (+)
Arbeitsorganisation
besondere Bekleidung für den Arbeitsbereich + + +
(Laborbekleidung) (Laborbekleidung) (Schutzklei-
dung)
Handschuhe -- + +
(wenn Kontakt
unausweichlich)
regelmässige Desinfektion der Arbeitsplätze -- + +
Inaktivierung der Mikroorganismen im Aus- -- -- (+)
guss von Abwaschbecken, Leitungen und Du-
schen
Inaktivierung der Mikroorganismen in konta- -- + +
miniertem Material, Abfall und an kontami- (unschädliche
nierten Geräten Entsorgung)
Für die in dieser Tabelle enthaltenen Pflichten gibt es gewisse Einschränkungen. Nähere Ein-
zelheiten können den Anhängen der ESV und der SAMV entnommen werden.
Klasse 1 = Biosicherheitsstufe 1 = BSL1
1. Die Grundsätze der guten Praxis für mikrobiologische Laboratorien müssen eingehalten
werden.
2. Pipettierung mit dem Mund ist strikt untersagt, mechanische Pipetten benutzen (Saugpi-
petten, Propipetten, automatische Pipetten usw.)
3. Spritzennadeln und Kanülen müssen vorsichtig verwendet werden, um allfällige Unfälle
zu vermeiden. Sie dürfen nur in absolut notwendigen Fällen verwendet werden und müs-
sen wie Sonderabfälle entsorgt werden (scharfe oder schneidende Gegenstände).
4. Die Bildung von Aerosolen muss soweit möglich vermieden werden.
5. Nahrungsmittel, Getränke und Tabak sind in Laboratorien verboten.
6. Die Hände sind vor Arbeitsbeginn und vor Verlassen des Labors zu waschen.
7. Kleidungsstücke (Arbeitskittel) werden ausschliesslich im Labor getragen.
8. Das Labor wird sauber, in Ordnung und ohne Material, das nicht mit der Arbeit in Ver-
bindung steht, gehalten.
9. Die Identität der verwendeten Stämme wird regelmässig kontrolliert, um deren pathoge-
nes Potenzial zu überprüfen.
10. Für weitere Informationen vgl. Handbuch der Eidgenössischen Fachkommission für bio-
logische Sicherheit (EFBS).
CUSSTR / August 2005 – Es gilt die aktualisierte Internetversion. 16Kapitel 12: Biologische Risiken und Gefahren
Klasse 2 = Biosicherheitsstufe 2 = BSL2
Folgende Empfehlungen kommen zu den Empfehlungen der BSL1 hinzu:
1. Arbeitszonen der Klasse 2 müssen mit dem Hinweis «Biohazard» beschildert sein.
2. Der Zugang zum Labor ist den Personen, die vom Projektleiter bestimmt sind, vorbehal-
ten.
3. Türen und Fenster sind während der Arbeit geschlossen zu halten.
4. Folgende Massnahmen sind zu treffen, wenn bei der Arbeit Aerosole freigesetzt werden
können:
- es ist unter einer Abzugshaube zu arbeiten, deren Luftabzug den Nutzer schützt
- die Apparate dürfen keine Aerosole nach aussen freigeben; allfällige Gasentweichun-
gen müssen durch einen HEPA-Filter abgeführt werden.
5. Für die Entnahmen und Transporte sind bruchfeste Behälter zu verwenden. Proben müs-
sen während der Lagerung und des Transports eingeschlossen sein.
6. Die Hände sind nach dem Umgang mit infektiösen Proben und vor Verlassen des Labors
zu waschen. Während der Arbeit sind Handschuhe zu tragen.
7. Die Arbeitsflächen sind nach der Arbeit zu desinfizieren.
8. Geräte, die mit Infektionserregern in Kontakt kommen, sind vor der Reinigung zu desin-
fizieren.
9. Im Falle einer Freisetzung von humanen pathogenen Mikroorganismen ist die kontami-
nierte Zone abzuschliessen und zu entkontaminieren.
10. Es ist besondere Laborschutzkleidung zu tragen (Kittel); diese wird beim Verlassen der
Arbeitszone ausgezogen und an einem von der Alltagskleidung getrennten Ort versorgt.
11. Kontaminierte Flüssigkeiten und feste Abfälle sind so zu behandeln, dass das biologische
Material inaktiviert wird. Die Behandlung kann beispielsweise eine Sterilisation während
20 Minuten bei 121 °C (1,2 bar) sein. Bei sehr stabilen Organismen und bei Sporen er-
folgt die Sterilisation bei 134 °C (1,5 bar).
12. Das Labor wird sauber, in Ordnung und ohne Material, das nicht mit der Arbeit in Ver-
bindung steht, gehalten.
13. Unfälle sind unverzüglich dem Biosicherheitsverantwortlichen (BSO) zu melden, der die
geeigneten Massnahmen treffen wird (z.B. einen Arzt rufen). Es ist ein Protokoll über
den Vorfall zu erstellen.
14. Die Identität der verwendeten Stämme wird regelmässig kontrolliert, um deren pathoge-
nes Potenzial zu überprüfen.
15. Für weitere Informationen vgl. Handbuch der Eidgenössischen Fachkommission für bio-
logische Sicherheit (EFBS).
CUSSTR / August 2005 – Es gilt die aktualisierte Internetversion. 17Kapitel 12: Biologische Risiken und Gefahren
Klasse 3 = Biosicherheitsstufe 3 = BSL3
Folgende Empfehlungen kommen zu denjenigen für die BSL1 und die BSL2 hinzu:
1. Das Laboratorium ist vom Rest des Gebäudes durch einen kontrollierten Zugang (Zugang
nur für berechtigte Personen) mit doppelter Schleuse abgetrennt. Ein System verunmög-
licht das gleichzeitige Öffnen der beiden Türen, ausser im Brandfall.
2. Die Oberflächen der Mauern, Böden und Decken sind glatt und einfach zu reinigen.
3. Die Personen, die in der Sicherheitsstufe 3 arbeiten, müssen durch die Fenster, die sich in
den Trennbereichen der beiden Zonen befinden, gut sichtbar sein.
4. In den Laboratorien, in denen Pathogene manipuliert werden, sowie in den angrenzenden
Lokalen hat ein stabiler Druck zu herrschen (Wassersäule von 6 mm).
5. Die aus dem Labor austretende Luft wird durch einen hoch wirksamen Filter abgeleitet,
der 99,999 Prozent der inerten oder lebenden Partikel mit einem Durchmesser von über
0,3 µm zurückhält, dies gilt auch für Vakuumaustritte.
6. Es besteht weder ein Anschluss an das städtische Gasnetz, noch ein zentralisiertes Vaku-
umsystem.
7. Die Handhabung pathogener Proben hat in Sicherheitshauben der Klasse II zu erfolgen,
wenn Aerosole produziert werden, die ein aerogenes Infektionsrisiko beinhalten.
8. Jegliches kontaminierte Material muss dekontaminiert werden, bevor es den BSL3-
Bereich auf chemischem Weg oder per Autoklav verlässt. Der BSL3-Bereich muss aus-
serdem mit einem Durchreicheautoklav ausgerüstet sein.
9. Ein Programm zur Bekämpfung von Insekten und Nagetieren wird durch das Personal
selbst durchgeführt oder nach Dekontaminierung des Raumes, wenn die Operation durch
Personen durchgeführt wird, die nicht mit pathogenen Keimen arbeiten oder die nicht
ärztlich überwacht sind.
10. Es wird nur Kleidung getragen, die für den BSL3-Bereich bestimmt ist: Hinten zuge-
knöpfte Kittel mit langen Ärmeln, welche die Tageskleidung schützen, am Kittel befes-
tigte Handschuhe, Überschuhe, eventuell Maske und Brille. Diese Schutzkleidungen ver-
lassen den BSL3-Bereich nur, wenn sie vorgängig sterilisiert worden sind.
11. Die Mitglieder des Labors kennen die Risiken im Zusammenhang mit der Arbeit in der
BSL3 sowie das Verhalten im Brandfall.
12. Die Unterlagen, Laborhefte, Notizblöcke usw. sind zu desinfizieren, bevor sie den Raum
verlassen. Am besten bleiben sie im Laboratorium; die Informationen können über Fax
oder über einen vernetzten PC nach aussen übermittelt werden.
13. Im Laboratorium befinden sich ein Telefon sowie ein Alarmknopf.
14. Biologische Materialien, die den BSL3-Bereich im lebensfähigen Zustand verlassen, sind
in einem unzerbrechlichen und versiegelten Behälter einzuschliessen, der selbst ebenfalls
in einen zweiten unzerbrechlichen und versiegelten Behälter gestellt wird.
Klasse 4 = Biosicherheitsstufe 4 = BSL4
Da diese Stufe in unseren Hochschulen nicht vorkommt, kann auf entsprechende Ausführun-
gen verzichtet werden. Nötig sind spezielle Infrastrukturen, Protokolle und Ausbildungen.
CUSSTR / August 2005 – Es gilt die aktualisierte Internetversion. 18Kapitel 12: Biologische Risiken und Gefahren
Besondere Weisungen
Zusätzliche Sicherheitsmassnahmen beim Umgang mit Mikroorganismen (Art. 9
SAMV)
1. Beim Umgang mit Mikroorganismen der Gruppen 1–4 sind die Sicherheitsmassnahmen
der entsprechenden Sicherheitsstufen 1–4 nach Anhang 3 zu treffen; beim Umgang mit
Mikroorganismen der Gruppen 2–4 handelt es sich dabei um geschlossene Systeme. Vor-
behalten bleibt Artikel 6 Absatz 6.
2. Für mikrobiologische Laboranalysen von Boden-, Wasser-, Luft- oder Lebensmittelpro-
ben genügen in der Regel die Sicherheitsmassnahmen der Sicherheitsstufe 1 für For-
schungs- und Entwicklungslaboratorien. Ist mit einer deutlich erhöhten Gefährdung zu
rechnen, so sind weiter gehende zusätzliche Massnahmen zu treffen.
3. Für Laboranalysen von klinischem Material (medizinisch-mikrobiologische Diagnostik)
genügen in der Regel die Sicherheitsmassnahmen der Sicherheitsstufe 2 für Forschungs-
und Entwicklungslaboratorien.
4. Werden pathogene Mikroorganismen der Gruppe 3 zu diagnostischen Zwecken angerei-
chert und ist dadurch mit einer erhöhten Gefährdung zu rechnen, so sind die Sicherheits-
massnahmen der Sicherheitsstufe 3 für Forschungs- und Entwicklungslaboratorien zu
treffen. Beim Umgang mit Mikroorganismen der Gruppe 4 zu diagnostischen Zwecken
sind die Sicherheitsmassnahmen der Sicherheitsstufe 4 zu treffen.
Krankheitserreger (Prionen), die für transmissible spongiforme Enzephalopathien (TSE)
verantwortlich sind, sind der Gruppe 3 zugeordnet.
Obwohl es keinen erhärteten Beweis dafür gibt, dass durch Erreger (die für BSE beim
Menschen verantwortlich sind) bedingte Infektionen durch tierische Prionen verursacht
werden, müssen alle Arbeiten mit den Sicherheitsmassnahmen der Sicherheitsstufe 3
durchgeführt werden.
Eidgenössische Fachkommission für biologische Sicherheit (EFBS):
Richtlinien für das Arbeiten mit Zellkulturen (August 1999)
■ Arbeiten mit primären Zellkulturen sollten im Allgemeinen unter Sicherheitsmassnah-
men der Sicherheitsstufe 2 durchgeführt werden.
Bei Arbeiten mit Zelllinien oder –klonen, welche aus primären Zellkulturen abgeleitetet sind,
gelten die Sicherheitsmassnahmen der Sicherheitsstufe 1. Diese Herunterstufung ist jedoch
nur möglich, wenn entsprechend den Empfehlungen für die Produktion von Impfstoffen die
Präsenz human- oder tierpathogener Organismen mit geeigneten Testverfahren ausgeschlos-
sen wurde und der Versuchszweck Sicherheitsstufe 1 zulässt. Die Sicherheitsstufe 1 kann
auch erwogen werden bei gut charakterisierten und häufig verwendeten klassischen Linien
(CHO, Vero, HeLa). In Laboratorien, in denen mit Organismen gearbeitet wird, die diese
Zelllinien infizieren können, darf diese Lockerung der Sicherheitsbedingungen nicht ange-
wandt werden.
CUSSTR / August 2005 – Es gilt die aktualisierte Internetversion. 19Kapitel 12: Biologische Risiken und Gefahren
■ Es liegt in der Verantwortung der Projektleitenden, die Information über die primären
Zellkulturen - menschlichen oder tierischen Ursprungs - zu beschaffen und das Risiko einer
Kontamination durch pathogene Organismen abzuschätzen, die eine höhere Sicherheitsstufe
als Sicherheitsstufe 2 (z.B. durch HIV) notwendig macht. Es liegt auch in der Verantwortung
der Projektleitenden abzuklären, ob die verwendeten Kulturbedingungen die Vermehrung
dieser Organismen erlauben.
■ Die Sicherheitsbeauftragten und die EFBS sind verpflichtet, Fragen zu beantworten,
und die Projektleitenden bei der Festlegung der Sicherheitsvorkehrungen, die in spezifischen
Fällen angewendet werden müssen, zu beraten.
Diese Richtlinien stützen sich auf folgende Überlegungen:
■ Die Mehrheit der diagnostischen Tests und Forschungsverfahren mit primären eukaryonten
Zellen werden gegenwärtig unter Sicherheitsmassnahmen durchgeführt, welche die Proben
vor Kontamination von aussen schützen sollen (wichtigste Massnahme ist die Verwendung
von mikrobiologischen Sicherheitswerkbänken der Klasse II). Dies ist als „good laboratory
practice“ (Gute Laborpraxis) zu betrachten, womit sich beispielsweise das Scheitern von
Versuchen durch Kontaminationen mit Mykoplasma verhindern lässt. Durch die Einführung
weiterer einfacher Sicherheitsmassnahmen lassen sich diese Sicherheitsvorkehrungen zur
vollen Sicherheitsstufe 2 ergänzen.
■ Es gibt keinen einfachen (klinischen oder mikrobiologischen) Test für den Nachweis, dass
keine pathogenen Organismen aus einem Lebewesen in den primären Zellen vorhanden sind.
Es gibt sehr viele human- und tierpathogene Organismen, die eine Gefahr für das Personal
darstellen können. Die Durchführung einer Testreihe, mit dem Ziel, diese pathogenen Orga-
nismen auszuschliessen, kann überaus kostspielig sein und ist nur gerechtfertigt, wenn die
Zellen in grossem Massstab für industrielle Zwecke verwendet werden sollen.
■ Die in spezifischen Experimenten angewendeten Kulturbedingungen begünstigen jeweils nur
eine begrenzte Zahl von Krankheitserregern.
■ Bei Zelllinien und –klonen, welche aus primären Zellen abgeleitet sind, ist die Situation nicht
völlig anders als bei primären Zellen. Je mehr Zeit seit der Zellentnahme verstrichen ist, um-
so grösser ist das Wissen um eine Zelllinie, so dass die Wahrscheinlichkeit einer Kontamina-
tion abnimmt. Allerdings ist das Risiko einer zufälligen Kontamination immer im Auge zu
behalten.
■ Es ist schwierig, eine klare qualitative Abgrenzung zwischen Diagnostik und Forschung vor-
zunehmen. Im Falle vieler Krankheitserreger besteht eine Überschneidung zwischen der
Menge (Anzahl Organismen oder Konzentration) pathogener Organismen, die man in dia-
gnostischen Verfahren findet, und derjenigen, die man in Forschungsverfahren feststellt.
Doch die Wahrscheinlichkeit, dass sich in primären Zellen pathogene Organismen befinden,
ist bei diagnostischen Arbeiten höher als in der Forschung.
Vollständiger Text: Erarbeitet von der Eidgenössischen Fachkommission für Biologische Sicherheit
und anderen Experten; Mai 1998/August 1999.
(http://www.umwelt-schweiz.ch/imperia/md/content/efbs/53.pdf)
CUSSTR / August 2005 – Es gilt die aktualisierte Internetversion. 20Kapitel 12: Biologische Risiken und Gefahren
Weitere Kommentare zu den Zellkulturen
Die Wahrscheinlichkeit der Eindringung, Integration und Teilung von Zellkulturen
nach einem Störfall ist ein nur schwer zu beurteilendes Risiko. Aus diesem Grund müs-
sen Menschen- aber auch Affenzellen als biologische Risikoproben behandelt werden.
Auszug aus der Präventionsbroschüre «Risques biologiques», Centre national de recherche
scientifique (CNRS), 1. Aufl., 2002
Reinigung, Desinfektion, Sterilisation
Inaktivierung pathogener oder gentechnisch veränderter Mikroorganismen
Beim willentlichen Umgang mit pathogenen oder gentechnisch veränderten Mikroorganismen
müssen entsprechende Massnahmen getroffen werden. Pathogene oder gentechnisch verän-
derte Mikroorganismen, die in kontaminierten Materialien enthalten sind oder auf kontami-
nierten Geräten zurückbleiben, müssen inaktiviert werden.
Wärme
Sowohl die ESV als auch die SAMV schreiben für die Inaktivierung von pathogenen (Gruppe
2 bis 4) oder gentechnisch veränderten Mikroorganismen einen Autoklav vor. Der Autoklav
hat sich bei Tätigkeiten der Klasse 2 im selben Gebäude und bei Tätigkeiten der Klasse 3 im
selben Laboratorium zu befinden.
Kontaminierte Flüssigkeiten und feste Abfälle sind so zu behandeln, dass das biologische
Material inaktiviert wird. Sie können beispielsweise behandelt werden, indem sie während 20
Minuten bei 121 °C (1,2 bar) autoklaviert werden. Für Organismen, die bei hohen Temperatu-
ren sehr stabil sind, sowie für Sporen ist eine Temperatur von 134 °C (1,5 bar) erforderlich.
Autoklav für vertikale Bestückung
CUSSTR / August 2005 – Es gilt die aktualisierte Internetversion. 21Kapitel 12: Biologische Risiken und Gefahren Desinfektionsmittel Es kann auch eine chemische Desinfektion durch Eintauchen in eine desinfizierende Lösung vorgenommen werden. Die benutzten Arbeitsflächen sind mindestens einmal täglich zu desin- fizieren. Die Desinfektionsmittel sind nach den spezifischen Angaben zu verdünnen, und die Wirkungszeit ist einzuhalten. Beim verwendeten Produkt sind die maximalen Arbeitsplatzkonzentrationswerte (MAK) ein- zuhalten (Der Maximale Arbeitsplatzkonzentrationswert [MAK-Wert] ist die höchstzulässige Durchschnittskonzentration eines gas-, dampf- oder staubförmigen Arbeitsstoffes in der Luft, die nach derzeitiger Kenntnis in der Regel bei Einwirkung während einer Arbeitszeit von 8 Stunden täglich und bis 42 Stunden pro Woche auch über längere Perioden bei der ganz stark überwiegenden Zahl der gesunden, am Arbeitsplatz Beschäftigten die Gesundheit nicht ge- fährdet.). Zu beachten ist allerdings, dass der Gebrauch von Desinfektionsmitteln (MAK Formaldehyd (0,5 ppm), Glutaraldehyd (0,1 ppm)) ein verstärktes Risiko toxischer oder allergischer Reak- tionen (Kontaktdermitis), einer Beeinträchtigung der Atemwege sowie von Augenreizungen beinhaltet. Zum Schutz sind die üblichen Vorsichtsmassnahmen zu treffen. Alkoholhaltige Desinfektionsmittel (MAK Äthanol (1000 ppm); Isopropanol (400 ppm)) sind zwar wesentlich weniger toxisch, dafür sind sie entflammbar. Diese Desinfektionsmittel sind bei Kontaminationen infolge eines Zwischnfalls zwingend zu verwenden. Wird eine Kultur verschüttet, kann die Flüssigkeit mit einem Papier, das vorgängig mit einer desinfizierenden Lösung durchtränkt wird, zugedeckt und aufgewischt werden. Beim Umgang mit solchen toxischen Desinfektionsmitteln sind Handschuhe und Schutzbril- len zu tragen. Bei Verletzungen und Kontaminierungen mit infizierten Materialien muss die Wunde unver- züglich mit Seife und Wasser ausgewaschen werden. Die Wunde ist danach mit einem Desin- fektionsmittel zu desinfizieren. Je nach Art der Verletzung und der Erreger ist ein Arzt zu konsultieren. Behandlung biologischer Abfälle Beim Umgang mit biologischen Abfällen sind dieselben Handhabungs- und Einschliessungs- bedingungen einzuhalten wie beim Umgang mit biologischen Erregern. Die Abfälle müssen regelmässig entsorgt werden. Eine provisorische Lagerung hat unter Einhaltung der Ein- schliessungsbestimmungen zu erfolgen. Laboratorium P1: nicht pathogene und gentechnisch nicht veränderte Stämme: keine Inakti- vierung erforderlich, flüssige Abfälle können in den Ausguss geschüttet werden, sofern keine anderen (z.B. chemische oder radioaktive) Kontaminanten vorhanden sind. Feste Abfälle müssen mit den brennbaren Abfällen entsorgt werden, dabei gelten dieselben Einschränkun- gen wie bei den flüssigen Abfällen. Scharfe oder schneidende Gegenstände sind als Sonderab- fälle zu entsorgen. CUSSTR / August 2005 – Es gilt die aktualisierte Internetversion. 22
Kapitel 12: Biologische Risiken und Gefahren
Das ganze Labormaterial, das durch GVO der Klasse 1 kontaminiert ist, muss vor der
Entsorgung als normaler Abfall inaktiviert werden.
Laboratorium P2: Die Mikroorganismen des Materials, der Abfälle und der kontaminierten
Geräte müssen inaktiviert werden. Alles, was das Laboratorium als Abfall verlässt, muss so-
mit inaktiv sein oder als Sonderabfall behandelt werden, wenn z.B. eine chemische oder eine
radioaktive Kontamination vorliegt. Es ist anzugeben, ob eine biologische Kontamination
vorliegt.
Scharfe oder schneidende Gegenstände müssen als Sonderabfälle entsorgt werden. Wenn sie
kontaminiert sind, müssen sie vor ihrer Entsorgung sterilisiert oder sowohl als biologischer
als auch als schneidender Abfall markiert werden. Für diese Art von Abfall müssen spezielle
Sammelbehälter zur Verfügung gestellt werden.
Der Autoklav muss sich im selben Gebäude befinden.
Laboratorium P3: Die Mikroorganismen des Materials, der Abfälle und der kontaminierten
Geräte müssen inaktiviert werden, bevor sie das Laboratorium verlassen können. Inaktivierte
Abfälle aus Laboratorien P3 bleiben Sonderabfälle. Sie müssen als solche behandelt und dem-
zufolge einer Fachstelle übergeben werden.
Scharfe oder schneidende Gegenstände müssen als Sonderabfälle entsorgt werden. Wenn sie
kontaminiert sind, müssen sie vor ihrer Entsorgung sterilisiert werden. Sie sind und bleiben
Sonderabfälle. Für diese Art von Abfall müssen spezielle Sammelbehälter zur Verfügung ge-
stellt werden.
Der Autoklav muss sich im Laboratorium befinden.
Tierische Abfälle: Bei dieser Art von Abfällen handelt es sich ebenfalls um Sonderabfälle,
die zur Verbrennung einem spezialisierten Betrieb zugeführt werden müssen. Die Tierexper-
ten der betreffenden Institutionen liefern die dazu erforderlichen Informationen.
Achtung: Abfälle dieser Art können für Mensch und Tier ein Infektionsrisiko bein-
halten!
Abfälle von menschlichen Körperteilen: Bei dieser Art von Abfällen handelt es sich um
Sonderabfälle, die zur Verbrennung einem spezialisierten Betrieb oder einer ermächtigten
Stelle zugeführt werden müssen. Die Biosicherheitsverantwortlichen (BSO) der Institution
liefern die dazu erforderlichen Informationen.
Achtung: Abfälle dieser Art können für den Menschen ein Infektionsrisiko beinhal-
ten.
Information zu den Säcken für biologische Abfälle
Bioabfall-Säcke müssen klar markiert sein, damit die autoklavierten Abfälle problemlos von
den Abfällen, die noch nicht autoklaviert worden sind, unterschieden werden können. Ein
autoklavierter Sack wird z.B. in einen anderen Sack verpackt, der eine andere Farbe aufweist,
so dass der Hinweis «Biohazard» sowie der Sackinhalt nicht mehr sichtbar sind.
Wenn die Abfälle nicht innerhalb der Institution inaktiviert werden können, müssen entspre-
chende Massnahmen für den Transport durch ein spezialisiertes und zugelassenes Unterneh-
men getroffen werden. Bezüglich der Markierung der Transportbehälter gelten die
SDR/ADR-Vorschriften.
CUSSTR / August 2005 – Es gilt die aktualisierte Internetversion. 23Kapitel 12: Biologische Risiken und Gefahren
Es gibt keine besonderen Vorschriften in Bezug auf die Farbe der Säcke für biologische Ab-
fälle. Dennoch können kantonale Bestimmungen entsprechende Vorschriften enthalten.
Im Allgemeinen werden transparente oder gelbe Säcke mit der Aufschrift «Biohazard» oder
rot-weiss gestreifte Säcke verwendet. Wichtig ist nur, dass es zu keiner Verwechslung zwi-
schen inaktivierten und nicht inaktivierten Abfällen kommt.
Die Säcke müssen reissfest und für Flüssigkeiten dicht sein.
Gemischte Abfälle
Für kontaminierte biologische Abfälle mit chemischen und/oder radioaktiven Risiken gibt es
keine allgemeinen Regeln.
Bei solchen Abfällen ist es wichtig, die grösstmögliche Gefahr zu berücksichtigen. Man
muss dabei soweit möglich versuchen, diese Abfälle so zu behandeln, dass sie der Ent-
sorgung zugeführt werden können.
Die zur Risikobeurteilung relevanten Informationen sind im Einzelfall beim Sicherheitsver-
antwortlichen oder bei den zugelassenen Entsorgungsbetrieben einzuholen.
Eine Autoklavierung ist in jedem Fall verboten, da die Gefahr einer Kontaminierung der Ge-
räte und Anlagen besteht.
Bestellung, Handel, Transport
Lebensfähiges biologisches Material der BSL2 muss in einem bruchsicheren und versiegelten
Behälter eingeschlossen werden. Dieser Behälter ist überdies in einen zweiten ebenfalls
bruchsicheren und versiegelten Behälter zu stellen. Dasselbe gilt für den internen und exter-
nen Transport, für den Austausch und Kauf von Stämmen zwischen Laboratorien und Unter-
nehmen.
Für Material der BSL3 ist eine dreifache Verpackung notwendig.
Die Aussenverpackung muss mit dem Hinweis «Biohazard» (Biologisches Risiko) versehen
sein.
Selbstkontrolle für das Inverkehrbringen (Art. 5 FrSV)
1.
Wer Organismen für den Umgang in der Umwelt in Verkehr bringen will, muss die mög-
lichen Einwirkungen auf den Menschen oder die Umwelt beurteilen und zur berechtigten
Schlussfolgerung gelangen, dass die Organismen beim Umgang in der Umwelt den Men-
schen und die Umwelt nicht gefährden können.
2.
Zu diesem Zweck sind insbesondere zu beurteilen:
a. Überlebensfähigkeit, Ausbreitung und Vermehrung der Organismen in der Umwelt;
b. mögliche Wechselwirkungen der Organismen mit anderen Organismen und Lebens-
gemeinschaften sowie Auswirkungen auf Lebensräume.
Information der Abnehmerinnen und Abnehmer (Art. 6 FrSV)
Wer Organismen für den Umgang in der Umwelt in Verkehr bringt, muss die Abnehmerin
oder den Abnehmer:
CUSSTR / August 2005 – Es gilt die aktualisierte Internetversion. 24Sie können auch lesen