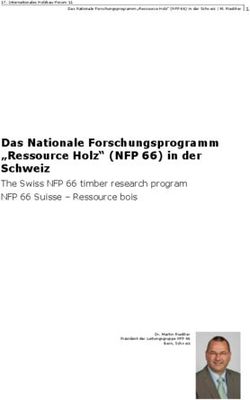Biomasse - Was ist das? Zukunftsenergien. Unterstützt von Land und Wirtschaft. www.energieland.nrw.de
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Biomasse - Was ist das?
Zukunftsenergien. Unterstützt von Land und Wirtschaft.
www.energieland.nrw.de
Die Landesregierung
Nordrhein-WestfalenBiomasse -
Was ist das?
Biomasse als Energieträger
Von der weltweit auf der Erde eingestrahlten Sonnenenergie reichen 0,1 % aus, um Biomasse
(bios = Leben) als chemisches Umwandlungsprodukt von Bodenmineralien, Wasser und
Kohlendioxid aus der Luft entstehen zu lassen.
Bei dieser Fotosynthese im Pflanzengrün werden Kohlenwasserstoffe erzeugt. Im heutigen
Sprachgebrauch zählen zur Biomasse im energetischen Sinn alle pflanzlichen und tierischen
Stoffe sowie deren Umwandlungsprodukte und organischen Abfälle, die für eine Energiegewinnung
geeignet sind.
Dabei sind primäre Biomassen jene, die durch direkte fotosynthetische Ausnutzung der Sonnen
strahlen entstanden sind. Dazu gehören z.B. land- und forstwirtschaftliche Rohstoffe, die nicht
für die Ernährung oder als Futtermittel verwendet werden. Zu diesen nachwachsenden Rohstoffen
werden z.B. die energetischen Wertstoffe Rest- (Schwach-) Holz aus der Walddurchforstung,
Heu, Stroh und Grünpflanzenrückstände sowie Produkte aus dem Energiepflanzenbau, z.B.
schnellwachsende Baumarten, gezählt.
Sekundäre Biomassen umfassen energetisch nutzbare pflanzliche, tierische oder menschliche
Reststoffe. Hierzu gehören:
Tierische und pflanzliche Abfälle aus der Landwirtschaft (Dung, Gülle, Getreide-, Obst- und
Gemüserückstände), organische Hausabfälle, organische Abfälle aus der gewerblich / industriellen
Fertigung (z.B. Lebensmittelindustrie, holzver- und bearbeitende Unternehmen) sowie Klärgas
und Deponiegas.
Biomasse-Energie kann durch verschiedene Umwandlungstechnologien nutzbar gemacht werden.
2Konversion von Biomasse, Die Umwandlungstechnologien, Konversionen von Biomasse,
bilden ein weiteres Unterscheidungsmerkmal bei der Beschreibung
physikalische Verfahren in Biomasse:
Physikalische,
thermochemische,
biologische
Verfahren wandeln die Primärstoffe der Biomasse in
feste,
flüssige,
gasförmige
Brennstoffe sowie in die Endprodukte Strom, Wärme oder
Kraftstoffe um. Bei physikalischen Umwandlungstechnologien
werden z.B. Holzabfälle (Sägemehl, Späne) in die für eine
Verbrennung optimale Aufbereitungsform (Pellets, Presslinge,
Briketts) mechanisch bearbeitet.
Oder: Stroh und Heu wird durch physikalische Verfahren zu
Häckselgut oder Großballen geformt; ölhaltige Pflanzen (Raps,
Sonnenblumenkerne) werden durch Auspressen zu Ölen aufbe
reiten.
Durch physikalische Verfahren werden die Biomasse-Einsatz-
stoffe so behandelt, dass die themochemische und biologische
Konversion prozessoptimiert verlaufen kann.
3Konversion von Biomasse, Verbrennung, Vergasung und Verflüssigung von Biomasse stellen
die thermochemischen Verfahren dar, um aus den Primärstoffen
thermochemische Verfahren energetische Endprodukte zu gewinnen.
Verbrennung von Biomasse
Die Verbrennung von Biomasse insbesondere von Holz stellt
die älteste Form der Energieerzeugung dar. Sie wurde in den
Industrieländern vor 200 Jahren durch die Nutzung fossiler
Energieträger abgelöst, gilt in der Dritten Welt aber noch heute
als wichtige Energiequelle.
Die Verbrennung von Energiepflanzen-Festbrennstoffen, Stroh
und Waldrestholz beträgt in Deutschland derzeit nur wenige
Prozente der möglichen technischen Nutzungspotenziale. In den
letzten Jahren sind jedoch sehr hohe Steigerungsraten zu verzeich
nen.
Dagegen wurden bisher ca. 60 % der (Abfall-) Resthölzer als
Energiewertstoffe insbesondere beim produzierenden Gewerbe
verbrannt, um die Wärme betrieblich zu nutzen oder um die
thermische Energie über einen Wasser-Dampf-Kreislauf und
Einsatz einer Dampfturbine oder eines Dampfmotors in Strom
und Wärme umzuwandeln. Planungs- und Genehmigungsanfragen
lassen jedoch darauf schließen, dass für den Bereich der Althölzer
zukünftig eine erhöhte Nachfrage besteht.
Biomasse-Feuerungsanlagen und Blockheizkraftwerke (BHKW)
bedürfen für die Errichtung und den Betrieb in Abhängigkeit von
ihrer Leistungsgröße sowie der Art und Qualität der Einsatzstoffe
öffentlich-rechtlicher Genehmigung, z.B. nach den verschiedenen
Verordnung (1., 4., 13., 17. Verordnung) zum Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz bzw. der TA Luft.
4Brenn- Bett-
stoff material
Gasfilter
Gaskühler
Vergasung Sekundär-
Die Vergasung von Biomasse stellt zunehmend eine Alter zyklon
native zu reinen Feuerungsanlagen dar, die oftmals schlecht Sekundär-
Flug- Filter-
regelbar sind und mit Feuerung und Dampfturbinenprozeß luft
asche asche Abgas
geringere elektrische Wirkungsgrade erzielen als Gasmo
toren-BHKW.
Zirkulierende
Wilbelschicht als
Bei der Vergasung (mit Luft) entsteht ein Rohgas, bestehend Holz-/Biomasse-
aus Stickstoff, Kohlenmonoxid, Wasserstoff, Kohlendioxid, vergaser mit BHKW
Methan und Wasserdampf; außerdem bilden sich Reststoffe, Primär-
luft
Siphon-
luft
Gene-
rator
Gas-
motor
Abgas-
wärme-
Kamin
z.B. Aschen. Das entstandene Gas kann in Brennern z.B. tauscher
zur Wärmeerzeugung oder in Gasmotoren oder -turbinen
zur Stromerzeugung eingesetzt werden.
Verflüssigung
Die Verflüssigung ölhaltiger nachwachsender Rohstoffe, z.B.
Raps, Öllein, Soja, Sonnenblumen und Senf, führt zu hochwertigen
Einsatzstoffen für die chemische Industrie. Da Öle und Schmier
stoffe auf Biomassebasis biologisch voll abbaubar sind, ist ihr
Einsatz in sensiblen Bereichen der Forst- und Wasserwirtschaft
äußerst sinnvoll.
Rapsöl kann in seiner Reinform oder auch nach seiner Umwand
lung in Rapsölmethylester (RME) sowohl in BHKW-Anlagen
zur gekoppelten Strom-/Wärmeerzeugung als auch in Kraftfahr
zeugen eingesetzt werden.
Die klassische Bioethanolgewinnung erfolgt über biotechnologi
sche Vergärung zucker- und stärkehaltige Rohstoffe wie Zucker
rohr, Zuckerrüben, Kartoffeln oder Getreide. Die Bioethanolpro
duktion aus Lignocellulose (Holz, nicht zuckerhaltige Biomasse)
befindet sich derzeit noch im Entwicklungsstadium.
Biogene Kraftstoffe die aus Synthesegas mittels Fischer-Tropsch-
Synthese hergestellt werden, nennt man BtL-Kraftstoffe (Biomass-
to-Liquid). BtL-Synthesegas kann grundsätzlich aus jeder Art
von Biomasse gewonnen werden. BtL-Kraftstoffe werden zur
Zeit noch nicht kommerziell hergestellt
5Konversion von Biomasse,
biologische Verfahren
Biologische Verfahren
Biologische Verfahren laufen unter Beteiligung von Mikroorga
nismen ab. Wird die Biomasse unter Sauerstoffzuführung zersetzt,
z.B. Verrottung von Biomasse zu Kompost bei Entweichen des
Methans in die Atmosphäre, finden aerobe Verfahren Anwen
dung. Bei der Vergärung unter Luftabschluß, anaerobe Um
wandlung kann in den technischen Anlagen (in NRW z.B. in
Bottrop und Herten) außer Kompost auch Biogas gewonnen
werden. Aus den organischen Substanzen abgedichteter und
abgedeckter Deponien kann durch Bakterienstämme Deponiegas
(bis 70 % Methananteil) produziert werden.
In den Faultürmen von Klärwerken werden in ca. 30 Tagen
Verweilzeit die Klärschlämme ausgefault. Bakterienstämme
zersetzen unter Luftabschluss die organischen Substanzen, dabei
werden Klärgase mit einem Energiegehalt von ca. 60 kWh pro
Jahr und angeschlossenem Einwohner erzeugt.
Biogas aus Dung und Gülle, ggf. unter Zusetzung (Kofermentation)
von gartenbau- und landwirtschaftlichen Reststoffen oder auch
von Bioabfall, lassen Landwirte verstärkt zu Energiebauern
werden.
Mit Einführung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) können
Biogasanlagen nicht nur für landwirtschaftliche Betriebe, sondern
auch für Gewerbebetriebe (z.B. Lebensmittelindustrie) wirtschaft
lich interessant sein. Je Großvieheinheit (GV) können in
Fermentern bei Verweilzeiten von 30 Tagen 1-1,5 m³ Biogas
täglich gewonnen und außerdem Geruchsemissionen reduziert
und die Düngewirkung der vergorenen Gülle verbessert werden.
6Biomasse - die ökologischen
Vorteile
Nutzung von Biomasse Die energetische Nutzung von Biogas (im Wesentlichen auf
Biomasse aus nachwachsenden Rohstoffen wird zu den erneuer Methanbasis Deponiegas, Klärgas, und Biogas aus Biogasanla
baren Energieträgern gerechnet, weil diese während ihres Wachs gen) erspart der Umwelt gleich doppelt klimaschädliche Emissi
tums nicht weniger Kohlendioxid aus der Atmosphäre entzieht, onen:
als bei der Energieumwandlung wieder freigesetzt wird; d.h., die
Energiegewinnung auf der Basis Biomasse erfolgt CO2-neutral. durch Einsparung von Erdgas,
Holzerzeugnisse stellen außerdem einen CO2-Speicher dar; so durch Nutzung sonst entweichenden Methans mit dem
sind bundesweit ca. 325 Mio. t Kohlenstoff in Holzerzeugnissen 21-fachen CO2-Äquivalenzwert.
gebunden, dies sind etwa 1 Mrd. Tonnen CO2 mehr als die
jährlichen Emissionen in Deutschland! Der Einsatz flüssiger abbaubarer Biostoffe hält Natur-und Was
serhaushalt von Verunreinigungen frei.
Die verstärkte Nutzung von Biomasse bewirkt eine Schonung
der endlichen fossilen Energieträger und sichert Ressourcen Die verstärkte Nutzung von Biomasse dient im Übrigen dem
für nachkommende Generationen! verstärkten Einsatz von regenerativen Energieträgern mit fluktu
rierenden Energiequellen (Wind/Solarenergie) insgesamt: Biomasse
in festem, flüssigem oder gasförmigen Aggregatzustand ist
speicherbar und kann (in der Grundlast) in Hybridsystemen
dann eingesetzt werden, wenn das Angebot anderer erneuerbarer
Energien mengenmäßig und zeitlich nicht der Nachfrage entspricht.
Deshalb unterstützt die Landesinitiative Zukunftsenergien NRW
die Biomassenutzung in Nordrhein-Westfalen und ebnet Wege
über die Arbeitsgruppe Außenwirtschaft auch für Nutzungen
weltweit.
Nach der Zielvorgabe der EU-Kommission soll Biomasse in
Zukunft einen großen Beitrag im Energiesystem leisten und damit
merklich am Aufbau einer umwelt- und klimaverträglichen
Energieversorgung mitwirken.
7Bis Ende 2004 wurden ca. 1,25 % der Bruttostromerzeugung
erreicht. Realistische Schätzungen belegen hingegen, dass in
naher Zukunft etwa 10 % des deutschen Stromverbrauchs aus
Biomasse erzeugt und gedeckt werden könnte.
Die tatsächliche Nutzung liegt zur Zeit weit unter den Möglich-
keiten der potentiellen Nutzung. In allen Bereichen der energeti
schen Nutzung von Biomasse gibt es erhebliche Steigerungspo
tentiale. Diese gilt vor allem für
die Deponiegasnutzung
die Klärschlamm- und Klärgasnutzung
die Nutzung von Bioabfällen
die landwirtschaftliche und gewerbliche Biogasnutzung
die energetische Nutzung fester Biomasse
sowie bei der Nutzung von Biomasse als Kraftstoffersatz.
In der unten aufgeführten Tabelle erhalten Sie einen Überblick
Potenziale und Nutzung über die Einspeisevergütungen nach der EEG-Novelle.
Die technischen Energiepotenziale der Biomasse werden gegen- Planungssicherheit durch Einspeisevergütung
wärtig in den EU-Mitgliedsstaaten im Durchschnitt nur zu einem Mit dem EEG gibt es auf die Dauer von 20 Jahren fest kalkulierbare
Viertel genutzt. Aber der Einsatz von Biomasse gegenüber den Einspeisevergütungen ins öffentliche Stromnetz. Über die Bio
Wärme-und Stromgestehungskosten auf Basis fossilier oder masseverordnung ist definitiv geklärt, welche Stoffe als Biomasse
nuklearer Energieträger wird durch weiteren Anstieg der fossilen eingesetzt werden dürfen. Das Interesse an der energetischen
Energiekosten immer wirtschaftlicher. Nutzung von Biomasse nimmt stetig zu, zumal die Förder
bedingungen für Investitionen gerade in NRW besonders günstig
Nach jüngsten Untersuchungen kann Biomasse in Deutschland sind.
einen Beitrag zur Energieversorgung bis zum Jahre 2030 von:
16 % des Strombedarfs
Mindestvergütungssätze der Stromnetzbetreiber
19 % des Wärmebedarfs und nach EEG 2005
12 % des Kraftstoffbedarfs Festgeschrieben für 20 Jahre nach Inbetriebnahme der Anlage1)
leisten.
Leistungen Vergütung Bonus Bonus Bonus
Nawaro2) KWK3) innovativ
kW Cent/kWh Cent/kWh Cent/kWh Cent/kWh
Bei dieser Untersuchung wurde jedoch nur das Biomassepotenzial
aus Deutschland berücksichtigt. bis 150 11,33 6 2 2
ab 150 9,75 6 2 2
ab 500 (Biogas) 8,77 4 2 2
In Deutschland beträgt der Anteil der Biomasse am End
ab 500 (Holzverbrennung) 8,77 2,5 2 2
energieverbrauch ca. 1,8 %. Bis Ende 2004 wurden mehr als
ab 5.000 8,27 - 2 -
2.500 Biogasanlagen zur Stromerzeugung betrieben. In NRW
ab 5.000 (Altholz AIII/AVI) 3,90 - - -
stehen hiervon allerdings "nur" rund 140 Anlagen. Durch die 1) 1,5 % Degression ab 2005, 20 Jahre Laufzeit
Novelle des EEG mit den angehobenen Vergütungssätzen für 2) Nachwachsende Rohstoffe
Strom aus Biogasanlagen einschließlich des Bonus für nachwach 3) Kraft-Wärme-Kopplung
sende Rohstoffe wird die Zahl der Biogasanlagen in den nächsten Das Gesetz ist am 01. August 2004 in Kraft getreten
Jahren deutlich ansteigen. Hohe Steigerungsraten werden auch
für den Bereich der festen Biomasse erwartet. Die Angaben über
den Anteil der Stromeinspeisung aus Biomasse sind sehr unter
schiedlich und weisen eine breite Streuung auf.
8Neben dem seit 1998 existierenden REN-Programm, hat das
Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz des Landes NRW 1998 zur Förderung des
Einsatzes von Holz eine Richtlinie zur Förderung des Holzabsatzes
(Hafö) herausgegeben. Mit ihr ist der Absatz forst- und holzwirt
schaftlicher Produkte verbessert und die CO2-neutrale energe
tische Nutzung von Holz verstärkt worden. Damit werden der
heimischen Forst- und Holzwirtschaft zugleich zusätzliche EU-
Fördermöglichkeiten erschlossen. Von 1998 bis August 2005
wurden insgesamt 3.900 Anlagen in NRW gefördert. Die Nenn-
wärmeleistung aller Anlagen lag bei rund 220 MW.
Wie unterstützt
Nordrhein-Westfalen die
Biomassenutzung?
Durch die Landesinitiative Zukunftsenergien NRW unterstützt Aktion Holzpellets
Nordrhein-Westfalen die Entwicklung und Markteinführung von Seit Februar 2003 unterstützt die Aktion Holzpellets, eine
Zukunftsenergien. Als Informations- und Kommunikationsplatt gemeinsame Marketing-Kampagne des Umweltministerium
form bietet sie interessierten Fachleuten die Möglichkeit, Kontakte NRW, der Landesinitiative Zukunftsenergien NRW und in
zu knüpfen und Kooperationen einzugehen. In diversen fachspe Kooperation mit der Energieagentur NRW, die energetische
zifischen Arbeitsgruppen, Themenfelder und Kompetenz-Netz- Nutzung von Holzpellets.
werken konnten über 3.000 aktive Teilnehmer aus Forschung und
Wirtschaft ihre Projektvorschläge einbringen und innovative Ziel ist es, gemeinsam mit Herstellern, Produzenten, Fachbe
Ideen umsetzen. Die Arbeitsgruppe Biomasse wird von Rolf- trieben, Institutionen, Verbänden und Energieversorgern dieser
Dieter Linden moderiert. innovativen Heiztechnik zum breiten Durchbruch zu verhelfen.
Mit einer Reihe von Maßnahmen unterstützt die Landesinitiative Mit landesweiten Messen und Veranstaltungen, Informations
Zukunftsenergien NRW die Aktivitäten im Bereich Zukunfts- material, Radiowerbung sowie einem Marktführer wird über
energien. So bietet der landesweite Branchenatlas Zukunftsenergien diese umweltfreundliche Alternative des Heizens informiert.
NRW einen Überblick über die Angebote und Leistungsprofile
der im Bereich Zukunftsenergien tätigen Produzenten, Dienstleister Angesichts des nutzbaren Biomassepotenzials erweisen sich die
und Institutionen. Die Branchenübersicht ist online im Internet Fördermaßnahmen insgesamt nicht nur aus energie- und umwelt-
verfügbar. relevanten Gründen als sinnvoll. Sie genügen auch dem Anspruch
eines ganzheitlichen Konzepts mit Technologie-, Industrie-,
Bereits vor der 1996 gegründeten Landesinitiative Zukunfts- Struktur- und Arbeitsmarktaspekten. Derzeit erwirtschaften in
energien NRW hat Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Förder- Deutschland rund 40.000 - 50.000 Beschäftigte im Bereich
programms Rationelle Energieverwendung und Nutzung uner- Bioenergie einen Jahresumsatz von 1,8 Mrd. EUR.
schöpflicher Energiequellen (REN) Projekte auf der Basis
Biomasse, Bio-, Klär- und Deponiegasanlagen gefördert. Von
1988 bis Ende 2004 sind mehr als 57 Mio. EUR Fördermittel
für rund 640 Projekte eingesetzt worden.
9Anaerobe Vergärungs-
anlage in Bottrop für einen
Jahresdurchsatz von 6.500 t
Grün- und Bioabfällen;
Output: 2.800 t Kompost,
750.000 m³ Biogas/Jahr.
Faulbehälter, je 9.500 m³
Fassungsvermögen,
Klärgasgewinnung- und
-verwertung =
11 Mio. m³/Jahr, Klärwerk
Krefeld.
Projektbeispiele
Projektbeispiele realisierter REN-Projekte und
aktuelle Leitprojekte der Landesinitiative Zukunfts- Demonstrationsanlage für biologische Abfälle nach dem
energien NRW Verfahren Integrierte Mathanisierung und Kompostierung
(IMK)
Als beispielhaftes und seit Jahren im Betrieb bewährtes Projekt Ziele und Vorteile des IMK-Verfahrens sind u.a.:
gilt der Einsatz eines pflanzenöl-betriebenen BHKW in Verbindung
mit einer Feuerungsanlage auf der Basis Rapsschrot und Verarbeitung organischer Reststoffe unterschiedlicher Kon
Holzhackschnitzel in Unna. sistenz
hohe Betriebssicherheit und Verfügbarkeit durch modulare
Integrierte Methanisierung und Kompostierung Bauweise
(IMK)
Minimierung der Abwassermenge durch Kreislaufführung der
Nach dreijähriger Erprobung der Verfahrenstechnik in einer
in Reststoffen enthaltenen Wassermengen
Prototypenanlage mit 500 t Jahreskapazität verarbeitet ab 1998
die Demonstrationsanlage großtechnisch 18.000 t Biomüll/Jahr Fest-Flüssig-Trennung vor der Methanisierung, daher energie-
und erzeugt dabei rund 5.000 t Kompost sowie Biogas, welches und materialarme Prozessführung,
zunächst zur Vergleichsmäßigung in einem Speicher gepuffert geringer Flächenbedarf durch kompakte Bauweise
und danach kontinuierlich zwei Blockheizkraftwerken (BHKW) Vermeidung von Geruchsemissionen durch geschlossene
zugeführt wird. Diese werden jährlich rund 3,3 GWhel und Bauweise aller Anlagenteile und Einsatz von Biofiltern
5,5 GWhth Energie erzeugen. Die Energieerzeugung versorgt die
Minimierung der anaeroben Behandlungsdauer durch auto
Anlage vollständig. Der überschüssige Strom wird in das öffent-
matische Prozesssteuerung
liche Netz eingespeist; die Überschusswärme versorgt eine
benachbarte Gärtnerei. geringe Bauhöhe durch nacheinander durchströmte Anaero
breaktoren
hohe Kompostqualität durch Schwermetallauswaschung in
Feststoffreaktor
CO2-neutrale Energienutzung (pro Tonne Bioabfall 80-120 m³
Biogas)
hohe Energieausbeute
biologische Abwasserbehandlung
10Container mit BHKW und Mikoturbine (Bild oben,
links) und Blick auf die Mikroturbine (bild oben
rechts), Hof Loick, Lembeck
Biogasanlage auf dem Hof Loick, Lembeck
Bau und Demonstrationsbetrieb einer integrierten In dem 1.000 m³ großen Fermenter werden bei mesophiler
Energieversorgung (Kraft-Wärme-Kälte) mit Biomas Betriebstemperatur 110 m³ Biogas pro Stunde erzeugt. Das Gas
se-Kofermentierung wird biologisch entschwefelt, um Gasmotor und Gasturbine vor
Korrosion durch den Schwefelwasserstoff und seine Verbren
Gemeinsam mit Forschern des Fraunhofer-Instituts für Umwelt-, nungsprodukte zu schützen. Im BHKW, elektrische Leistung
Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT aus Oberhausen 250 kW und Gasturbine, elektrische Leistung 100 kW, werden
wurde eine Biogasanlage mit einer ausgeklügelten Energienutzung etwa 2,8 Mio. kWh Strom jährlich erzeugt - das entspricht dem
entwickelt. Ein Teil der bei der Stromerzeugung aus dem Biogas Stromverbrauch von 700 Haushalten.
in einem Blockheizkraftwerk (BHKW) entstehenden Abwärme
wird für die preisgünstige Erzeugung von Kälte verwendet. Dieses Die jährliche Nutzwärme von BHKW und Turbine wird zum Teil
innovative Konzept wird vom Land Nordrhein-Westfalen und "konventionell" eingesetzt: zur Heizung von Wohnräumen, Büros
der Europäischen Union gefördert. und Ställen, zur Brauchwassererwärmung, zur Wasservorwärmung
bei der Schweinefütterung und für den Eigenbedarf der Biogas
Jährlich werden in der Biogasanlage ca. 4.000 m³ Gülle, ca. 2000 t anlage.
Maissilage und ca. 5.000 t Reststoffe aus der Lebensmittelpro
duktion eingesetzt.
11Projektbeispiele
Das erste Modellprojekt in NRW zur Nutzung von Pflanzenöl als Substitut
fossiler Energieträger und als sozial-ökologisches Regionalwirtschaftskonzept
für Aachen und Umgebung
Als regenerativer und flüssiger Energieträger steht uns mit chemisch unverändertem Pflanzenöl
ein Stoff zur Verfügung, dessen Produktion, Verwendung und Entsorgung regional innerhalb
vollständig geschlossener Stoffkreisläufe möglich ist.
Technisch betrachtet kann naturbelassenes Pflanzenöl (nicht zu verwechseln mit Biodiesel)
verwendet werden als
Dieselkraftstoffersatz für Pkw, Kleintransporter, Lkw, Schlepper und Lokomotiven,
Heizölersatz in BHKW- und Heizungsanlagen,
Substitut für bestimmte Mineralölprodukte (Schal-und Trennmittel, Verlustschmieröle),
Ausgangsstoff für spezielle Produkte (Flammschutzmittel, chemische Industrie).
Das beim Pressvorgang entstehende Kuppelprodukt Presskuchen kann zur Gänze als Tiermehl-
und Sojaschrotersatz in der landwirtschaftlichen Tierhaltung verfüttert werden. Somit zeigt sich,
dass Ölpflanzen regional und zu 100 % verwertbar sind.
In der Gemeinde Recke, im Kreis Steinfurt, wurde am
10. Oktober 2003 die erste große Biogasgemeinschaftsanlage
in NRW eingeweiht.
In Recke, im Kreis Steinfurt haben sich 19 Landwirte zusammengeschlossen
und Nordrhein-Westfalens erste große Biogasgemeinschafts-Anlage gebaut.
Um die Anlage zu errichten und zu betreiben haben sich die Landwirte zur
Ökoenergie Recke GmbH zusammengeschlossen. Das Projektteam der
Betreibergesellschaft führte die Planung der Anlage, mit Unterstützung der
Energieberater der Landwirtschaftskammer, selbständig aus. Die erforderlichen
Ingenieurleitungen wurden nur nach Aufwand eingekauft. Auf diese Weise
konnten die Investitionskosten niedrig gehalten werden. Insgesamt lagen
sie bei rund 1,6 Mio. Euro.
Biogasanlage Recke mit
Die Anlage besteht aus 4 Fermenter je 1250 m³ und 2 Endlager je 3000 m³.
Maissilage-Bevorratung
Die Anlage wird ausschließlich auf der Basis von pflanzlichen Rohstoffen
betrieben. Täglich werden ca. 30 m³ Mais, ca. 10 m³ Mist, ca. 60 m³ Schweine-
gülle und ca. 30 m³ Rindergülle eingespeist. Diese Inputmaterialien erzeugen
ein Biogas für zwei BHKW mit einer Leistung vom jeweils 511 kWel. Der
Gärrest wird von den liefernden Landwirten zurückgenommen und als
Wirtschaftsdünger eingesetzt. Die Transportentfernungen für Gülle betragen
1,3 bis 8 km, die für den eingesetzten Mais bis zu 15 km. Die Transportkosten
gehen zu Lasten der Biogasanlage
Auf längere Sicht ist vorgesehen, auch die Abwärme zur Wärmeversorgung
benachbarter Gewerbegebiete zu nutzen.
12Die Gestufte Reformierung ist ein neues, innovatives Verfahren zur Vergasung
von biogenen Reststoffen aller Art.
Die Erfinder des Verfahrens haben auf dem Gebiet der Vergasung mit Wasserdampf ein Verfahren
geschaffen, das die Vorteile eben dieser Wasserdampfvergasung, reichlich Wasserstoff in einem
sehr ballastarmen und unverdünnten Produktgas, für den dezentralen Einsatz von biogenen
Einsatzstoffen zugänglich macht: Kernelemente des unter Atmosphärendruck betriebenen Verfahrens
sind neben einigen fördertechnischen Komponenten einfache Behälter ohne Einbauten, in denen
sich der Prozess in Wanderbetten abspielt.
Die Gestufte Reformierung ist ein zweistufiges Vergasungsverfahren: In der ersten Stufe wird
der Einsatzstoff thermolysiert, d.h. unter Luftabschluss auf über 500 °C erhitzt. Hierzu wird ein
heißes Schüttgut als Wärmeträger in den Thermolysereaktor gegeben. Dadurch spaltet sich der
Einsatzstoff auf in ca. 80 Massen-% flüchtige Phase und 20 % Koks. Die Flüchtigen treten aus
der Thermolyse in den Reformer ein und werden dort unter Dampfzugabe auf mehr als 900 °C
erhitzt, wobei sich die in der flüchtigen Phase befindlichen Kohlenwasserstoffe praktisch vollständig
zu Kohlenmonoxid und ganz besonders wichtig zu Wasserstoff umsetzen.
Man erhält so ein Produktgas mit 50 % und mehr Wasserstoff, ca. 10 - 15 % Kohlenmonoxid und
deutlich unter 5 % Methan und höheren Kohlenwasserstoffen.
Der Heizwert reflektiert mit ca. 10 MJ/Nm³ den hohen Wasserstoffgehalt. Sowohl eine energetis
cheals auch eine rohstoffliche Nutzung des Produktgases ist möglich. Das Reforming ist endotherm,
die Wärme wird ebenfalls über den Wärmeträger zugeführt, der an dieser Stelle noch deutlich
heißer als in der Thermolyse vorliegt.
Erste energieautarke Rapsölmühle Deutschlands
startet im Münsterland
Die Teutoburger Ölmühle produziert in einem völlig neuartigen,
von der Universität Essen entwickelten Verfahren, Raps-Kernöl
und liefert gleichzeitig die Energie dafür. Das Konzept: Ener
gieautarke Herstellung hochwertiger, kaltgepresster Raps-Kernöle
mit Rohstoffen aus zertifiziertem Vertragsanbau.
Die hochmoderne Anlage verarbeitet in einem neuartigen Verfahren
Raps zu hochwertigem Raps-Kernöl. Die energetische Eigenver
sorgung der Produktionsanlage wird zudem durch Mehrfachnut
zung der Rapssaat als Rohstoff zur Gewinnung von Speiseöl,
Futtermitteln, Biobrennstoffen sowie thermischer und elektrischer
Energie gewähr-leistet. Durch die technische Neuartigkeit und
die beispiellose Umweltfreundlichkeit hat die Anlage Demonst
rationscharakter für eine ganze Branche.
Ölmühle In der Teutoburger Ölmühle werden in der ersten Ausbaustufe
täglich ca. 10 Tonnen Raps-saat aus zertifiziertem Vertragsanbau
zu ca. 3,5 Tonnen hochwertigem Rapsöl verarbeitet. Die schwarzen
Rapssamen werden in der Anlage geschält, in Kerne und Schalen
getrennt und anschließend in separaten Linien vollständig verar
beitet.
Das qualitativ mindere Schalenöl wird für die Produktion von
Prozesswärme und elektrischer Energie genutzt. Aus dem wert
Produkte der Teutoburger vollsten Teil des Rapssamens, dem Rapskern, wird in der ersten
Ölmühle Pressung das sensorisch und ernährungsphysiologisch außer-
ordentlich hochwertige Raps-Kernöl gewonnen.
13Projektbeispiele
Erste Brennstoffzellenanlage Europas, bei der Klär- Die Brennstoffzellenanlage verwertet nunmehr das gesamte
gas als Brennstoff eingesetzt wird anfallende Klärgas energetisch, dabei wird der Strom-bedarf der
Kläranlage zu rund 50 % und der Wärmebedarf zu rund 100 %
Die Gas-, Elektrizitäts- und Wasserwerke Köln AG (GEW) betreibt abgedeckt. Die Ressourcenschonung kann mit jährlich 5 Mio.
auf dem Gelände des Klärwerkes Köln-Rodenkirchen die erste kWh Primärenergieeinsparung, die Umweltentlastung mit einer
Brennstoffzellenanlage Europas, bei der Klärgas - anstelle des CO2-Reduktion von rd. 1.000 t/Jahr prognostiziert werden. Das
sonst üblichen Erdgases - als Brennstoff eingesetzt wird. Forcieren der Entwicklung der Brennstoffzellentechnik ist für
Unabhängig von der Art ihres Elektrolyten: Die bisher betriebenen das Energie-land NRW von großer Bedeutung, denn die Brenn
Brennstoffzellentypen wurden stets mit Erdgas als Brennstoff stoffzelle zählt zu den "Hoffnungsträgern" einer nachhaltigen
eingesetzt wird. Zukunftstechnik im Energiesektor. Der Nutzungsgrad von 85 %
bei gleichzeitiger (emissionsfreier) Strom- und Wärmeerzeugung
Unabhängig von der Art ihres Elektrolyten: Die bisher betriebenen ist beispielhaft.
Brennstoffzellentypen wurden stets mit Erdgas als Brennstoff
Brennstoffzelle im Klär-
betrieben, welches in einer vorgeschalteten Erdgasaufbereitungs
werk Köln-Rodenkirchen
anlage in ein wasserstoffreiches Prozessgas umgewandelt wurde.
Der Einsatz von Klärgas schied bisher aus, da u.a. die im
Rohklärgas enthaltenen Halogene (Chlor und Fluor) und Schwe
felverbindungen, die Siloxane sowie die Feuchte für die Brenn
stoffzelle ein Gefährdungspotenzial darstellten.
Die Rohklärgas-Reinigungsanlage stellt die eigentliche technische
Innovation dar: Dieses Prozessgas wird der Phosphorsäure-
Brennstoffzelle zugeführt; die chemische Energie des Wasserstoffes
wird hier in elektrische und thermische Energie umgewandelt.
Die Brenn-stoffzellenanlage erreicht eine elektrische Leistung
von 200 kW und eine Wärmeleistung von 205 kW.
Biomassenutzung Hackschnitzelheizung
Das gesamte Areal der Bundeswehr-Sportschule wird von einem
zentralen Heizwerk durch die Energieagentur Lippe GmbH im
Contracting versorgt. Neben den Turnhallen und dem Schwimmbad
werden auch die Unterkünfte, Verwaltungsgebäude und das
ansässige sportmedizinische Institut mit Wärme versorgt.
Die maximale Wärmelast beträgt 3,7 Megawatt, der durchschnitt
liche Jahres-Nutzwärmebedarf beträgt 10.000 Megawattstunden
pro Jahr. In einem Jahr braucht der Kessel durchschnittlich 3.800
Tonnen Holzhackschnitzel, im Volllastbetrieb sind das umgerechnet
etwa 72 Schüttraummeter am Tag. Der errichtete Holzhackschnit
zelkessel hat eine thermische Leistung von 2.000 Kilowatt und
ermöglicht eine Abdeckung des Wärmebedarfs zu 85 Prozent mit
Holz. Dadurch werden pro Jahr 850.000 Liter Heizöl eingespart,
was einer CO2 Einsparung von 3.300 Tonnen entspricht.
Die umliegenden Waldbesitzer können hier ihr Schwach- und
Restholz abliefern und haben so einen wichtigen, zusätzlichen
Absatzweg. Weitere Zulieferer sind Sägewerke und Landschafts
pflegebetriebe aus der Umgebung, die hier ebenfalls ihren Holz
abfall nutzbringend abgeben können. Unter Beteiligung des
Forstamtes Warendorf wurde ein umfassendes Lieferkonzept
erstellt, wobei die lokale Agrarservice GmbH die Bereitstellung
des Holzes organisiert.
Holzhackschnitzelanlage in der Bundeswehrsportschule
Warendorf (oben und Mitte links), Feuerung (Mitte
rechts) Anlieferung der Hachschnitzel (unten, links)
und Hackschitzelbunker (unten, rechts)
14Druckschriften und
Broschüren
Zukunftsenergien aus Nordrhein-Westfalen, Nahwärmeverbund Brakel, Kreis Höxter,
Broschüre der Landesinitiative Zukunftsenergien NRW Broschüre der Landesinitiative Zukunftsenergien NRW
Holzpellets - Versorgung mit Holz für kleinere Wohneinheiten, Bundeswehrsprotschule Warendorf heizt mit Holz,
Broschüre der Landesinitiative Zukunftsenergien NRW Broschüre der Landesinitiative Zukunftsenergien NRW
Holzpelletheizung im kommunalen Einsatz am Beispiel einer Systematische Nutzung von Holz,
Sonderschule in Düsseldorf, Broschüre der Energieagentur NRW
Broschüre der Landesinitiative Zukunftsenergien NRW Leitfaden Bioenergie - Neue Perspektiven für Kommunen
5 Jahre Holzabsatzförderung in Nordrhein-Westfalen, und Wohnungswirtschaft,
Broschüre der Landesinitiative Zukunftsenergien NRW Broschüre der Energieagentur NRW
Gemeinschaftsbiogasanlage Recke, Kreis Steinfurt, Handreichung "Biogasgewinnung und -nutzung,
Broschüre der Landesinitiative Zukunftsenergien NRW Broschüre der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe
Biokraftstoffe,
Broschüre der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe
Wichtige Adressen
Landesinitiative Zukunftsenergien NRW Bundesinitiative Bioenergie e.V. Bezirksregierung Arnsberg
c/o Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Godesberger Allee 90, 53175 Bonn Abteilung Bergbau und Energie in NRW
Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Telefon: 02 28/9 59 56-0 Goebenstraße 25, 44135 Dortmund
Landes Nordrhein-Westfalen Telefax: 02 28/9 59 56-50 Telefon: 02 31/54 1 02 64
Schwannstraße 3, 40476 Düsseldorf (REN-Demonstrationsförderung, REN-
Telefon: 02 11/4566 6 71 Fachverband Biogas e.V. Technische Entwicklung)
Telefax: 02 11/4566 4 25 Regionalgruppe NRW
E-Mail: leonhard.thien@munlv.nrw.de Kettelerstr. 47, 59329 Drestedde Programm zur Strukturellen Verbesserung
Internet:www.energieland.nrw.de Telefon: 0 25 20/912-373 der Verarbeitung und Vermarktungsbedin-
Telefax: 0 25 20/912-374 gungen forstwirtschaftlicher Erzeugnisse und
Energieagentur NRW E-Mail:hk@keitlinghaus-umweltservice.de zur Verbesserung des Einsatzes von Holz bei
Kasinostraße 19-21, 42103 Wuppertal der energetischen Verwertung
Telefon: 02 02/ 2 45 52-0 Internationales Wirtschaftsforum (Holzabsatzförderrichtlinie, Hafö) mit Stand vom
Telefax: 02 02/ 2 45 52-30 für regenerative Energien (IWR) 27.03.2003
Internet:www.ea-nrw.de Grevener Straße 75, 48159 Münster Auskunft und Beratung durch die unteren
Telefon: 02 51/2394-600 Forstbehörden (Forstämter) sowie durch die
Zentrum für nachwachsende Rohstoffe NRW Telefax: 02 51/2394-610 Höhere Forstbehörde Nordrhein- Westfalen
in der Lehr- und Versuchsanstalt der Land- Internet:www.iwr.de Internet:www.forst.nrw.de
wirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen Info-Service MUNLV:
Haus Düsse Forschungszentrum Jülich GmbH Telefon: 02 11/45 66-6 66
59505 Bad Sassendorf Projektträger ETN
Telefon: 0 29 45/9 89-0 52425 Jülich
Telefax: 0 29 45/9 89-133 Telefon: 0 24 61/6 90-6 01
Telefax: 0 24 61/6 90-6 10
Verbraucherzentrale NRW
Mintropstraße 27, 40215 Düsseldorf Bezirksregierung Arnsberg
Telefon: 02 11/38 09-0 Abt. 8, Dez. 85
Telefax: 02 11/38 09-1 72 Außenstelle Dortmund
Ruhrallee 1-3, 44139 Dortmund
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. Telefon: 02 31/2 86 85 95
(FNR) (REN-Breitenförderung)
Hofplatz 1, 18276 Gülzow
Telefon: 0 38 43/6930-100 c@ll NRW
Telefax: 0 38 43/6930-102 Telefon: 01 80/3 10 01 10
www.fnr.de Internet:www.call-nrw.de
E-Mail: c@ll.nrw.de
15Geschäftsstelle Außenstellen
c/o Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie Ministerium für Umwelt und Naturschutz,
des Landes Nordrhein-Westfalen (MWME) Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Haroldstraße 4 des Landes Nordrhein-Westfalen (MUNLV)
40213 Düsseldorf Schwannstraße 3, 40476 Düsseldorf
Telefon: 02 11/8 66 42-0
Telefax: 02 11/8 66 42-22 Ministerium für Innovation, Wissenschaft,
E-Mail: info@energieland.nrw.de Forschung und Technologie
des Landes Nordrhein-Westfalen (MIWFT)
Völklinger Straße 49, 40221 Düsseldorf
ee energy engineers GmbH
Munscheidstraße 14, 45886 Gelsenkirchen
Ihr Ansprechpartner in der Geschäftsstelle
Dr. Frank-Michael Baumann
Projektleiter
Prof. Dr.-Ing. Hartmut Griepentrog
10.2005
Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen
www.energieland.nrw.deSie können auch lesen