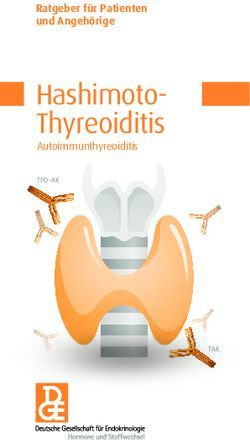Coronavirus Aktuelle Information über das - 2021-04-20 Klaus Friedrich - Deutscher Feuerwehrverband
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Escape Mutationen
Bei jeder Übertragung des Virus kann
es zu einer zufälligen Mutation
kommen.
Viele Neuansteckungen bedeuten
also viele Möglichkeiten, zu
mutieren.Escape Mutationen
Escape Mutationen
Escape Mutationen
Je mehr Menschen eine
Immunantwort entwickeln, desto
größer wird der Evolutionsdruck
auf das Virus. Sein Ziel ist es, sich
weiter zu vermehren. Varianten,
die die Antikörper schlechter
erkennen, haben dabei einen
Vorteil gegenüber dem
ursprünglichen Virus.Escape Mutationen
Escape Mutationen
Es setzen sich diejenigen Varianten durch, die
von Antikörpern schlechter erkannt werden.
→ ESCAPEEscape Mutationen
Summary The SARS-CoV-2 pandemic has been raging for over a year, creating global detrimental impact. The BNT162b2 mRNA vaccine has demonstrated high protection levels, yet apprehension exists that several variants of concerns (VOCs) can surmount the immune defenses generated by the vaccines. Neutralization assays have revealed some reduction in neutralization of VOCs B.1.1.7 and B.1.351, but the relevance of these assays in real life remains unclear. Here, we performed a case-control study that examined whether BNT162b2 vaccinees with documented SARS-CoV-2 infection were more likely to become infected with B.1.1.7 or B.1.351 compared with unvaccinated individuals. Vaccinees infected at least a week after the second dose were disproportionally infected with B.1.351 (odds ratio of 8:1). Those infected between two weeks after the first dose and one week after the second dose, were disproportionally infected by B.1.1.7 (odds ratio of 26:10), suggesting reduced vaccine effectiveness against both VOCs under different dosage/timing conditions. Nevertheless, the B.1.351 incidence in Israel to-date remains low and vaccine effectiveness remains high against B.1.1.7, among those fully vaccinated. These results overall suggest that vaccine breakthrough infection is more frequent with both VOCs, yet a combination of mass-vaccination with two doses coupled with non-pharmaceutical interventions control and contain their spread.
Cambridge/England – Die Variante B.1.617, die sich offenbar in Indien ausgebreitet hat, ist bisher in 21 Ländern aufgetreten. Ob sie mit einem höheren Ansteckungsrisiko verbunden ist oder sogar zu schwereren Verläufen von COVID- 19 führt, ist derzeit nicht bekannt. Public Health England stuft B.1.617 derzeit nur als „Variant under investigation“ (VUI-21APR-01) ein. … In der Datenbank GISAID ist B.1.617 bereits am 5. Oktober aufgetaucht. In Großbritannien wurde sie erstmals am 22. Februar nachgewiesen, in Deutschland wurde sie dem Vernehmen nach das 1. Mal im März identifiziert. Laut der Plattform Pango Lineages war Deutschland heute mit 39 Sequenzen nach Indien (297), Großbritannien (167) und den USA (81) das Land mit den viertmeisten nachgewiesenen Sequenzen. … Die Variante B.1.617 hat 13 Mutationen, die zu Aminosäureveränderungen führen. Darunter sind 2 Mutationen im Spikegen (E484Q und L452R). Diese werden als „Doppelmutationen“ bezeichnet. … Von den verschiedenen Mutationen sind 3 nach Einschätzung von Peacock wichtig. Die 1. Mutation ist E484Q. Mutationen an Position 484 sind in den Varianten B.1.351 (Südafrika), P.1 (Manaus) und teilweise auch in der britischen Variante B.1.1.7. aufgetreten. Dort allerdings als E484K. In E484K ist Glutaminsäure (E) durch Lysin (K) ersetzt, in E484Q erfolgte die Substitution durch Glutamin (Q). E484K macht das Virus unempfindlicher gegen bereits gebildete neutralisierende Antikörper (Immun-Escape). Die 2. relevante Mutation in B.1.617 ist … L452R. Diese Mutation wurde auch in der kalifornischen Variante B.1.429 gefunden. Die Mutation L452R hat laut Peacock in Laborexperimenten die neutralisierende Wirkung des Plasmas von Rekonvaleszenten oder auch von monoklonalen Antikörpern abgeschwächt. Die 3. relevante Mutation ist P681R. Mutationen an Position 681 (P681R oder P681H) wurden laut Peacock auch in mehreren in Großbritannien untersuchten Varianten (A.23.1/E484K, B.1.1.7 und B.1.318) gefunden. Sie seien relevant, weil sie sich neben der Furinspaltstelle des Spikeproteins befinden. Diese Stelle beeinflusst nach der Bindung von SARS- CoV-2 an der Zelle die Fusion der Virusmembran mit der Zellmembran. Wie sich P681R auf diesen Prozess auswirkt, ist allerdings noch unklar. … © rme/aerzteblatt.de
… Das Coronavirus hat sich verändert, ist mutiert. B.1.617 haben Wissenschaftler die Variante getauft, und sie weckt große Sorgen. …
Die beide Mutationen der Variante werden außerdem "mit einer reduzierten Neutralisierbarkeit durch Antikörper oder T-Zellen in Verbindung gebracht, deren Umfang nicht eindeutig ist", erklärt das Robert-Koch-Institut (RKI)
Inhalt 1. Zahlen und Fakten (Folie 26 ff) 2. Strategie (Folie 46 ff) 3. Labor und Testung (Folie 61 ff) 4. Pharmakologie (Folie 72 ff) 5. Medizinische Versorgung (Ambulant , Kliniken, Intensiv (Folie 79 ff) 6. Masken (Folie 85 ff) 7. Reinigung und Desinfektion 8. Sonstiges (Folie 89 ff)
Inhalt Zahlen und Fakten
weltweit
Zusammenfassung
Inzidenz
Schätzung der Fallzahlen unter Berücksichtigung des Verzugs (Nowcasting) und der Reproduktionszahl
Infektionsgeschehen Deutschland … Ansteckung
Tote
Dempgraphoie
Berlin – Unter den stark von SARS-CoV-2 betroffenen Menschen sind eher selten Kinder und Jugendliche. Aber auch sie können schwer erkranken oder sterben. Das zeigen Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI), die in einer Antwort der Bundesregierung der FDP-Fraktion vom 9. April veröffentlich wurden. Von den rund 2,8 Millionen COVID-19-Fällen gegen Ende März/Anfang April – ein exaktes Datum gibt die Bundesregierung in ihrer Antwort nicht an – gab es demnach etwa 385.022 Fälle bei Kindern und Jugendlichen zwischen null und 19 Jahren. Die meisten Fälle traten bei den 15- bis 19-Jährigen auf. In dieser Altersgruppe gab es 152.912 Fälle. Hospitalisiert wurden davon 1.776, 25 wurden auf einer Intensivstation versorgt. Bislang wurden dem RKI elf validierte COVID-19-Todesfälle bei unter 20-Jährigen übermittelt. Die Kinder und Jugendlichen waren demnach zwischen null und 17 Jahre alt, in acht Fällen waren Vorerkrankungen bekannt. Mindestens 68 Kinder und Jugendliche wurden auf Intensivstationen betreut. In 4.789 Fällen mussten die Kinder und Jugendlichen im Krankenhaus stationär versorgt werden. Die Bundesregierung teilt in ihrer Antwort aber auch mit, dass Hospitalisierung und Aufnahme auf Intensivstation erst im Verlauf auftreten und in der Regel nicht bei der ersten Übermittlung des Falls bekannt sind. Daher sei von einer „gewissen Untererfassung“ auszugehen. © may/aerzteblatt.de
Inhalt
StrategieMünster – Die angeordnete Quarantäne für eine bereits vollständig gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 geimpfte Bewohnerin eines Altenheimes im Münsterland ist rechtswidrig. Das Verwaltungsgericht Münster gab ihrem Eilantrag statt, wie es heute mitteilte – allerdings nicht wegen der bereits erfolgten Impfung. Es ging vielmehr um Ermessensfehler der Gemeinde Altenberge. Die Absonderung im Pflegeheim führe nämlich zu besonderen Belastungen, hieß es (Az. 5 L 255/21). Die Frau hatte Kontakt mit einem Infizierten, weswegen die Kommune Quarantäne anordnete. Dagegen zog sie vor Gericht und argumentierte, dass sie zweimal geimpft sei und ein PCR-Test negativ ausgefallen sei. Außerdem sei sie aus Gesundheitsgründen dringend auf Bewegung angewiesen. Das Gericht folgte dieser Argumentation nur zum Teil. Trotz der Impfung lasse sich eine „hinreichend wahrscheinliche Aufnahme von Krankheitserregern“ nicht verlässlich ausschließen, erklärte es. Ein negatives Testergebnis allein führe auch nicht dazu, dass die Verfügung der Gemeinde aufgehoben werden müsste. Allerdings sei die besondere Situation der Frau nicht berücksichtigt worden. Die Gemeinde habe eine Ausnahme „nicht einmal erwogen“. Dies hätte aber „mit Blick auf die ohne Weiteres mögliche Ausstattung der Antragstellerin mit FFP2- Masken oder weitergehender Schutzkleidung“ und durch das Verhindern ihres Zusammentreffens mit anderen Bewohnern, wenn sie zeitweise ihr Zimmer für körperliche Betätigung verlasse, nahe gelegen. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Es kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht in Münster eingelegt werden. © afp/aerzteblatt.de
Inhalt
Labor und Testung19.04.2021
Testung … Anzahl
Inhalt
Pharmakologie19.04.2021
18.04.2021
20.04.2021
Inhalt
Medizinische Versorgung
Ambulante Versorgung
Klinische VersorgungUnter den Gegebenheiten von Versorgungskliniken ließ sich in der zweiten Welle ein Rückgang der Gesamt- und Intensiv-Sterblichkeit beobachten, ähnlich zu einer niederländischen Studie (2). Demgegenüber fand sich in einer französischen Studie (3) sowie in deutschen Register-Daten (4) keine Verbesserung der Intensivsterblichkeit oder Prognose beatmeter Patienten, allerdings ein Rückgang der Intensiveinweisungen von 30 % auf 14 %. Basierend auf der umfassenden Charakterisierung der Patienten kann die hier beobachtete reduzierte Sterblichkeit schwerlich auf Gruppenunterschiede zurückgeführt werden. Insbesondere waren medianes Alter und Charlson-Score in der zweiten Welle sogar geringfügig höher. Aufgrund des Studiendesigns lassen sich keine kausalen Zusammenhänge zwischen Therapiestrategien und klinischem Verlauf herstellen. Bedeutsam war möglicherweise die häufigere Gabe systemischer Steroide in der zweiten Welle vor allem bei mindestens sauerstoffpflichtigen Patienten, während Remdesivir und Hydroxychloroquin nicht wesentlich zur Erklärung der Unterschiede der Sterblichkeit beigetragen haben dürften. Bemerkenswert war ein häufigerer Einsatz von nHF und NIV. Dies könnte zur Reduktion von Intensivverlegungen und Intubationen geführt haben (4). Entsprechend wurde die nHF inzwischen fester Bestandteil des Therapiealgorithmus bei akuter Hypoxämie und COVID-19 (5). Zusätzlich könnte die intermittierende Bauchlage unter milder Sedierung am wachen Patienten wirksam gewesen sein. Auch bei invasiver Beatmung lag die Sterblichkeit in der zweiten Welle niedriger, obgleich die Beatmungsstrategie, mit Ausnahme eines niedrigen endexspiratorischen Drucks bei höherer Lungencompliance, nicht wesentlich geändert wurde. Möglicherweise kam neben der gewachsenen Erfahrung im Umgang mit COVID-19-Patienten die sogenannte intensivierte Antikoagulation zum Tragen. Umgekehrt könnten Belastungsspitzen bei zeitgleicher Einweisung mehrerer Intensivpatienten und die höhere Verlegungsrate in der ersten Welle eine höhere Sterblichkeit begünstigt haben. Gemäß einer orientierend durchgeführten Cox-Regressionsanalyse wurde der Mortalitätsunterschied zwischen beiden Wellen bei Adjustierung für Alter, Geschlecht, Labor- und respiratorische Parameter, Linksherzinsuffizienz, Steroide, Antikoagulation, Intensivtherapie, Intubation, nHF, NIV sowie Therapielimitationen nur grenzwertig eliminiert (HR 0,683; 95-%-Konfidenzintervall [0,462; 1,012], p = 0,057). Insgesamt liegt die Erklärung der geringeren Sterblichkeit in der zweiten Welle am ehesten in einem umfassend verbesserten, multimodalen, nur begrenzt zu operationalisierenden Behandlungskonzept mit konsequenter Antiinflammation und Antikoagulation sowie später Intubation. Hinsichtlich der Übertragbarkeit ist einschränkend zu bemerken, dass es sich um eine relativ kleine, lokale Studie handelt. Positiv war, dass das Einzugsgebiet, Standorte, medizinisches Personal und Ausstattung stabil blieben. Als Schlussfolgerung ergibt sich, dass hospitalisierte Patienten aus einer während der ersten COVID-19-Welle stark belasteten süddeutschen Region in der zweiten Welle ein verbessertes Überleben zeigten, insbesondere intensiv- und beatmungspflichtige Patienten. Diese Unterschiede korrespondierten mit einer veränderten medikamentösen Therapie, dem häufigeren Einsatz von nHF und NIV und einer geringeren Intubationsrate.
Inhalt Masken/Schutzausstattung
Inhalt
SonstigesSie können auch lesen