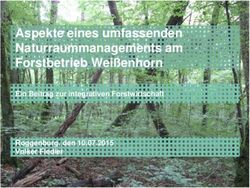Der Einfluss des Schalenwildes auf natürliche Wälder in Nordrhein-Westfalen
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
ÖKOJAGD 2 – 2021 Das Wald-Jagd-Problem 39
Das Wald-Jagd-Problem
Der Einfluss des Schalenwildes auf natürliche
Wälder in Nordrhein-Westfalen
Frank Christian Heute, Dirk Bieker
Einleitung
Nacheiszeitliche Waldentwicklung
Die Wälder Mitteleuropas sind durch
Anpassungsprozesse an wechselnde Unsere heutigen Wälder haben sich, ihren Standorten finden lassen. In
Standortbedingungen entstanden. Die- seit der letzten Eiszeit, über einen Zeit- dieser milden Zeit, möglicherweise
se Anpassungen an den Lebensraum raum von mehreren Jahrtausenden phasenweise ein bis zwei Grad Cel-
sind niemals „zu Ende“, weshalb der entwickelt. In dieser Zeit haben be- sius wärmer als heute (IPCC 2007),
Begriff „Klimaxgesellschaft“ als Vor- reits geringe Temperaturunterschiede etablierten sich in Mitteleuropa fast
stellung eines „fertigen“ Waldes von zu erheblichen Veränderungen der überall Eichenwälder mit Ulmen und
Vegetationkundler*innen nicht mehr standörtlichen Pflanzengemeinschaf- Eschen, weshalb das Atlantikum auch
genutzt wird. Die nach der letzten Eis- ten geführt. „Eichenmischwaldzeit“ genannt wird
zeit entstandenen Wälder haben sich Nach der noch kühlen ersten (s. Pollendiagramm; Kasielke 2014).
über einen Zeitraum von Jahrtausenden „Tundrenzeit“ nach Ende der Eis- In den wärmsten Phasen gesellten
entwickelt. Erste Laubmischwälder aus zeit wurde es allmählich milder in sich Linden hinzu. Auf trockenen
Eichen, Ulmen und Eschen bildeten sich Mitteleuropa und erste Birken-Kie- und armen Böden dominierte die Ei-
mit der plötzlichen Erwärmung des Kli- fernwälder konnten sich ausbilden, che. Ebenfalls zu dieser Zeit kam es
mas im Atlantikum vor ca. 7.500 Jahren später dann Hasel-Kieferwälder. Von aufgrund des angestiegenen Meeres-
(5.500 v. C.) aus. Erst nach Abkühlung entscheidender Bedeutung war dann spiegels zu gewaltigen „Rückstaus“
und „feuchter werden“ des Klimas vor die plötzliche Erwärmung des Klimas der Tieflandflüsse und ehemaligen
etwa 4.000 Jahren entwickelten sich die im Atlantikum vor ca. 7.500 Jahren Urstromtäler in Nord- und Ostsee.
Eichenmischwälder der mittleren Böden (5.500 v. C.). Der Ärmelkanal wurde Weite Bereiche Norddeutschlands
hin zu von Buchen dominierten Wäl- geflutet, die Nordsee füllte sich und versumpften – und Erlenbruchwälder
dern. der Golfstrom erreichte die südliche bildeten sich (Küster 1998).
Nordsee. Ein deutlich atlantischeres Nach Abkühlung und „feuchter
Klima setzte ein. In dieser Zeit bil- werden“ des Klimas vor etwa 4000
Natürliche Wälder deten sich die verschiedenen Wald- Jahren entwickelten sich die Eichen-
Kaum ein Quadratmeter Waldboden in typen mit ihren verschiedenen Bio- mischwälder der mittleren Böden hin
Deutschland ist noch „ur“. Der Mensch zönosen aus, die sich bis heute auf zu von Buchen dominierten Wäldern.
hat den Wald über Jahrtausende massiv
verändert. Manche Baumarten wurden
gefördert (z.B. Eiche), manche vermut-
lich übernutzt (z.B. Ulme). Und dennoch Abb. 1: Natürliche Waldgesellschaften in NRW
haben sich bis heute di-
verse Waldgesellschaften
ausgebildet, die inner-
halb einer Klimazone und
auf ähnlichen Standorten
gleiche Artenzusam-
mensetzungen aufwei-
sen. Diese nennen wir
„natürliche Waldgesell-
schaften“ (Kasten). Diese
Waldgesellschaften, die
sich seit dem Atlantikum
gebildet haben, wurden
von Pflanzensoziolo-
gen (u.a. Braun-Blan-
quet, Tüxen, Burrichter)
v.a. in den 1950-er bis
1970-er Jahre akribisch
beschrieben und syste-
matisiert und beschrei-
ben im Idealfall die „Ur-
sprüngliche Natürliche
Vegetation“ (UNV). Sie
sind aufgrund der Nut-
zung aber nur noch auf
Restflächen vorhanden:
Natürliche mesophile40 Das Wald-Jagd-Problem ÖKOJAGD 2 – 2021
Buchenwälder (bessere Böden) gibt es
Natürliche Waldgesellschaften in Deutschland noch auf 3,7 % der ur-
Unter „natürliche Waldgesellschaf- Aufgrund veränderter Standort- sprünglichen Fläche (Welle et al. 2017).
ten“ verstehen wir Wälder, deren bedingungen und eines erweiterten Von diesen Wäldern sind gerade einmal
Pflanzenarten sich seit dem Atlanti- Artenpools bedeutet das für viele 1,5 % naturnah und alt (> 140 Jahre).
kum in typischer Weise auf den jewei- Wälder, dass sich hier auch Arten eta- Von den Buchenwäldern auf bodensau-
ligen Standorten ausgebildet haben blieren (könnten), die nicht autoch- ren Standorten sind heute noch 2,9 %
(Ursprüngliche natürliche Vegetation thon sind. Zum Beispiel: Auf einer vorhanden. In NRW wachsen natürliche
(UNV)). Es bezieht sich zunächst auf geräumten Kyrillfläche eines Hainsim- Waldgesellschaften noch auf etwa 7,5 %
eine möglichst vollständige Artenaus- sen-Buchenwald-Standorts läuft seit der Waldfläche, d.h. 92,5 % sind mehr
stattung und typische Zusammenset- 2007 ungestörte Sukzession. Auf der oder weniger naturfern (Werking-Radt-
zung, nicht auf strukturelle Elemente Fläche (mit geringer Rehwilddichte) ke 2008). Nur noch in Fragmenten sind
wie Altersaufbau oder Schichtung wachsen heute 18 verschieden Arten, natürliche Orchideen-Buchenwälder,
bzw. den Ablauf bestimmter Prozesse darunter Nadelgehölze und Garten- Schlucht-/ Hangwälder, Moor- und
(kein „Urwald“) (Vgl. Meyer 2012). Je flüchtlinge (Reale Vegetation (RV)) Auwälder vorhanden (Abb. 1). In den
näher die heutige Vegetation der UNV (Heute 2017). Wie naturnah diese Hainsimsen- und Waldmeister-Buchen-
hinsichtlich der Artenzusammenset- Wälder bzw. Waldentwicklungssta- wäldern Nordrhein-Westfalens wachsen
zung kommt, desto „naturnäher“ ist dien sind, entscheiden neben dem „natürlicherweise“ eine ganze Reihe
der Wald zu bewerten (vgl. Kowarik Strukturreichtum auch der Anteil au- begleitende Baumarten mit: Auf den
2016). Im Gegensatz dazu beschreibt tochthoner Arten. Ob sich hier wieder besseren Standorten gesellen sich re-
die potentielle natürliche Vegetation ein Hainsimsen-Buchenwald einstel- gelmäßig u.a. Esche, Traubeneiche und
(PNV) diejenige Pflanzengesellschaft len würde, oder ob sich (mittelfristig) Ulme zu den Buchen (Tab. 1). In den
(rein hypothetisch), die sich unter den ein artenreicherer Mischwald mit Na- bodensauren Buchenwäldern kommen
gegenwärtigen Standortbedingungen delgehölzen und Gartenflüchtlingen Stiel- und Traubeneiche, Eberesche,
schlagartig einstellen würde, wenn durchsetzen wird – das kann nur die Aspe, Sandbirke und Salweide vor. Diese
der Mensch nicht mehr eingriffe. Langzeitbeobachtung zeigen. Waldgesellschaften sind charakteristisch
für weite Teile des Bergischen Landes,
des Sauer- und Siegerlandes. Weite Teile
Tab. 1: Naturnahe Waldgesellschaften und deren Baumarten in NRW
Waldgesellschaft Standort Begleit-Baumarten
Buchen- und Seggen-/ Orchide- steile, flachgründige Kalkstein- Traubeneiche, Feldahorn, Elsbeere, Mehlbee-
Buchen- en-Buchenwald hänge re, Eibe, Speierling, Holz-Apfel
mischwälder Haargersten-Buchen- frische kalkhaltige Böden Bergahorn, Esche, Berg-Ulme, Feldahorn,
wald Elsbeere, Hainbuche, Traubeneiche, Kirsche
Waldmeister-Buchen- kalkhaltige, mäßig saure Böden, Bergahorn, Esche, Berg-Ulme, Traubeneiche
wald teils nährstoffreich, oft lehmig
Hainsimsen-Buchen- saure, oft tiefgründige Böden Traubeneiche, Stieleiche, Eberesche, Aspe,
wald Birke, Salweide
Eichen- Labkraut-Hainbuchen- temporär trocken fallend Elsbeere, Eberesche, Birke
Hainbuchen- wald
wälder Sternmieren-Hainbu- Grund- oder Stauwasser beein- Esche, Berg-Ulme, Flatter-Ulme, Erle, Eber-
chenwald flusste sowie trockene sandige esche, Birke, Kirsche, Feld-Ulme, Feld-Ahorn
Böden
Bodensaure Birken-Stieleichenwald ärmste Sandböden Traubeneiche, Eberesche, (Kiefer)
Eichenmisch- Buchen-Eichenwald bodensauer, nährstoffarm Traubeneiche, Stieleiche, Birke, Eberesche,
wälder Winter-Linde
Schlucht-/ Eschen-Ahorn-Schatt- schattige, feuchte Nordhänge Berg-Ulme, Sommer-Linde, Buche
Hangmisch- hangwald und Schluchten
wälder Winterlinden-Hainbu- warme, schuttreiche Hänge im Sommer-Linde, Traubeneiche, Stieleiche
chen-Hangschuttwald Mittelgebirge
Auenwälder Winkelseggen-Er- Überflutungsbereiche von Flüs- Bergahorn, Winter-Linde, Berg-Ulme, Stielei-
len-Eschenwald sen und Bächen che, Hainbuche
Hainmieren-Schwarz- fruchtbarer Auenboden durch Esche, Bruch-Weide, Bergahorn
erlenwald Ablagerung erodierter Boden-
teilchen
Eichen-Eschen-Ul- „Hartholzaue“ am Mittel- und Feld-Ulme, Flatter-Ulme, Feldahorn, Berg-
men-Auwald Unterlauf größerer Flüsse ahorn, Winter-Linde
Silberweiden-Auwald periodisch überschwemmte Bruch-Weide, Schwarzpappel
Bereiche rasch fließender Flüsse
Bruchwälder Walzenseggen-Erlen- Niedermoor und anmoorige Moor-Birke, Eberesche
bruchwald Böden mit guter Nährstoffver-
sorgung
Birken-Moorwälder Nährstoffarme, nasse Torfböden Sandbirke, Eberesche, AspeÖKOJAGD 2 – 2021 Das Wald-Jagd-Problem 41
dieser Standorte sind hier aber seit Ende
des 18. Jahrhunderts durch die Pflan- Buchendominanz
zung von Nadelholzreinbeständen „ver- Anders als die Fichte, die als konkur- ihrer Waldweide (Hute) und Laubheuge-
fichtet“ worden. renzschwacher Nadelbaum in ih- winnung (Schneitelwirtschaft) über wei-
rem montanen Habitat der östlichen te Teile Deutschlands ausgedehnt und
Biodiversität Natürlicher Wälder Mittelgebirge verharrte (s. Kasten), ursprüngliche Wälder zurückgedrängt.
breitete sich die Buche unaufhaltsam Doch welche Wirkungen und in wel-
Neben der Bedeutung natürlicher Wäl- aus. Zunächst in den Gebirgen und chem Ausmaß der Mensch und sein Vieh
der als Forschungs- bzw. Referenzflä- später, erst vor etwa 3000 Jahren, tatsächlich auf die (natürliche) Wald-
chen leisten diese einen sehr wichtigen auch im Hügel- und Tiefland (Kölling entwicklung genommen haben, ist ab
Beitrag zum Erhalt der biologischen Viel- et al., 2005). Sie etablierte sich zur diesem Zeitpunkt unklar und umstritten,
falt (Fischer & Walentowski 2008). Für dominierenden Baumart, da sie bei z. B. die Ursache für den „Ulmenfall“,
Eichen-Buchenwälder im Spessart wur- uns auf allen mittleren Standorten ihr den plötzlichen und starken Rückgang
de die Bedeutung natürlicher Wälder ökologisches Optimum ausspielt und der Ulme am Ende des Atlantikums.
für Fledermäuse nachgewiesen (Bußler sich hier konkurrenzstark durchsetzt: Die Buche und die Hainbuche mach-
2007), die hier deutlich artenreicher Neben der Fähigkeit, Schatten zu er- ten sich bei uns also erst breit, als der
vorkommen als im Mittel. tragen, ist auch ihr Wurzelwerk ge- Mensch bereits den Wald bearbeitete.
Für Bayern konnten Hacker und Mül- genüber konkurrierenden Arten meist Und die Buche erlangte als Brennholz,
ler (2006) feststellen, dass 70 % aller be- überlegen (Leuschner 1998). Viehmast, Holzkohle und Pottasche
kannten Schmetterlinge in Naturwald- Exakt in die Wärmephase des At- rasch einen großen Stellenwert – einen
reservaten vorkommen. lantikums mit seinen klimatisch be- weitaus größeren als heute, wo mit Bu-
Schulte (2005) konnte für NRW die dingten Ausbildungen der Wälder chen weniger Geld verdient wird als
herausragende Bedeutung natürlicher, und des Vordringens der Buche fällt mit Fichte oder Douglasie. Doch trotz
nicht mehr bewirtschafteter Wälder für in Deutschland die Sesshaftwerdung der rezent ungünstigen „Marktlage“ für
Käfer nachweisen. In nur 18, stichpro- des Menschen, das „Neolithikum“. Buchenholz: Kölling et al. (2005) bele-
benartig untersuchten Naturwaldzellen Die Menschen begannen Lichtun- gen die „überragende gegenwärtige
wurden allein 133 Käferarten bestätigt, gen in die Wälder zu schlagen und und zukünftige Rolle der Buche in den
die für Deutschland als Neu- bzw. Wie- Ackerbau und Viehzucht zu betreiben natürlichen Waldgesellschaften und ihre
derfunde gelten! Auch Müller (2004) (Vgl. Kasielke 2017). Manche Autoren große Bedeutung für Naturschutz und
beschreibt die Bedeutung natürlicher nehmen an, dass sich die Buche über- Waldbau“. Denn ihrer herausragenden
Wälder für holzbewohnende Käfer: „Je haupt erst, wie „Unkraut“, auf diesen Konkurrenzkraft zum Trotz sind unsere
näher die Baumartenzusammensetzung Lichtungen etablieren konnte (Vgl. Buchenwald-Gesellschaften keinesfalls
an der potentiellen natürlichen Vegeta- Küster 1996). Gegen Ende des Atlan- so artenarm wie gerne herbeigeredet
tion, desto wertvoller die Artengemein- tikums hatte sich die Viehhaltung mit wird (Vgl. Harthun 2017; Schnell 2005).
schaft!“ Auch die Untersuchungen von
Winter et al. (2005) zeigen eindeutig,
dass natürliche Buchenwälder eine hö-
here Strukturdiversität, einen höheren „Klimastabile“ Wälder ten innerhalb einer Baumart für die
Totholzanteil, mehr saprophytische Pilze notwendigen Anpassungen sorgen. Bei
und Käfer sowie Brutvögel aufweisen. Bei der Summe an unsicheren Faktoren, den Planungen muss man sich von dem
Forschungsergebnisse zeigen zudem, besonders bezogen auf die Klimapro- Gedanken verabschieden, dass wir auf
dass es eine positive Korrelation von gnosen bis über das Jahr 2100 hinaus, einen stabilen Endzustand des Klimas
Produktivität und Strukturdiversität (Da- kann man heute nur schwer einschät- hinarbeiten und diesen mit konkre-
nescu et al. 2016) sowie der Produkti- zen, welche Baumarten langfristig die ten Modellen ermitteln können (Ibisch
vität von Mischbeständen gegenüber Waldfunktionen gewährleisten können, 2020).Die Vergangenheit hat gezeigt,
Reinbeständen gibt (Liang et al. 2016). bzw. welche genetischen Eigenschaf- dass die natürlichen Waldgesellschaften
mit all ihren Tier- und Pflanzenarten sich
an vielfältigste Veränderungen anpassen
können und somit in der Lage sind, die
Die Fichte – im Westen nicht (mehr) heimisch Waldfunktionen auch unter variierenden
Während der Eiszeit gab es Zwischen- die Fichte aus klimatischen Gründen Umweltbedingungen sicher zu stellen.
warmzeiten (Interglaziale), während nicht gegen ihre belaubten Konkur- Neue Untersuchungen zeigen, dass sich
deren die Temperaturen bei uns in renten durchsetzen. Auch nach dem epigenetische Anpassungsprozesse im
etwa das heutige Niveau erreichten. Ende der letzten Eiszeit vor 12.000 Saatgut und der Naturverjüngung deut-
In diesen Interglazialen entwickel- Jahren breitete sich die Fichte, ausge- lich schneller vollziehen als sich nach der
ten sich zunächst Birken- und Kie- hend von ihren Refugien in den Ost- Darwinschen Evolutionstheorie vermu-
fernwäldchen, mit zunehmender alpen, dem Balkan, den Karpaten und ten lässt. Diese epigenetischen Effekte
Temperatur folgten Hasel, Eichen, Russland, allmählich wieder aus. Mit können theoretisch dazu beitragen, dass
Linden und Ulmen. Innerhalb der In- dem Beginn des „Atlantikums“ setzte Saatgut aus Jahren mit starken Hitzepe-
terglaziale gab es sogenannte Inter- stark maritim beeinflusstes Klima in rioden in der Folge deutlich hitzetole-
stadiale, in denen die Temperaturen Deutschland ein. Und damit war die rantere Pflanzen hervorbringt (Hosius
nicht so hoch waren, dass sich die Ausbreitung der Fichte gestoppt, da et al. 2019). Dabei ist jedoch auch zu
anspruchsvolleren Laubbäume wie im nun vorherrschenden ozeanischen beachten, dass sich diese Waldgesell-
Linden, Ulmen oder Eichen nach Mit- Klima Laubbäume konkurrenzstärker schaften über einen langen Zeitraum
teleuropa ausbreiten konnten. In die- sind. Die Westgrenze des Fichten- fast ungestört entwickeln konnten. Heu-
sen kurzen Phasen konnte die Fichte areals verlief vom Bodensee über die te dürften Traubeneichen aus deutschen
in Mitteleuropa Fuß fassen. In den Oberpfalz, den Thüringer Wald bis Reliktbeständen – z.B. auf Steilhängen
Warmphasen allerdings konnte sich zum Harz. der Schwäbischen Alb – auf extrem tro-
ckenen Standorten genetisch bereits an42 Das Wald-Jagd-Problem ÖKOJAGD 2 – 2021
Trockenstressphasen wie in den vergan- Baumart A gegen Baumart B) sind be- zipfelfalter nur Fortbestehen, wenn das
genen Dürrejahren angepasst sein (Vgl. quem, werden aber langfristig die Pro- Überleben der Flatterulmen gewährleis-
Deter 2021; AWG 2021). Die natürli- bleme nicht unbedingt lösen. Weltweit tet ist. Angepasste Wildbestände sind
che Ausbreitungsgeschwindigkeit der sind sich Wissenschaftler verschiedens- demnach die Grundvoraussetzung, da-
Eichen beträgt jedoch nur 200 bis 300 ter Disziplinen darin einig, dass die Re- mit die natürlichen Waldgesellschaften
Meter pro Jahr. Durch künstliche Saaten sistenz und Resilienz von Ökosystemen mit ihrem vollständigen Spektrum an
oder Pflanzungen könnte die Ausbrei- durch eine erhöhte Biodiversität und Baum- und Straucharten erhalten blei-
tung dieser geeigneten Genotypen un- Naturnähe positiv beeinflusst werden ben und innerhalb einer Art die Mög-
terstützt werden („Assisted Migration“). (Zimmer und Helfer 2016, Brockerhoff lichkeit zur Anpassung an klimatische
Die natürlichen Waldgesellschaften et al. 2017). Thompson et al. (2009) Veränderungen durch eine hohe geneti-
sollten demnach als das Fundament kommen zu dem Schluss, dass die Resili- sche Vielfalt gegeben ist. Mit dem Lan-
betrachtet werden, auf dem man Wald- enz des Ökosystems Wald entscheidend desjagdgesetz von 2015 wurden in NRW
baustrategien für die Anpassung der von drei Faktoren abhängt: der Diversi- rechtliche Rahmenbedingungen ge-
Wälder an den Klimawandel entwi- tät der Arten, der genetischen Diversität schaffen, die eine jagdliche Regulierung
ckelt. Aktuelle Waldbau- und Wieder- innerhalb der Art und dem regionalen der Schalenwildbestände erleichtern.
bewaldungskonzepte (MULNV 2018, Pool an Arten und Ökosystemen. Diese wurden mit der Novellierung des
MULNV 2020) orientieren sich strikt Gesetzes in 2018 noch weiter verbessert.
an den Wald-Standortfaktoren, jedoch Der Einfluss des Wildes
kaum an der Artenausstattung natürli- Natürliche Wälder und Schalen-
cher Wälder. Diese Wälder – mit einem Der Einfluss des widerkäuenden Scha- wild in NRW
Anteil von nur noch 7,5% – wachsen lenwildes auf die natürliche Verjüngung
nicht nur in Wildnisentwicklungsgebie- der Wälder ist derzeit charakterisiert 2013 wurden im Landeswald NRW etwa
ten, Naturwaldzellen oder im National- durch die Entmischung des Baumarten- 7.800 ha Wald als sogenannte Wild-
park, in denen Sie weitestgehend von spektrums und durch den Verbiss von nisentwicklungsgebiete ausgewiesen.
der Bewirtschaftung und aktiver Verän- vitalen Individuen (Ammer et al. 2011). Ziel ist es, dass sich auf insgesamt über
derung geschützt sind, sondern häufig Dies kann im Extremfall zum vollständi- 16.000 Hektar (rund 11 %) der staat-
in Wäldern ohne besonderen Schutz- gen Ausfall der natürlichen Verjüngung lichen Waldflächen (Wildnisentwick-
status. Den größten Flächenanteil der führen. Aber auch die gezielte Selektion lungsgebiete, Kernzone Nationalpark
natürlichen Wälder in NRW nimmt der von Baum- und Straucharten, die stark Eifel, 75 Naturwaldzellen) ein „Urwald
Hainsimsen-Buchenwald ein, wovon reduzierte Stückzahl in der Naturver- von morgen durch natürliche Entwick-
große Teile regulär bewirtschaftet wer- jüngung (und damit die Minderung der lung“ einstellt (LANUV 2021). Das
den dürfen, also keinem besonderen genetischen Vielfalt) sowie der Verbiss entspricht einem Anteil von 1,7% der
Schutz unterliegen. Diese sind durch der vitalsten Individuen vermindern die 935.000 Hektar Waldfläche in NRW.
die Bepflanzung mit Arten, die nicht der Resistenz und Resilienz unserer Wälder. Diese Wälder müssen sich natürlich
natürlichen Waldgesellschaft entspre- Mit dem Verschwinden einer Baumart verjüngen, um überhaupt fortbestehen
chen oder gar „empfohlener, eingeführ- entsteht ein umso größerer nachhaltiger zu können und um genetisch variabel
ter Baumarten“ wie Riesenlebensbaum Schaden, da eine ganze Kaskade an wei- zu bleiben. Seit geraumer Zeit, spätes-
oder Atlaszeder gefährdet (Bild 1). teren Änderungen in der Artzusammen- tens mit dem enormen Anwachsen der
setzung der Biozönose in Gang gesetzt Schalenwildbestände in diesem Jahr-
Die Anpassung unserer Wälder an den wird, da die Tier- und Pflanzenarten, die tausend (vgl. Heute 2015), ist nicht
Klimawandel ist eine komplexe Aufga- an diese Baumart gebunden sind, mit ihr nur die Verjüngung im Wirtschaftswald
be. Einfache Lösungen (Austausch von verschwinden. So kann z.B. der Ulmen- gefährdet: Auch die natürlichen Wälder
werden akut durch den massiven Ein-
Bild 1: Küstentannen und Douglasien wurden auf einer Kalamitätsfläche im Sauer- fluss des wiederkäuenden Schalenwilds
land gepflanzt. Ohne Puffer zum angrenzenden, naturnahen Hainsimsen-Buchen- gefährdet (Bild 2). Im Landeswald wur-
wald. (Fotos © F. C. Heute) de daher – mit reichlicher Verspätung
– im Jahr 2014 ein Schadensmonitoring
eingerichtet. Flächendeckende Verbiss-
gutachten werden erst seit 2017 vorge-
nommen. Bis Ende 2019 wurde von den
Landesförstern aber erst in weniger als
10% der über 8000 Jagdreviere in NRW
eine Verbissaufnahme durchgeführt.
Konkrete Ergebnisse zum Grad der Ent-
mischung der Vegetation bzw. zur Voll-
ständigkeit des Artenspektrums sind von
den Verbissgutachten allerdings nicht
zu erwarten. Die Methodik der Verbiss-
aufnahmen sieht keine konkreten Aus-
sagen zum Grad der Entmischung vor.
Erkenntnisse zur Entmischung könnten
nur durch Weisergatter/ Kontrollzäune
gewonnen werden, von denen es in den
meisten Jagdrevieren aber keine gibt
und das landesweite Monitoring nur auf
die geringe Waldfläche des Staatswaldes
beschränkt ist.
Im vergangenen Jahrzehnt wurden
trotzdem immer mehr Beispiele be-ÖKOJAGD 2 – 2021 Das Wald-Jagd-Problem 43
men-Auwälder mit großen Beständen
an Flatterulmen. Wie bundesweit leiden
die Eschen derzeit stark unter den Fol-
gen des Eschentriebsterbens. Gerade
für die Resistenzbildung der Eschen ist
eine natürliche Verjüngung mit hoher
Stückzahl aber ganz entscheidend. Ca.
1-5 % der Eschen verfügen über eine
genetische Resistenz gegen das Eschen-
triebsterben (Rigling et al. 2016). Eine
natürliche Verjüngung mit hoher Stück-
zahl wäre also die ideale Voraussetzung,
damit sich über die Rekombination der
Gene neue Resistenzen entwickeln kön-
nen und somit die Esche als Waldbaum-
art gestärkt wird bzw. erhalten bleibt.
Auch die Rote Liste Art Flatterulme, die
mit über 2.000 alten Bäumen in der
Davert kartiert ist und sich resistent ge-
Bild 2: Schleichende Verfichtung eines Eichenwaldes auf Hainsimsen-Buchenwald-
Standort im Bergischen Land genüber dem Ulmensterben zeigt, kann
sich seit vielen Jahren nicht natürlich
kannt, in denen Wälder wissenschaftlich träge aus Luft und angrenzender Land- verjüngen. Dabei hat die Flatterulme
untersucht wurden – alle mit dem Er- wirtschaft) haben die Standortbedin- das Potenzial, die absterbende Esche auf
gebnis: Die Wälder verjüngen sich nicht gungen des Waldes seit 1972 jedoch den feuchten Standorten zu ersetzen.
mehr natürlich. Vier Beispiele: verändert. Neben diesen veränderten In dem kompletten Waldgebiet, dessen
Standortbedingungen verhindert das besondere Bedeutung durch den euro-
Rehwild eine natürliche Verjüngung der päischen Schutz anerkannt ist, kann sich
Naturwaldzellen in NRW
typischen Gehölzvegetation. Nur weni- derzeit aber weder Eiche, Esche noch
In einer Arbeit zur Naturwaldforschung ger als 20 Jungbäume pro Hektar schaf- Flatterulme natürlich verjüngen, da das
in NRW konnte Striepen (2013) zeigen, fen es, „aus dem Äser“ zu wachsen. 1954 ausgesetzte Damwild in Kombi-
dass Schalenwild die Waldgesellschaften Unter den vorherrschenden trockeneren nation mit dem vorhandenen Rehwild-
in 75 % der 48 untersuchten natürlichen Bedingungen ist für Auen – neben der bestand die natürliche Verjüngung der
Wälder in den Naturwaldzellen, verteilt Etablierung der Stiel-Eiche – mit dem Baumarten fast vollständig verhindert.
über ganz NRW, signifikant beeinflusst. Auftreten der weniger überflutungsto- Und auch bei den anderen natürlicher-
In den artenreichen Buchenwäldern leranten Arten Winterlinde und Hainbu- weise hier vorkommenden (und in der
wachsen innerhalb der wilddichten Zäu- che zu rechnen. Doch die Arten verjün- Baumschicht auch zu findenden) Baum-
ne durchschnittlich neun Gehölzarten, gen sich nicht. Bereits heute zeigt sich arten sieht es nicht viel besser aus:
unter Schalenwildeinwirkung nur zwei daher eine Waldentwicklung, die vom Hainbuche, Vogelkirsche, Feldahorn
Arten. „In den Buchenwäldern unter- ursprünglichen Hartholz-Auwald hin zu (in Eichen-Hainbuchenwäldern), Trau-
stützen überhöhte Schalenwilddichten einem brennesselreichen Ahorn-Eschen- beneiche (bodensaure Eichenwälder),
die absolute Dominanz der Buche in der wald führt. Das seit einigen Jahren stark Rotbuche, Sandbirke, Eberesche, Aspe,
Naturverjüngung und fördern langfristig zunehmende Schwarzwild verhindert Salweide, Bergahorn (Buchenwälder)
eine Verarmung des Folgebestandes hin zudem „eine dauerhafte, wirksame Zäu- sowie Erle (Feuchtwälder) verjüngen
zum Buchen-Reinbestand. (...) Auch aus nung (…), so dass sich in Verbindung sich (fast) nicht.
naturschutzfachlicher Sicht ist die Ent- mit dem hohen Rehwildbestand auch
mischung als äußerst problematisch zu im Zaun keine auenwaldtypische Na- Mennekes-Wildnis Heiligenborn
bewerten, da die natürliche Vermehrung turverjüngung mehr entwickeln kann“
seltener und gefährdeter Baumarten, (Dölle et al., 2016). In dem 2014 ausgewiesenen Wildnis-
wie z. B. Elsbeere, Eibe oder Feldahorn, gebiet Heiligenborn des privaten Stif-
verhindert wird“ (ebd.). In den sauren ters und Naturschützers Dieter Men-
Davert
und mäßig basenversorgten Buchen- nekes (†2020) im Siegerland wurde
wäldern werden die Begleitbaum- Auch am Beispiel der Davert zeigt sich, die Jagd über Jahrzehnte herkömmlich
arten Eberesche und Bergahorn kom- welche Auswirkungen bzw. Störun- ausgeübt. Das Revier liegt in dem gro-
plett heraus selektiert. Nur die Fichte gen von hohen Schalenwildbeständen ßen Rotwild-Verbreitungsgebiet Sie-
kann dem „Äser entwachsen“. ausgehen können. Die Davert ist ein gerland-Wittgenstein-Hochsauerland,
großer Waldkomplex südlich der Stadt das gerade hier im Siegerländischen
Münster in Westfalen. Seit 2001 stehen regelmäßig Dichten von zehn Hirschen
NWZ „Kerpener Bruch“
über 2.220 Hektar der Davert unter pro 100 Hektar überschreitet. In dem
Die Naturwaldzelle „Kerpener Bruch“ Naturschutz, als FFH-(Fauna-Flora-Ha- Wildnisgebiet soll in einer Initialphase
in der Erftaue (südwestlich von Köln) ist bitat-) und als EU-Vogelschutzgebiet. – nach dem Willen des Stifters und den
eine ehemals überflutete Hartholzaue Die großen zusammenhängenden Ei- Vorgaben des Landes – ein vollständi-
mit Schwarzerle, Stieleiche, Esche und chen-Hainbuchenwälder auf feuchten ges, standorttypisches Waldökosystem
Ulme, in der seit 1972 keine Nutzung Standorten sind die größten ihrer Art im geschaffen und damit ein artenreicher
mehr stattfindet. Der Erhalt dieses Au- ganzen nordwesteuropäischen Raum. „Urwald von morgen“ entwickelt wer-
walds ist zentrales Schutzziel des Na- Sie verzahnen sich mit alten bodensau- den (Heute 2020). Die großflächigen
turschutz- und FFH-Gebietes (LANUV ren Eichen- und Buchen-Eichenwäldern. „Kyrill- Windwurfflächen sollen der „na-
2013). Grundwasserabsenkung (Braun- Dazwischen liegen sumpfige Erlen- oder türlichen Wiederbewaldung überlassen
kohletagebau, Trinkwassergewinnung Birkenbrüche. Eine Besonderheit der Da- werden“ (LANUV 2020). Doch im Heili-
Köln) und Eutrophierung (Stickstoffein- vert sind artenreiche Eichen-Eschen-Ul- genborner Wald findet keine Verjüngung44 Das Wald-Jagd-Problem ÖKOJAGD 2 – 2021
von Wäldern – besonders Quantität bezogen auf die
auf Kyrillflächen und allen Gesamtwaldfläche massiv
Flächen, die von Fichten unterscheiden. Bezogen auf
befreit wurden – statt. Die den Klimawandel besteht
Verjüngung der Buchenwäl- der Wert einer kompletten
der funktioniert nur mit der natürlichen Verjüngung vor
Hauptbaumart Buche, kei- allem in der stillen Reserve,
ne einzige Begleitbaumart die jederzeit und auf ganzer
verjüngt sich. Diese fallen Fläche in der Lage ist, die
der Entmischung des Rot- Funktionen des Altwaldes
und Rehwildes zum Opfer. im Fall einer Kalamität oder
Im Gebiet wurden 2014 Nutzung zu übernehmen.
Schälquoten von 98% bei Dies kann durch Gatterung
der Fichte (19% Neuschä- von kleinen Teilflächen nie
le) und 54% bei der Buche erreicht werden. Eine kom-
(5% Neuschäle) festgestellt plette, flächendeckende
(LWuH 2014) und zählte Naturverjüngung ist daher
damit zu den am stärksten natürlicher, wertvoller und
beeinträchtigten Revieren Bild 3: Auf wechselfeuchten bis nassen, sauren Standorten wie günstiger als jedes Gatter
in NRW. Eine Entwicklung hier bildet sich natürlicherweise ein Moorbirkenbruch aus. im Wald. Mittlerweile zei-
des Gebietes gemäß der Das Rotwild in der Eifel verhindert die Wiederbegründung des gen bundesweit etliche
definierten Schutzziele wird Bruchwaldes (nach Kyrill) und lenkt die Sukzession in Richtung Beispiele, dass es möglich
es erst geben, wenn der Pfeifengras-Fichten-Fläche. ist, durch eine konsequent
Einfluss des widerkäuenden umgesetzte Bejagungsstra-
Schalenwildes signifikant gesenkt wird. lich entsprechend angepasst werden. tegie die Zielsetzung zu erreichen und
Ansonsten müsste die zweite Möglich- eine artenreiche Verjüngung gemäß der
Was tun? keit angewendet werden, um artenrei- potentiell natürlichen Vegetation zu er-
che Wälder zu gründen: Der Bau wild- möglichen (Heute 2017, Heute 2019,
Doch wie kann sich ein „Urwald“ (ge- dichter Zäune. Vor allem in den letzten Straubinger 2016, ANW 2021).
nauso wie der „klimastabile“ Wirt- Resten unserer natürlichen Wälder, um
schaftswald), wie von Politik und Ge- deren Erhalt zu sichern. Zumindest eine Fazit
sellschaft gefordert, entwickeln, der sich Generation muss hinter Zaun über Äser-
nicht natürlich, also in seiner komplet- höhe aufwachsen. Denn die Artenvielfalt Die Entwicklung der natürlichen Wald-
ten Artenvielfalt, verjüngt? Es gibt zwei im Wald kann nur mit dem Erhalt der gesellschaften mit einer vollständigen
Möglichkeiten, von der seit einigen diversen natürlichen Waldgesellschaften Ausprägung des dazugehörigen Arten-
Jahren eine im Mittelpunkt steht: Es gilt funktionieren. Ziel muss nach wie vor spektrums kann nur erfolgen, wenn die
die offizielle Devise, die Schalenwildbe- sein, dass durch Jagd angepasste Scha- Bestände des wiederkäuenden Schalen-
stände mit jagdlichen Mitteln an den lenwildbestände die teure Gatterung wilds auf ein verträgliches Maß reduziert
Lebensraum Wald anzupassen – wozu von Teilflächen überflüssig machen. Es oder durch wilddichte Zäune ausge-
insbesondere die Förster im Staatswald darf jedoch auf keinen Fall unberück- schlossen werden. Das verträgliche Maß
beauftragt sind (Wiebe 2016). Das Bun- sichtigt bleiben, dass die beiden aufge- darf sich ausschließlich darüber definie-
desjagdgesetz wird derzeit zum ersten zeigten Alternativen sich in Qualität und ren, ob eine natürliche Verjüngung aller
Mal seit 1977 gründlich no- Baumarten in hoher Stück-
velliert, v.a. um „den Schutz zahl möglich ist.
des Waldes“ vor dem Reh- Bild 4: Ziel ist es, dass auf den ehemaligen Orkanflächen stand- Das Ziel Nordrhein-West-
ortgerechte, stabile, strukturreiche und produktive Wälder
wild zu verbessern (BMEL entstehen“ (LWuH 2016) Dazu sollten etwa 2000 Laubbäume
falens, auf 16.000 Hektar
2020). Die Erkenntnis, diverser Arten einer Generation in der Naturverjüngung dem natürliche „Urwälder von
dass eine weitere klassische Äser entwachsen, damit eine stabile Wiederbewaldung gesi- morgen“ zu entwickeln und
Wildbewirtschaftung und chert ist. Nach neun Jahren im April 2016 nimmt diese Fläche gleichzeitig die Wälder an
Hegejagd dringend been- hingegen eine Entwicklung zu einer Fichten-Gras-„Steppe“. den zu erwartenden Klima-
det werden muss und nur Hochsauerland 2016. wandel anzupassen, ist illu-
die Anpassung der Wildbe- sorisch, solange die Wälder
stände an den Wald erfolg- an einer kompletten Verjün-
reich sein wird, hat sich in gung gehindert werden. Bei
der Politik durchgesetzt. fortbestehendem Verbiss-
Nach reiflichem Prozess. druck durch Schalenwild
Denn die Probleme sind werden ganze Generatio-
seit Jahrzehnten bekannt. nen von Verjüngungsjahr-
Doch nach wie vor schei- gängen dem Wild geopfert.
tern seit Jahren Forstämter Solange die Schalenwild-
und Eigenjagdbesitzer in bestände nicht an den Le-
etlichen Regionen an einer bensraum angepasst sind,
effektiven Anpassung der werden die letzten Reste
Reh- und Hirschbestände unserer natürlichen Wälder
und damit dem Erreichen von Rehen und Hirschen
der Waldziele (Bild 3). Über- durch Entmischung schlei-
all dort, wo die Jagd offen- chend in ihrer Artenzusam-
sichtlich nicht funktioniert, mensetzung verändert und
muss die Jagdstrategie end- verarmt. Wenn man dieÖKOJAGD 2 – 2021 Das Wald-Jagd-Problem 45
negative Entwicklung verschiedener Literatur Rösner, Ch., Rogge, M., Dertz, W. (2019):
Baumarten (Esche, Ulme) in den letzten Ammer, C., Torsten Vor, T., Knoke, T., Wag- Verjüngung der Wälder nach Kalamität. In:
AFZ/Der Wald 21/2019. S. 36 – 39
Jahrzehnten beobachtet, wird jedoch ner, S. (2011): Der Wald-Wild-Konflikt.
Ibisch, P. (2020): Ökologischer Zustand und
deutlich, dass es sich hierbei nicht um Analyse und Lösungsansätze vor dem
Hintergrund rechtlicher, ökologischer und Umbau der Wälder zur Förderung von Kli-
ein Luxusproblem des Naturschutzes ökonomischer Zusammenhänge. Gutach- maresilienz und Biodiversität. Schriftliche
handelt. Gesundheit und Fortbestand ten. Göttinger Forstwissenschaften, Band 5 Stellungnahme als Einzelsachverständiger
unserer Wälder sind von gesamtgesell- ANW (Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße zur 89. Sitzung des Ausschusses für Um-
Waldwirtschaft)(2021): http://biowildpro- welt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
schaftlicher Bedeutung und werden des Deutschen Bundestages, Mittwoch 25.
durch Verbiss und Entmischung nega- jekt.de/projekte/kurzportraits/
AWG (Bayerisches Amt für Waldgenetik) November 2020.
tiv beeinträchtigt. Die Tragweite die- (2021): AQUAREL – Anpassung der Trau- IPCC Climate Change Working Group I
ses negativen Einflusses lässt sich nicht beneiche auf Reliktstandorte. https://www. (2007): The Physical Science Basis: 6.5.1.3
in letzter Konsequenz abschätzen. Es awg.bayern.de/215989/ Was Any Part of the Current Interglacial Pe-
BfN (Bundesamt für Naturschutz)(2018): riod Warmer than the Late 20th Century?
ist jedoch unzweifelhaft, dass dadurch Kasielke, T. (2014): Spätquartäre Landschafts-
sowohl die Resistenz als auch die Resi- https://neobiota.bfn.de/grundlagen/oeko-
logische-grundlagen.html; aufgerufen am entwicklung im oberen Emscherland. Dis-
lienz der Wälder nachteilig beeinflusst 23.2.2018 sertation. Ruhr-Univerität Bochum
werden. Um großflächige Gatterungen BMEL (Bundesministerium für Ernährung und Kowarik, I. (2016): Das Konzept der poten-
tiellen natürlichen Vegetation (PNV) und
zu vermeiden, muss sich die Jagd den Landwirtschaft)(2020): Pressemitteilung Nr.
seine Bedeutung für Naturschutz und
geänderten Anforderungen stellen und 220/2020 vom 4.11.2020. Klöckner: Wir
führen das Jagdrecht in die Zukunft und Landschaftspflege. In: Natur- und Land-
zielorientierte Jagdkonzepte in den Re- schützen unseren Wald. Kabinett stimmt schaft.9-10/2016. S. 429-435
vieren – bzw. Wildmanagementkonzep- Novellierung des Bundesjagdgesetzes zu Küster, H. (1998): Geschichte des Waldes.
te in Schutzgebieten – konsequent um- Bußler, H. (2007): ...und immer wieder kleine Von der Urzeit bis zur Gegenwart.
Sensationen. LWF aktuell 58, S. 35-37 LANUV (Landesanstalt für Natur-, Umwelt-
setzen. Die Konzepte müssen sich dabei und Verbraucherschutz NRW)(2013): Natu-
an den (wenigen) bewährten Strategien Brockerhoff, E.G., Barbaro, L., Castagneyrol,
B. et al. (2017): Forest biodiversity, ecosys- ra 2000 – Gebiete in Nordrhein-Westfalen
der erfolgreichen Betriebe bzw. Reviere tem functioning and the provision of eco- LANUV (Landesanstalt für Natur-, Umwelt-
orientieren. system services. Biodiversity and Conser- und Verbraucherschutz NRW)(2020):
vation 26 (13), S. 3005-3035 https://doi. http://wildnis.naturschutzinformationen.
org/10.1007/s10531-017-1453-2 nrw.de/wildnis/de/gebiete/wildniswald/
Danescu, A., Albrecht, A. T., Bauhus, J. WG-HWI-0001
(2016): Structural diversity promotes pro- LANUV (2021): https://www.lanuv.nrw.de/
wildoekologie-heute natur/biodiversitaetsmonitoring/wildnis-
ductivity of mixed, uneven-aged forests
in southwestern Germany. Oecologia 182 gebietsmonitoring/
Frank Christian Heute, selbständiger Liang, J., Crowther, T.W., Picard, N. et al.
Diplom-Landschaftsökologe, befasst (2); S. 319-333
Deter, A. (2021): Eichen mit urzeitlicher DNA (2016) Positive biodiversity-productivity
sich mit aktuellen Konfliktfeldern trotzen Trockenheit. In: topagrar-online, relationship predominant in global forests.
zwischen Wildbiologie und Jagd. Seit 25.2.2021 Science, 354, aaf8957.
LWuH (Landesbetrieb Wald und Holz)(2014):
Oktober 2012 betreibt er mit seinem Dölle, M., Heinrichs, S., Schulte, U., Schmidt,
Schälschadeninventur in der DMW Heili-
Kollegen, dem Botaniker und Orni- W. (2016): Vom Auenwald zum Sau-
enwald. Vegetationsentwicklung in der genborn. Bericht der Ergebnisse der Erstin-
thologen Jens Elmer, die Seite http:// Naturwaldzelle „Kerpener Bruch“ (Nord- ventur. Unveröffentlicht
www.wildoekologie-heute.de. rhein-Westfalen). In: Natur und Landschaft Müller, J. (2004): Wie beeinflußt Forstwirt-
Frank C. Heute und Jens Elmer 4/2016. S. 161-169 schaft die Biodiversität in Wäldern? Eine
Fischer, A.; Walentowski, H. (2017): Natur- Analyse anhand der xylobionten Käfer. In:
erstellen ökologische Gutachten auf Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik:
Basis ihrer Lebensraumkartierungen waldreservate schützen Biodiversität. On-
line-Artikel v. 14.9.2017 (https://www. 7:1-8, Bamberg
(Biotoptypen, Vegetation, Tiere, waldwissen.net/wald/naturschutz/lwf_bio- MUNLV (Ministerium für Umwelt, Landwirt-
Gewässerstrukturgüte, Verbiss). Ein diversitaet_nwr/index_DE) schaft, Natur und Verbraucherschutz des
besonderer Schwerpunkt der Arbeit Landes Nordrhein-Westfalen)(2020): Wie-
Gertz, M. (2016): Verbissmonitoring in NRW.
derbewaldungskonzept Nordrhein-West-
liegt auf dem Erstellen von Jagdkon- Verbissgutachten nach §22 LJG. November
falen. Empfehlungen für eine nachhaltige
zepten für Naturschutzgebiete, wie 2016 (http://www.waldbauernverband.
Walderneuerung auf Kalamitätsflächen
de/2010/cms/upload/pdf-dateien/161115_
den Kernzonen der Biosphärenre- Gertz_Vortrag_Verbissgutachaten_freigege-
MUNLV (Ministerium für Umwelt, Land-
servate. Bei allen Arbeiten sind stets wirtschaft, Natur und Verbraucherschutz
ben.pdf; aufgerufen am 23.2.2018)
des Landes Nordrhein-Westfalen)(2018):
die Ökologie des Lebensraumes, die Hacker, H., Müller, J. (2006): Die Schmetter-
Waldbaukonzept Nordrhein-Westfalen.
Berücksichtigung aller Nutzungs- linge der bayerischen Naturwaldreservate.
Empfehlungen für eine nachhaltige Wald-
Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik
interessen sowie die gesellschaft- bewirtschaftung
– Supplementband 1. Arbeitsgemeinschaft
liche Akzeptanz maßgebend. Das Rigling, D.; Hilfiker, S.; Schöbel, C.; Meier,
Bayerischer Entomologen e.V.
Netzwerk Vorbildliche Rehwildre- F.; Engesser, R.; Scheidegger, C.; Stofer,
Heute , F.C. (2015): Vom Einfluss des Jägers
S.; Senn-Irlet, B.; Queloz, V. (2016): Das
viere wurde 2018 im Rahmen des und des Schalenwilds auf den Wald von
Eschentriebsterben. Biologie, Krankheits-
Jagdabgabe-Forschungsprojektes morgen – Wald und Wild in NRW. In: ÖKO-
symptome und Handlungsempfehlungen.
JAGD 4/2015; S. 11-18
„Nachhaltige Rehbejagung“ ge- Heute, F.C. (2017): 10 Jahre nach Kyrill. Die
Merkbl. Prax. 57: 8 S
gründet. Schulte, U. (2005): Biologische Vielfalt in
Windwurfflächen in Nordrhein-Westfalen
Auf der Homepage werden ei- nordrhein-westfälischen Naturwaldzellen.
zeigen den ökologischen Zustand der Wald-
In: LÖBF-Mitteilungen 3/05. S. 43-48
nige aktuelle Konfliktthemen verjüngung. In: ÖKOJAGD 1/2017. S. 5-11
Straubinger, F. (2016): Mit zielführender Jagd
herausgestellt und aus ökologi- Heute (2019): Das Projekt Nachhaltige Reh-
zu ökonomischer und ökologischer Diver-
bejagung. Teil 2: Netzwerk Vorbildliche
scher Sicht durchleuchtet, z.B. Rehwildreviere. In: ÖKOJAGD 4/19. S. 11-13
sität. Vortrag beim NABU NRW- Workshop
die Wald-Wild-Problematik, Jagd „Der Wald-Wild-Konflikt – wieviel Wild
Heute (2020a): Wildmanagementkonzept für
verträgt der Wald“. Düsseldorf, 17.2.2016
in Schutzgebieten, Schwarzwild/ das Wildnisentwicklungsgebiet Heiligen-
(https://nrw.nabu.de/natur-und-land-
Kirrung oder Landwirtschaft und borner Wald – Dieter Mennekes-Wildnis.
schaft/waelder/waldundwild/21520.html;
Unveröffentlicht
Niederwild. Aktuelles zum Thema aufgerufen am 23.2.2018)
Heute (2020): Jagdruhezonen in Wildnisge-
Jagdpolitik, Einblicke in das eigene Striepen, Klaus (2013): Wechselbeziehungen
bieten – Möglichkeiten und Grenzen. In:
Forschungsrevier sowie ein umfang- zwischen Schalenwild und Vegetation. Na-
BfN-Skripten 557/2020. Wildnis im Dialog.
turwaldforschung in Nordrhein-Westfalen.
reicher Downloadbereich runden Aktuelle Beiträge zur Wildnisentwicklung
In: AFZ/ Der Wald 3/2013, S. 16-1
die Seite ab. in Deutschland. S. 95-106
Thompson, I., Mackey, B., McNulty, S., Mos-
Hosius, B., Leinemann, l., Hewicker, H. A.,46 Das Wald-Jagd-Problem ÖKOJAGD 2 – 2021 seler, A. (2009). Forest Resilience, Biodi- monitoring NRW Biotopmonitoring shop „Der Wald-Wild-Konflikt – wie viel Wild versity, and Climate Change. A synthesis (BM). Erfahrungen mit seltenen Waldle- verträgt der Wald?“. Düsseldorf, 17.2.2016 of the biodiversity/resilience/stability rela- bensraumtypen. Statusseminar Natur- (https://nrw.nabu.de/natur-und-land- tionship in forest ecosystems. Secretariat schutz-Monitoring in Deutschland. Vilm, schaft/waelder/waldundwild/21520.html; of the Convention on Biological Diversity, 14.-18. April 2008 (http://www.bfn.de/ aufgerufen am 23.2.2018) Montreal. Technical Series no. 43, 67 pages fileadmin/MDB/documents/themen/mo- Zimmer, M., Helfer, V. (2016): Biodiversität, Welle, T., Sturm, K., Bohr, Y. (2017): Ausge- nitoringintern2/Werking_Radtke_Wald_ Ökosystemprozesse und Ökosystemleis- wählte Ergebnisse einer Analyse zur Re- NRW.pdf; aufgerufen am 23.2.2018) tungen. In: Lozan et al. (2016) Warnsignal präsentativität der Waldgesellschaften in Wiebe, A. (2016): Lösungsversuche zum Klima: Die Biodiversität. Wissenschaftliche Deutschland. Naturwald Akademie. Lübeck Wald-Wild-Konflikt im Staatswald Nord- Auswertungen, Hamburg. (www.warnsignal- Werking-Radtke, J. (2008): Biodiversitäts- rhein-Westfalen. Vortrag beim NABU Work- klima.de)
Sie können auch lesen