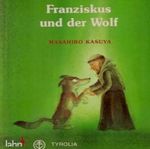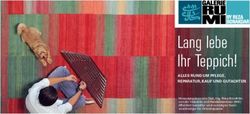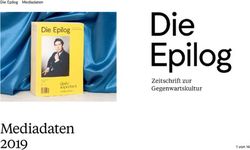DER MIT DEM BÄR KÄMPFT UND DEM WOLF TANZT - Land Tirol
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
[Wissenswertes 2. Quartal 2022]
DER MIT DEM BÄR KÄMPFT UND DEM WOLF TANZT…
Kulturgeschichtliche Einblicke über den Umgang mit Beutegreifern
von Petra Streng
In der medialen Berichterstattung sind sie beinahe Tagesthema: Der Bär und der Wolf. Natur- und
Kulturwelten treffen aufeinander. Es sind sogenannte Problemtiere, die Almbauern, Behörden und selbst
die EU beschäftigen: Schlagwörter wie Herdenschutz und zu erhaltende Einheit von Berg(idylle) und
Lebensraum für Tiere sind die zum Teil sehr emotional gehaltenen Grundlagen von Diskussionen.
Der kulturelle Umgang mit Bär und Wolf ist eine andere Geschichte und hat Spuren in der Volksmedizin,
im Volksglauben, in der mündlichen Überlieferung und nicht zuletzt bei Bräuchen hinterlassen. Spannung
ist bei allen diesen Facetten allemal garantiert.
Da ist einmal der Bär, der über
Jahrhunderte das Bedrohliche der
tierischen Natur repräsentierte. Man
bewunderte vorrangig seine Stärke –
und respektierte diese. Nicht umsonst
findet sich in vielen Wappen und
Emblemen das Motiv des Bären. So
soll im übertragenen Sinne die Stärke
und Macht des Tieres auf ein
Geschlecht oder einen Ort quasi
übertragen werden. Viele Sprichwörter und Redensarten zeugen von der
Omnipräsenz des Bären – die inhaltliche Bandbreite ist reich. Neben der
Schwerfälligkeit (Tapsigkeit) des Tieres, die Belustigung hervorruft kommt
u.a. auch die sogenannte Bärenliebe nicht zu kurz. Zurückzuführen ist
letztgenannte Umstand auf die Fürsorge der Bärenmutter, die ihre Kinder geradezu zärtlich ableckt und für
sie sorgt. Daher ist wohl auch der Weg vom Ungetüm zum drolligen und kuscheligen Teddybären zu
erklären.
Interessant ist die Tatsache, dass der Bär zum fixen Bestandteil bei vielen Tiroler Fasnachten geworden
ist. Bei den Umzügen und Auftritten versuchen die Bären ihren Treibern zu entkommen, sie schrecken das
Publikum und sind in ihren Kostümen mächtig, bedrohlich aber manchmal auch geradezu bärlich-herzig.
Woher kommt nun dieses Faszinosum, warum beherrschen in der Fastnacht hunderte Bären die
Gemeinden?
Vor allem in der Renaissance setzte man sich in Theaterstücken mit der
unheimlichen Natur und der (vermeintlich) gepflegten Kultur auseinander.
Wie brachte man nun diese Auseinandersetzung auf die Bühnenbretter? Das
Bedrohliche der Natur, des Waldes personalisierte man in Bären und Wilden
Leuten, deren Kleidung aus Flechtwerk, Moos oder Baumbart (Bartflechte)
besteht. Und diese wahren oder erfundenen Gestalten haben im Laufe der
Zeit dann auch Eingang in die Volkserzählung, in schauspielerischen
Aufführungen bei der breiten Bevölkerung gefunden. Und hier nicht zuletzt in
den Fasnachten. Dort wird das Auftreten des Bären mit dem Winter
gleichgesetzt – und diesen gilt es eben in Kämpfen zu bezwingen um den
Einzug des warmen Frühjahrs zu ermöglichen. Nun, dies ist eine
Interpretation die in engem Zusammenhang mit der Romantik des 19. Jahr-
hunderts und vor allem den damit verbundenen Deutungen zusammenhängt.
Es waren vor allem Anhänger der mythologischen Schule – und in späteren
Jahrzehnten – Lehrer die diese Anschauungen pflegten und in Schriften und Auslegungen weitergaben.
Von den Medien dankbar angenommen und unreflektiert übernommen – bis in die Gegenwart. Es klingt
ebenso gut: Mit dem Bär den Winter austreiben. Mit einem Augenzwinkern soll man sich hierbei einmal die
Touristiker vorstellen: Soll der Winter, der Schnee wirklich in der Fastnachtszeit (eben Jänner/Februar)
verschwinden? Was wäre dann mit den Skiwochen im wärmeren Spätwinter und zu Ostern?
www.tirol.gv.at/kunst-kultur/kulturportal/museumsportal/De facto ist es aber so, dass die Faszination des Bären in der
Fastnacht ungebrochen ist, wenn nicht sogar boomt. Es ist zudem
eine große Herausforderung an die Burschen in diesem schweren
Kostüm mit mächtiger Larve über Stunden aufzutreten – vielleicht im
psychologischen Sinne auch eine Form der Initiation. Denn im
höheren Alter will und kann man sich diesen Strapazen wohl kaum
mehr ausliefern. Im Zusammenhang mit den Fasnachten dürfen auch
nicht die Wanderhändler, allen voran die Schausteller außer Acht
gelassen werden. Denn zu ihren Attraktionen gehörten auch
dressierte, gefügige Bären, die mit ihren Tanzdarbietungen
amüsierten und unterhielten. Selbst in kleinen Orten, wo weit und
breit kein Bär lebte, konnte man sich so der bedrohlichen Natur
nähern, und die Zivilisierung „abfeiern“. Und auch von diesen
Aufführungen fand der Bär Eingang in die Fastnacht und in die
Redensarten, wie etwa „tanzen wie ein Bär“ (eben unbeholfen,
ungelenk).
Der Bärenführer hat in der Fastnacht wie auch bei den Schaustellern
die Macht über das Tier. Und dieses Machtverhältnis hat auch
Eingang in sinnbildliche Darstellungen gefunden. So erscheint etwa
der Bär mit Bärenführer in den „Emblemata moralia & bellica“ (1615)
des Jacob von Bruck: „...der Bärenführer mit Peitsche und Kette,
dessen Geschöpf nach seiner Pfeife tanzen muß, versinnbildlicht die
wohltätige Macht des Fürsten über das ohne seine Leitung zügellose
Volk“. (Röhrich, Bd.1, 146)
Um einen gewissen Machtfaktor geht es auch in Heiligenlegenden, insbesondere bei Heiligen, die einen
Bären mit ihrem Glauben zähmten und sich untertan machten. Neben den Heiligen Korbinian, Lukan von
Säben, Gallus, Magnus oder Kolumban war es in Tirol der Hl. Romedius, der einen Bären schließlich auch
als Reittier benutzte. Als Lokalpatron in Thaur wird er vielen Bildern und Fresken auf Häusern mit seinem
Attribut – dem Bären – abgebildet.
Der Bär war in früheren Zeiten schwer zu jagen bzw. zu erlegen und
dementsprechend waren seine körperlichen Bestandteile mehr als
begehrt. Als wahrlich griffiges Beispiel sei hier etwa der Bärenzahn
erwähnt, den man sich – nebst anderen tierischen Körperteilen (u.a.
Gemsenhorn) – an eine Amulett-Kette hängte. Die Kraft des Bären
sollte so auch auf den Menschen übertragen werden. Aber auch die
inneren Organe wurden für volksmedizinische Hilfe verwendet: Vom
Blut, über das Gehirn, den Klauen bis hin zum Fett. Wunderheiler,
Bauerndoktoren und Apotheker machten sich diesen Volksglauben
zu nutze. Im Gegensatz zu den Bären in der Fastnacht waren reale
Bären selten – und so behalf sich so mancher Händler auch mit
Ersatzmaterialien. So bestand so manches Bärenfett (für weibliche Gebrechen) und so manches
Bärinnenfett (für männliche Gebrechen) aus einfachem Schweinefett. Aber wo ein Glaube, war vielleicht
auch ein Weg zur Besserung…
Der Bär ist ein faszinierendes Tier – davon zeugt die Kulturgeschichte. Er ist stark, unheimlich, aber auch
lieblich-anschmiegsam (siehe Teddybär). Und vielleicht auch als mahnendes und warnendes Wesen dem
Menschen näher als man glaubt. Nachzulesen etwa bei Rudi Mayr, der in seinem Buch „Das Licht und der
Bär“ in einer Erzählung von einem wahren oder vermeintlichen Bären erzählt, der ihn vor einem Fiasko
bewahrte.
Der Wolf hat es in der Kulturgeschichte nicht so einfach wie der Bär.
Er ist verfemt, bedrohlich als Beutegreifer und selbst in Redensarten
bzw. Sprichwörtern findet man kaum ein gutes Haar an ihm. Von
einem „Teddywolf“ keine Rede. Scheinheilig soll er sein – die Brüder
Grimm mit ihren Hausmärchen lassen in Form von
„Rotkäppchen“ oder „Die sieben Geißlein“ grüßen – auch wenn der
Ausgang der Erzählungen für den Wolf nicht positiv verläuft. Und die
vermeintliche Scheinheiligkeit hat eine lange Tradition und sich
schnell verbreitet. Bekannt ist die Bezeichnung „Ein Wolf in
Schafskleidern (im Schafspelz) zunächst in der biblischen
Überlieferung geworden. Bei Matth.7,15 heißt es: „Sehet euch vor vor
www.tirol.gv.at/kunst-kultur/kulturportal/museumsportal/den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig sind sie reißende Wölfe“. (Röhrich, Bd. 5, 1740) Und bei manchen aktuellen Diskussionen muss man einfach an das Sprichwort „man muß mit den Wölfen heulen“ denken. Und dies hat eine lange Tradition: „Bei Agricola steht: ‚Wer unter Wölfen ist, muß mitheulen“; Geiler von Kaysersberg sagt: ‚Mit den Wölfen muoß man hülen‘… und in Lohensteins Arminius heißt es 1689: ‚Wenn man mit den Wölfen heulet…, wird man allenthalben beliebt‘.“ (Röhrich, Bd. 5, 1742). Wird man mit diesen Aussagen dem Wolf gerecht – wohl kaum. De facto hat er in Bräuchen keine Spuren hinterlassen. Vielmehr wird seine Gestalt in der Volkserzählung präsent. Hier aber vor allem im slawischen Raum. Dort erzählt man von Wolfsbannern, menschlichen Personen, die Wölfe rufen können, aber auch die Macht haben, diese zurückzurufen und sie mit Segenssprüchen zu bannen. Aber es gibt noch einen Wolf, der umhergeistert, Phantasien an- und aufregt. Hierbei handelt es sich um den Werwolf, der auch ohne Hunger Menschen anfällt. Die Hintergründe für diesen besonderen Wolfsglauben sind mannigfach. So berichtet bereits im 2. Jahrhundert nach Christus Marcellus von Sida über die „Lykanthropie“. Im Prinzip geht es dabei um die Vorstellung, dass sich Menschen in Wölfe verwandeln und Schaden anrichten. Aus der heutigen medizin-psycholgischen Sicht gibt es hierfür Deutungen, die von Wahnvorstellungen, aber auch von geistigen Erkrankungen sprechen. De facto gibt es den Wolfsmenschen nicht. Da mögen viele kulturhistorischen Aspekte ihren Teil dazu beigetragen haben. Nicht zuletzt der Umstand, dass man Jahrhunderte wenn nicht noch länger daran glaubte, dass man mit einem umgehängten Tierfell auch die Stärke und Macht des Beutegreifers sich aneignete (siehe Volksmedizin). Aber auch die katholische Kirche kann mit „Wolfswundern“ aufwarten. So – der legendarischen Überlieferung nach – im Zusammenhang mit dem Tierwohltäter, dem Hl. Franziskus. Er soll bei der Stadt Gubbio einen Wolf in seinem Glauben besänftigt haben, der vorher sowohl Menschen als auch Tiere anfiel. Mit einem Kreuzzeichen beschwor er abzulassen und garantierte dem Wolf, dass er in seiner Lebenszeit keinen Hunger mehr erleiden müsse. Gleich einem Schaf (sic!) begleitete der Wolf den Heiligen in die Stadt und von da an lebte er – gleich einem dressierten Hund – mitten unter den Bewohnern ohne jedweden Schaden anzurichten. Soweit legendarische Überlieferungen, die das animalische des Wolfes manifestieren. In der Volkskunst hat der Wolf keine und wenn, wenige Spuren hinterlassen. Doch in der Volksmedizin waren seine Körperteile ebenso beliebt wie die des Bären. Für alles hatte man Verwendung: die Leber für Leberleiden oder Lungensucht, die Zunge bei Fallsucht (Epilepsie), das Herz bei Gicht, das Fett bei Gliederschmerzen etc. Ob alle Bestandteile wirklich vom Wolf stammten ist eine eigene Geschichte. Präsent ist er in Zaubersprüchen nach wie vor – vor allem in Gegenden mit einer größeren Wolfspopulation. Und manche sollte man auch mit Humor nehmen – und so heißt es: „So soll die junge Frau vor ihrem Mann nach der Trauung ins neue Heim treten und dreimal sagen: Ich bin der Wolf und du das Schaf! Dann erhält sie die Herrschaft“.“ (HDA, Bd.9, 793). Als eine sehr spannende Forschungsgeschichte erweist sich ein Projekt an der Universität Innsbruck (Institut für Sprachwissenschaft). Hier recherchiert man u.a. nach Flurnamen, die u.a. in engem Zusammenhang mit dem Wolf stehen. So etwa die Bezeichnung „Wolfsgrube“, die eine historische Fangtechnik beschreibt: „Dorfbewohner hoben gemeinsam ein bis zu fünf Meter tiefes Loch aus, das oft mit Steinen ausgelegt wurde. Mit einem Tierköder sollte der Beutegreifer angelockt werden.“ (Strobl, 2022) Und in den alten Abrechnungsbüchern des Stiftes Georgenberg-Fiecht wurden auch die Entlohnungen für den Tod von Bären und Wölfen festgehalten: „1700 erhielt etwa ein angeführter ‚Pernschütz‘ exakt 33 Kreuzer ein ‚Wolfschitz‘ 17. Kreuzer“. (Strobl, 2022) www.tirol.gv.at/kunst-kultur/kulturportal/museumsportal/
Der Wolf hat es wahrlich nicht leicht – auch kulturgeschichtlich zu bestehen. Er wurde und wird als Synonym
für „Mitläufertum“ interpretiert: siehe mit den Wölfen heulen. Erbaulich sind dabei diesbezüglich Aussagen
von J.P. Hebel in seinem Werk „Schatzkästlein des rhein. Hausfreundes“:
„… wenn man zu unvernünftigen Leuten kommt, muß man auch unvernünftig tun wie sie? Merke: Nein!
Sondern ernstlich, du sollst dich nicht unter die Wölfe mischen, sondern ihnen aus dem Weg gehen.
Zweitens, wenn du ihnen nicht entweichen kannst, so sollst du sagen: ‚Ich bin ein Mensch und kein Wolf.
Ich kann nicht so schön heulen wie ihr.‘ Drittens: Wenn du meinst, es sei nimmer anders von ihnen
loszukommen, so will dir der Hausfreund erlauben, ein- oder zweimal mitzubellen, aber du sollst nicht mit
ihnen beißen und anderer Leute Schafe fressen. Sonst kommt zuletzt der Jäger, und du wirst mit ihnen
erschossen.“ (Röhrich, Bd. 5, 1742)
Zivilisation geht nicht ohne Wildnis – auf den Umgang kommt es an. Und so darf man in der Literatur auch
nicht Rudyards Kiplings „Das Dschungelbuch“ vergessen (die Wölfe, die den Protagonisten Mogli das
Überleben sichern und aufziehen) oder Jack Londons „Ruf der Wildnis“.
Bär und Wolf verbinden miteinander in Überlieferungen, Interpretationen und Darstellungen das
Animalische, der vielleicht nicht immer unkontrollierbare Trieb zum Überleben. Treffend macht es in dieser
Hinsicht Hermann Hesse in seinem Roman „Der Steppenwolf“ klar: Auch der Mensch hat (vermeintlich)
unzivilisierte Umgangsweisen und Anschauungen – und ist damit dem Wolf oder Bär gar nicht so artfremd.
Quellen:
Bächtold-Stäubli, Hanns (Hrsg.), Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens (HDA), 10 Bde., Berlin
1986.
Hesse, Hermann, Der Steppenwolf, Berlin 1927.
Kipling, Rudyard, Das Dschungelbuch, London 1894.
London, Jack, Ruf der Wildnis, Hameln 1903.
Mayr, Rudolf Alexander, Das Licht und der Bär, Erzählungen von Bergsteigern und anderen Abwegig-
keiten, Innsbruck 2021.
Nußbaumer, Thomas, Fasnacht in Nordtirol und Südtirol, Innsbruck 2010.
Röhrich, Lutz, Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten, 5 Bde., Freiburg 1995.
Streng, Petra, Bakay Gunter, Wilde Hexen Heilige, Innsbruck 2005.
Strobl, Sabine, Auf dem Weg zur Wolfsgrube, TT-Magazin, 01.02.2022 (12-13).
Williams, Richard/ Brookesmith, Peter (Hrsg.), Bestien und Ungeheuer, Wien/Stuttgart 1993.
© Land Tirol; Dr. Petra Streng, Text
© Noaflhaus Telfs (Abb. 1); Felixé Minas Haus (Abb. 2); Fasnachtsarchiv Imst (Abb. 3); Matschgerer-
museum Absam (Abb. 4); Fasnachtsverein Fiss (Abb. 5); Land Tirol / Simone Gasser (Abb. 6)
Abbildungen:
1 - Gezähmter Bär mit Schaustellerfamilie, Holz geschnitzt, 20. Jh., Noaflhaus Telfs, InvNr. 702.
2 - Teddybär aus genähtem Leinen, mit Stroh gefüllt, um 1900. Felixé Minas Haus, InvNr 959.
3 - Imster Fastnachtsbärentanz, Tinte auf Papier, (Holzrahmen, Glas, Passepartout), Text und Musik:
Elmar Peintner zur Fasnacht 1988, Fastnachtsarchiv Imst, InvNr 395.
4 - Bärenkopf, Schaffell, Holz, Glas, lebensgroß, 20.Jh., Matschgerermuseum Absam, InvNr 170.
5 - Bärentreiber Fisser Blochziehen, 20. Jh., Fastnachtsverein Fiss.
6 - Bär mit Jagdhunden, Holzstich bemalt,19. Jh., Land Tirol, Sammlung Hans Jäger, Oetz, InvNr 1143.
7 - Der Wolf im Schafspelz, Holzschnitt, Francis Barlow; 1687.
https://de.wikipedia.org/wiki/Wolf_im_Schafspelz (Zugriff am 28.03.2022; gemeinfrei)
8 - Titelholzschnitt zu Urbanus Regius, Wie man die flaschen Propheten erkennen ia greiffen mag…,
Braunschweig 1539, (Quelle: Röhrich, Bd. 5, 1995)
9 - Der Wolfsmensch, Reproduktion des Holzschnittes von Lucas Cranach d. Ä. (1472-1553), um 1512
(privat).
10 - Buchcover, Kasuya, Masahiro: Franziskus und der Wolf, Tyrolia, 2006.
11 - Wappen von Weidenfeld, mit einem Wolf, der ein Lamm stiehlt, 1796, in: Schroeder Michael, Kleine
Wappenkunst, Frankfurt am Main 1990.
Empfohlene Zitierweise:
Streng, Petra: Der mit dem Bär kämpft und dem Wolf tanzt… Kulturgeschichtliche Einblicke über den
Umgang mit Beutegreifern. 2022. Online unter: https://www.tirol.gv.at/kunst-
kultur/kulturportal/museumsportal/ (Zugriff am: ...)
www.tirol.gv.at/kunst-kultur/kulturportal/museumsportal/Sie können auch lesen