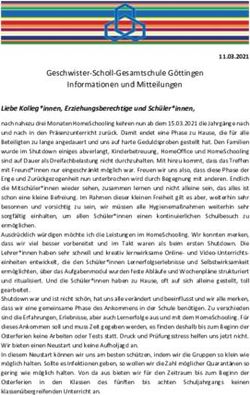Digitalisierung und Wissen - Bildungsgerechtigkeit in einer digitalisierten Welt
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Platzhalter für Bild, Bild auf Titelfolie hinter das Logo einsetzen
Digitalisierung und Wissen –
Bildungsgerechtigkeit in einer digitalisierten Welt
Vortrag im Rahmen der 7. Herbstakademie 2021 „Kommune. Bildung.
Wissen.“ der Transferagentur Kommunales Bildungsmanagement NRW
Prof. Dr. Julia Gerick
10. November 2021 (digital)Fahrplan
1. Dimensionen digitaler Spaltung und empirische Befunde
2. Digitale Medien und fachliches Lernen im Fokus von
Bildungsbenachteiligung
3. Das Konzept der Digital Equity
10.11.2021 | Prof. Dr. Julia Gerick | Digitalisierung und Bildungsbenachteiligung| Seite 2Bereiche des Lehrens und Lernens mit digitalen Medien
Vermittlung von Fertigkeiten Nutzung digitaler Medien
im Umgang mit digitalen zur Verbesserung des
Medien fachlichen Lernens
‚Learn to use ICT‘ ‚Use ICT to learn‘
Förderung des Entwicklung und
Medienkompetenzerwerbs Umsetzung neuer Formen
bzw. des Erwerbs ‚digitaler‘ des Unterrichtens mit
Kompetenzen digitalen Medien
u.a. Eickelmann & Gerick (2018)
Lernen über digitale Medien Lernen mit digitalen Medien
10.11.2021 | Prof. Dr. Julia Gerick | Digitalisierung und Bildungsbenachteiligung| Seite 3Modell zur digitalisierungsbezogenen Schulentwicklung und
Schulqualität
10.11.2021 | Prof. Dr. Julia Gerick | Digitalisierung und Bildungsbenachteiligung| Seite 4
Eickelmann & Drossel (2020)Dimensionen digitaler Spaltung und empirische Befunde
10.11.2021 | Prof. Dr. Julia Gerick | Digitalisierung und Bildungsbenachteiligung| Seite 5Dimensionen digitaler Spaltung
1. Materieller und physischer Zugang: Damit sind der Besitz von und die
Zugangsmöglichkeiten zu digitalen Geräten (wie beispielsweise Desktop-Computer,
Laptops, Tablets, Smartphones), aber auch Software sowie die Verfügbarkeit einer
Internetverbindung gemeint.
Senkbeil, Drossel, Eickelmann & Vennemann, 2019
10.11.2021 | Prof. Dr. Julia Gerick | Digitalisierung und Bildungsbenachteiligung| Seite 61. Materieller und physischer Zugang
Optimaler Zugang
Hohes Niedriges
kulturelles kulturelles
D
Teilnehmer Kapital Kapital Differenz Differenz
% (SE) % (SE) Δ% M1–M2
Uruguay 60.1 (3.5) 39.4 (1.4) 20.6 ▲
Republik Korea 55.9 (1.3) 36.4 (1.8) 19.5 ▲
2
Kasachstan 58.1 (3.3) 40.4 (1.7) 17.8 ▲
1 5
Italien 72.5 (1.6) 59.4 (1.3) 13.1 ▲
Chile 58.7 (3.3) 48.0 (2.0) 10.6 ■
Internat. Mittelwert 63.5 (0.6) 53.3 (0.4) 10.3 ▲
Luxemburg 79.7 (0.9) 71.3 (1.1) 8.3 ■
2
Portugal 84.3 (1.2) 76.1 (1.1) 8.2 ■
VG EU 66.6 (0.5) 60.3 (0.4) 6.3 ■
Keine signifikanten
Finnland 83.0 (1.4) 77.5 (1.2) 5.5 ■ herkunftsbedingten
Frankreich 78.3 (1.7) 73.2 (1.3) 5.1 ■
Deutschland 68.3 (1.5) 64.2 (1.5) 4.0 –
Unterschiede im Zugang
Moskau 80.8 (1.2) 78.2 (1.3) 2.6 ■ zu digitalen Medien in
Nordrhein-Westfalen 65.9 (1.8) 64.5 (1.8) 1.4 ■
2 9
Dänemark - - - - - –
Deutschland (2018).
4 9
USA -10 -5
-0 5 -10 - - - –
▲ Mittelwertdifferenz betragsmäßig signifikant größer als in Deutschland (pDimensionen digitaler Spaltung
1. Materieller und physischer Zugang: Damit sind der Besitz von und die
Zugangsmöglichkeiten zu digitalen Geräten (wie beispielsweise Desktop-Computer,
Laptops, Tablets, Smartphones), aber auch Software sowie die Verfügbarkeit einer
Internetverbindung gemeint.
2. Motivation: Hierunter fallen Einstellungen und Werthaltungen gegenüber digitalen Medien
sowie Motive zur deren Nutzung, etwa zur Unterhaltung, zur Informationssuche, zum
Lernen/Arbeiten oder zum sozialen Austausch.
Senkbeil, Drossel, Eickelmann & Vennemann, 2019
10.11.2021 | Prof. Dr. Julia Gerick | Digitalisierung und Bildungsbenachteiligung| Seite 8Keine signifikanten herkunftsbedingten
2. Motivation Unterschiede in Bezug auf
digitalisierungsbezogene Berufswahlneigungen
in Deutschland (2018).
Hohes kulturelles Kapital Niedriges kulturelles Kapital
1) Zu lernen, wie 2) Ich hoffe, einen 1) Zu lernen, wie 2) Ich hoffe, einen
man IT- Arbeitsplatz zu man IT- Arbeitsplatz zu
Anwendungen finden, der die Anwendungen finden, der die
nutzt, wird mir Arbeit mit nutzt, wird mir Arbeit mit
helfen, die Arbeit fortschrittlichen helfen, die Arbeit fortschrittlichen
auszuüben, die Technologien auszuüben, die Technologien
mich interessiert. beinhaltet. mich interessiert. beinhaltet.
Deutschland 50,5 % 57,1 % 48,3 % 54,3 %
International 67,6 % 49,4 % 68,2 % 52,3 %
Abb.: Digitalisierungsbezogene Berufswahlneigungen von Schülerinnen und Schülern nach
kulturellem Kapital in ICILS 2018 in Deutschland im internationalen Vergleich (Angaben der
Schülerinnen und Schüler in Prozent, zusammengefasste Kategorie Zustimmung)
10.11.2021 | Prof. Dr. Julia Gerick | Digitalisierung und Bildungsbenachteiligung| Seite 9
Senkbeil, Drossel, Eickelmann & Vennemann, 2019, S.322Dimensionen digitaler Spaltung
1. Materieller und physischer Zugang: Damit sind der Besitz von und die
Zugangsmöglichkeiten zu digitalen Geräten (wie beispielsweise Desktop-Computer,
Laptops, Tablets, Smartphones), aber auch Software sowie die Verfügbarkeit einer
Internetverbindung gemeint.
2. Motivation: Hierunter fallen Einstellungen und Werthaltungen gegenüber digitalen Medien
sowie Motive zur deren Nutzung, etwa zur Unterhaltung, zur Informationssuche, zum
Lernen/Arbeiten oder zum sozialen Austausch.
3. Nutzung: Dieser Aspekt zielt auf Häufigkeit und Dauer der Nutzung digitaler Medien sowie
auf die Vielfalt der Anwendungen (z. B. Office-Programme, Internetbrowser, E-Mail-
Programme, Chats und Foren).
Senkbeil, Drossel, Eickelmann & Vennemann, 2019
10.11.2021 | Prof. Dr. Julia Gerick | Digitalisierung und Bildungsbenachteiligung| Seite 10Herkunftsbedingte Unterschiede zugunsten der
3. Nutzung Schüler*innen mit hohem kulturellem Kapital
bei der Nutzung außerhalb der Schule für
andere Zwecke (2018).
Hohes kulturelles Kapital Niedriges kulturelles Kapital
In der Schule Außerhalb Außerhalb In der Schule Außerhalb Außerhalb
für der der für der der
schulbezogene Schule für Schule für schulbezogene Schule für Schule für
Zwecke schul- andere Zwecke schul- andere
bezogene Zwecke bezogene Zwecke
Zwecke Zwecke
Deutschland 21,9 % 43,6 % 95,5 % 23,4 % 40,5 % 89, 2 %
International 46,3 % 56,1 % 87,9 % 43,1 % 48,6 % 80,2 %
Abb. Häufigkeit der Nutzung digitaler Medien für schulbezogene und andere Zwecke in und
außerhalb der Schule nach kulturellem Kapital in ICILS 2018 in Deutschland im
internationalen Vergleich (Angaben der Schülerinnen und Schüler, zusammengefasste
Kategorie Mindestens einmal in der Woche)
10.11.2021 | Prof. Dr. Julia Gerick | Digitalisierung und Bildungsbenachteiligung| Seite 11
Senkbeil, Drossel, Eickelmann & Vennemann, 2019, S.318Dimensionen digitaler Spaltung
1. Materieller und physischer Zugang: Damit sind der Besitz von und die
Zugangsmöglichkeiten zu digitalen Geräten (wie beispielsweise Desktop-Computer,
Laptops, Tablets, Smartphones), aber auch Software sowie die Verfügbarkeit einer
Internetverbindung gemeint.
2. Motivation: Hierunter fallen Einstellungen und Werthaltungen gegenüber digitalen Medien
sowie Motive zur deren Nutzung, etwa zur Unterhaltung, zur Informationssuche, zum
Lernen/Arbeiten oder zum sozialen Austausch.
3. Nutzung: Dieser Aspekt zielt auf Häufigkeit und Dauer der Nutzung digitaler Medien sowie
auf die Vielfalt der Anwendungen (z. B. Office-Programme, Internetbrowser, E-Mail-
Programme, Chats und Foren).
4. Digitale Kompetenzen: Damit gemeint ist ein kompetenter Umgang mit digitalen Medien,
wie er beispielsweise im Rahmen der Studie ICILS 2018 mit den computer- und
informationsbezogenen Kompetenzen gemessen wurde.
Senkbeil, Drossel, Eickelmann & Vennemann, 2019
10.11.2021 | Prof. Dr. Julia Gerick | Digitalisierung und Bildungsbenachteiligung| Seite 12Leistungsdifferenzen in den computer- und informationsbezogenen
Kompetenzen nach sozialer Herkunft (hier: kulturelles Kapital der
Familie)
Hohes Niedriges Leistungs-
Teilnehmer C
kulturelles Kapital kulturelles Kapital differenzD Leistungsdifferenz
% M1 (SE) % M2 (SE) M1–M2 (SE) M1–M2
Uruguay 13.6 510 (7.7) 86.4 443 (4.0) 67 (7.5) ▲
2
Kasachstan 13.9 446 (7.5) 86.1 387 (5.4) 59 (6.8) ■
Luxemburg 47.0 512 (1.5) 53.0 457 (1.4) 55 (2.2) ■
Deutschland 47.8 547 (3.6) 52.2 498 (4.1) 49 (5.2) – In Deutschland erneut
Frankreich
Nordrhein-Westfalen
30.8
42.5
534
548
(2.8)
(2.9)
69.2
57.5
485
499
(2.6)
(3.2)
49
49
(3.5)
(4.2)
■
■
erhebliche sozialbedingte
4
USA 32.4 551 (2.5) 67.6 505 (2.0) 46 (2.8) ■ Bildungsdisparitäten
Internat. Mittelwert 34.5 527 (1.5) 65.5 483 (1.2) 45 (1.6) ■
VG EU 39.3 534 (1.1) 60.7 494 (1.1) 40 (1.4) ■ festzustellen
Chile 13.2 512 (6.5) 86.8 471 (3.8) 40 (6.9) ■
1 5
Italien 37.2 486 (3.4) 62.8 448 (3.2) 38 (4.0) ■
Finnland 39.4 554 (3.0) 60.6 518 (3.5) 36 (3.5) ▼ 49 Leistungspunkte
Republik Korea 66.8 554 (3.5) 33.2 519 (4.6) 35 (5.4) ■
2
Portugal 33.9 537 (3.3) 66.1 507 (2.9) 30 (3.7) ▼ Differenz für Indikator
2
Dänemark
Moskau
39.1
47.1
570
560
(2.5)
(2.9)
60.9
52.9
543
540
(2.5)
(2.7)
26
21
(3.3)
(3.6)
▼
▼
kulturelles Kapital
Vergleich ICILS 2013A,C
Chile 16.6 520 (5.3) 83.4 481 (3.1) 39 (5.2) ■
6
Dänemark 40.1 563 (3.6) 59.9 531 (3.0) 33 (3.6) ■
Deutschland 48.4 550 (2.7) 51.6 505 (2.7) 45 (3.8) ■
Republik Korea 66.1 547 (2.7) 33.9 515 (3.8) 32 (3.7) ■
0 25 50 75 100
Senkbeil, Drossel, Eickelmann & Vennemann, 2019, S.312
10.11.2021 | Prof. Dr. Julia Gerick | Digitalisierung und Bildungsbenachteiligung| Seite 13Prozentuale Verteilung der Schüler*innen auf die Kompetenzstufen
der computer- und informationsbezogenen Kompetenzen nach
kulturellem Kapital in ICILS 2018 und ICILS 2013 in Deutschland
Anteil (%) der Schülerinnen und
Schüler, der mindestens diese
Kompetenzstufe erreicht
II III IV V
C
ICILS 2018 % % % %
Hohes kulturelles Kapital 13.9 44.9 32.7 95.1 81.2 36.3 3.5
Niedriges kulturelles Kapital 12.8 30.3 41.1 14.9 87.2 56.9 15.7 0.8
ICILS 2013C
Hohes kulturelles Kapital 13.4 46.5 34.3 96.8 83.4 36.9 2.6
Niedriges kulturelles Kapital 9.8 28.5 45.1 16.0 90.2 61.6 16.5 0.6
0 25 50 75 100
2018 2013
% der Schülerinnen und Schüler, die genau Kompetenzstufe I erreichen
Mehr als zwei Fünftel der
% der Schülerinnen und Schüler, die genau Kompetenzstufe II erreichen
Schüler*innen aus Familien
% der Schülerinnen und Schüler, die genau Kompetenzstufe III erreichen
% der Schülerinnen und Schüler, die genau Kompetenzstufe IV erreichen
mit niedrigem kulturellen
% der Schülerinnen und Schüler, die genau Kompetenzstufe V erreichen
Kapital erreichen lediglich
Kompetenzen auf den
unteren beiden
Kompetenzstufen.
Senkbeil, Drossel, Eickelmann & Vennemann, 2019, S.314
10.11.2021 | Prof. Dr. Julia Gerick | Digitalisierung und Bildungsbenachteiligung| Seite 14Zwischenfazit
„Aus den Befunden von ICILS 2018 lassen sich damit im Hinblick auf die
technische Ausstattung, auf digitalisierungsbezogene Einstellungen sowie auf die
Nutzungshäufigkeit digitaler Medien kaum bzw. keine herkunftsbedingten
Disparitäten feststellen. Umso frappierender sind die herkunftsbezogenen
Unterschiede allerdings ausgerechnet in Bezug auf jene computer- und
informationsbezogenen Kompetenzen, die für eine erfolgreiche Teilhabe an
einer digitalisierten Welt von hoher Bedeutung sind.“
Gerick (2021)
third-level digital divide
Ungleichheiten in den ‚Erträgen‘ aus der Internetnutzung, die innerhalb von
Personengruppen mit sehr ähnlichem Nutzungsverhalten und vergleichbarem Zugang zu
digitalen Technologien und dem Internet auftreten.
Enorme Relevanz der systematischen Förderung ‚digitaler‘ Kompetenzen
10.11.2021 | Prof. Dr. Julia Gerick | Digitalisierung und Bildungsbenachteiligung| Seite 15KMK-Strategie 2016 „Bildung in der digitalen Welt“
Kompetenzrahmen „Bildung in der digitalen Welt“ (KMK, 2016)
Sechs Bereiche
1. Suchen, Verarbeiten und Aufbewahren
2. Kommunizieren und Kooperieren
Beispiel
3. Produzieren und Präsentieren
4. Schützen und sicher Agieren
5. Problemlösen und Handeln
6. Analysieren und Reflektieren
Verfügbar unter:
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichung
en_beschluesse/2018/Strategie_Bildung_in_der_digital
en_Welt_idF._vom_07.12.2017.pdf
10.11.2021 | Prof. Dr. Julia Gerick | Digitalisierung und Bildungsbenachteiligung| Seite 16Medienkompetenzrahmen NRW
10.11.2021 | Prof. Dr. Julia Gerick | Digitalisierung und Bildungsbenachteiligung| Seite 17
https://medienkompetenzrahmen.nrw/medienkompetenzrahmen-nrw/2. Lernen mit digitalen Medien mit Fokus auf
Bildungsbenachteiligung
10.11.2021 | Prof. Dr. Julia Gerick | Digitalisierung und Bildungsbenachteiligung| Seite 18Digitale Medien und fachliches Lernen
Schaumburg, 2018, S. 39
Meta-Analysen zeigen: „Das lernförderliche Potenzial digitaler Medien wird im
Rahmen konstruktivistischer Unterrichtsmethoden eher ausgeschöpft als im
Rahmen eines lehrerzentrierten Unterrichts.“
didaktische Einbindung digitaler Medien in den Unterricht ist entscheidend für
Lerneffektivität
mit schüler*innenorientierten, problemorientierten und offenen
Unterrichtsformen können lernförderliche Potenziale digitaler Medien besser
erschlossen werden
10.11.2021 | Prof. Dr. Julia Gerick | Digitalisierung und Bildungsbenachteiligung| Seite 19Digitale Medien und fachliches Lernen
Schaumburg, 2018, S. 39
Meta-Analysen zeigen: „Das lernförderliche Potenzial digitaler Medien wird im
Rahmen konstruktivistischer Unterrichtsmethoden eher ausgeschöpft als im
Rahmen eines lehrerzentrierten Unterrichts.“
didaktische Einbindung digitaler Medien in den Unterricht ist entscheidend für
Lerneffektivität
mit schüler*innenorientierten, problemorientierten und offenen
Unterrichtsformen können lernförderliche Potenziale digitaler Medien besser
erschlossen werden
Voraussetzungsreich!
• Setzt Lernstrategien und Selbststeuerungsmaßnahmen (kognitiver,
metakognitiver, volitionaler oder verhaltensmäßiger Art) voraus, um den
Lernprozesses selbst zu steuern und zu überwachen (u.a. Hasselhorn, & Gold,
2006; Killus, 2008)
10.11.2021 | Prof. Dr. Julia Gerick | Digitalisierung und Bildungsbenachteiligung| Seite 20Digitale Medien und fachliches Lernen
Schaumburg, 2018, S. 39
Meta-Analysen zeigen: „Das lernförderliche Potenzial digitaler Medien wird im
Rahmen konstruktivistischer Unterrichtsmethoden eher ausgeschöpft als im
Rahmen eines lehrerzentrierten Unterrichts.“
mit schüler*innenorientierten, problemorientierten und offenen
Unterrichtsformen können lernförderliche Potenziale digitaler Medien besser
erschlossen werden
didaktische Einbindung digitaler Medien in den Unterricht ist entscheidend für
Lerneffektivität
„Auf die Lehrkraft kommt es an – der Einsatz digitaler Medien im Rahmen
konstruktivistischer Unterrichtsmethoden muss sorgfältig vorbereitet, begleitet
und ausgewertet werden, um das lernförderliche Potenzial auszureizen.“
(Schaumburg, 2018, S. 39)
10.11.2021 | Prof. Dr. Julia Gerick | Digitalisierung und Bildungsbenachteiligung| Seite 21Hohe Ansprüche an Lehrpersonenprofessionalisierung
Orientierungsrahmen für die Lehrerausbildung
und Lehrerfortbildung in NRW
Dimension ‚Lernen und Leisten fördern‘
Aspekt: Bildungschancen
„Die besondere Relevanz von Medienkompetenz
für Bildungsprozesse und das lebenslange Lernen
erkennen, reflektieren und für Schule und
Unterricht im Hinblick auf bestmögliche
Bildungschancen für alle Schülerinnen und Schüler
verantwortungsvoll gestalten.“
MSB, 2020
https://www.medienberatung.schulministerium.nrw.de/_Medienberatung-
NRW/Publikationen/Lehrkraefte_Digitalisierte_Welt_2020.pdf
10.11.2021 | Prof. Dr. Julia Gerick | Digitalisierung und Bildungsbenachteiligung| Seite 22Zwischenfazit
Der Einsatz digitaler Medien ist nicht per se lernförderlich.
Es kommt auf die didaktische Einbettung an.
In konstruktivistischen Settings, in schüler*innenorientierten, problemorientierten
und offenen Unterrichtsformen liegen besondere Potenziale.
Aber: Voraussetzungsreich für Schüler*innen und Lehrpersonen!
Besondere Relevanz der systematischen Förderung von Lernstrategien
und Kompetenzen zum selbstgesteuerten Lernen, damit alle
Schüler*innen diese Potenziale ausschöpfen können (u.a. Fischer et al., 2020)
10.11.2021 | Prof. Dr. Julia Gerick | Digitalisierung und Bildungsbenachteiligung| Seite 233. Das Konzept der Digital Equity
10.11.2021 | Prof. Dr. Julia Gerick | Digitalisierung und Bildungsbenachteiligung| Seite 24Digital Equity
1. Zugang zu Hardware, Software und IT-Infrastruktur
Internetanbindung
2. Zugang zu sinnvollen, qualitativ hochwertigen und Digitale Lehr-
kulturell relevanten Inhalten Lernmaterialien
3. Zugang zur Erstellung, Verbreitung und zum Digitale Plattformen
Austausch digitaler Inhalte
4. Zugang zu Lehrkräften, die wissen, wie man mit
Professionalisierung
digitalen Werkzeugen und Ressourcen umgeht.
5. Zugang zu hochwertiger Forschung über die
Anwendung digitaler Technologien zur Transfer
Verbesserung des Lernens
10.11.2021 | Prof. Dr. Julia Gerick | Digitalisierung und Bildungsbenachteiligung| Seite 25
Gerick & Schwippert, 2019 in Anlehnung an Resta et al., 2018Zum Weiterlesen
Eickelmann, B. & Gerick, J. (2020). Lernen mit digitalen Medien. Zielsetzungen in Zeiten von
Corona und unter besonderer Berücksichtigung von sozialen Ungleichheiten. In
Fickermann, D. & Edelstein, B. (Hrsg.), "Langsam vermisse ich die Schule...". Schule
während und nach der Corona Pandemie. DDS – Die Deutsche Schule, 16. Beiheft, 153–
162. Verfügbar unter:
https://www.waxmann.com/?eID=texte&pdf=4231OpenAccess09.pdf&typ=zusatztext
Gerick, J. (2021). Bildungsgerechtigkeit in einer digitalisierten Welt - Herkunftsbedingte
Unterschiede und Perspektiven für Schule und Unterricht. Beitrag im Rahmen des
Dossiers „Digitale Schule: Lektionen aus der Pandemie“. Berlin: Heinrich Böll Stiftung.
Verfügbar unter: https://www.boell.de/de/2021/04/15/bildungsgerechtigkeit-in-einer-
digitalisierten-welt
10.11.2021 | Prof. Dr. Julia Gerick | Digitalisierung und Bildungsbenachteiligung| Seite 26Zentrale Literatur
Eickelmann, B., Bos, W., Gerick, J., Goldhammer, F., Schaumburg, H., Schwippert, K., Senkbeil, M. & Vahrenhold, J.
(Hrsg.) (2019). ICILS 2018 #Deutschland – Computer- und informationsbezogene Kompetenzen von Schülerinnen und
Schülern im zweiten internationalen Vergleich und Kompetenzen im Bereich Computational Thinking. Münster:
Waxmann. Verfügbar unter: https://kw.uni-
paderborn.de/fileadmin/fakultaet/Institute/erziehungswissenschaft/Schulpaedagogik/ICILS_2018__Deutschland_Bericht
sband.pdf
Eickelmann, B. & Drossel, K. (2020). Digitalisierung im deutschen Bildungssystem im Kontext des Schulreformdiskurses. In
N. Berkemeyer, W. Bos & B. Hermstein (Hrsg.), Schulreform – Zugänge, Gegenstände, Trends (S. 445–458). Beltz
Verlag: Weinheim.
Eickelmann, B. & Gerick, J. (2018). Herausforderungen und Zielsetzungen im Kontext der Digitalisierung von Schule und
Unterricht. Teil 1: Vier Bereiche des Lernens mit digitalen Medien. SchulVerwaltung NRW, 29 (2), 47–50.
Gerick, J. & Schwippert, K. (2019). Potenziale digitaler Medien für die Reduzierung von Bildungsbenachteiligungen in der
Grundschule – Theoretische Bezüge, empirische Befunde und zukünftige Forschungsperspektiven. In E. Inckemann, T.
Trautmann & R. Sigel (Hrsg.), Chancengerechtigkeit durch Schul- und Unterrichtsentwicklung an Grundschulen –
Konzeptionelles, Konkretes und Anschauliches (S.195-212). Klinkhardt.
Fischer, C. Fischer-Ontrup, C., & Schuster, C. (2020). Individuelle Förderung und selbstreguliertes Lernen Bedingungen und
Optionen für das Lehren und Lernen in Präsenz und auf Distanz. Die Deutsche Schule, Beiheft 16, 136-152.
Schaumburg, H. (2018). Empirische Befunde zur Wirksamkeit unterschiedlicher Konzepte des digital unterstützten Lernens.
In: N. McElvany, F. Schwabe, W. Bos, H. G. Holtappels (Hrsg.), Digitalisierung in der schulischen Bildung - Chancen
und Herausforderungen (S. 27-40). Münster: Waxmann.
Senkbeil, M., Drossel, K., Eickelmann, B. & Vennemann, M. (2019). Soziale Herkunft und computer- und
informationsbezogene Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern im zweiten internationalen Vergleich. In B.
Eickelmann, W. Bos, J. Gerick, F. Goldhammer, H. Schaumburg, K. Schwippert, M. Senkbeil & J. Vahrenhold (Hrsg.),
ICILS 2018 #Deutschland – Computer- und informationsbezogene Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern im
zweiten internationalen Vergleich und Kompetenzen im Bereich Computational Thinking (S. 301–333). Münster:
Waxmann.
10.11.2021 | Prof. Dr. Julia Gerick | Digitalisierung und Bildungsbenachteiligung| Seite 27Platzhalter für Bild, Bild auf Titelfolie hinter das Logo einsetzen Vielen Dank für Ihr Interesse! Prof. Dr. Julia Gerick Kontakt: j.gerick@tu-braunschweig.de
Sie können auch lesen