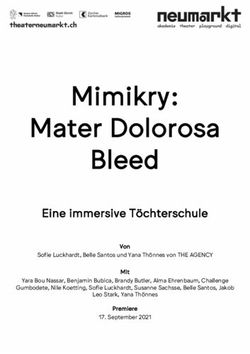Energie in der Schule - Ideen und Anregungen für den Unterricht
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
© PONTES-Agentur 2011
Energie in der Schule
Ideen und Anregungen für den Unterricht
Handreichung für Lehrkräfte der Sekundarstufe I
Inhalt
1. Energie, eine kleine Gedankenreise ................................................................................................. 2
2. Energie, eine Vielfalt an Themen ........................................................................................................ 3
3. Energie, Klammer für den fächerverbindenden Unterricht .................................................................. 5
4. Energiebildung im Landkreis Görlitz.................................................................................................. 10Energie in der Schule – Ideen und Anregungen für den Unterricht
1. Energie, eine kleine Gedankenreise
Zwei Fragen zum Einstieg:
(1) Was ist Energie für Sie?
Welche Themen, Schlagworte oder Bilder verbinden Sie mit dem Thema Energie? In welchen
Zusammenhängen wird aktuell das Thema Energie in der Gesellschaft diskutiert? Bitte füllen Sie den
nachfolgenden „Denkkasten“ (vgl. Tab. 1) aus.
Tab. 1: Energie ist …, ein Gedankenspiel zum weiteren Ausfüllen
... Sonne ... ...
... ... ... ...
... ... ... ...
... ... elektrischer Strom ...
... ... ... ...
Kraft ... ... …
… … … Krabat
Mit diesen Fächern wird das Thema Energie in der Regel verbunden:
• Physik
• Chemie
• Biologie
• Geographie
• Technik und Computer
• Wirtschaft, Technik, Haushalt/Soziales
(2) Fallen Ihnen weitere Fächer ein? (Vorschläge auf S. 11)
• ...
• Deutsch
• ...
• evangelische/katholische Religion
• ...
• ...
• Sport
• …
• …
• …
Inwieweit sich diese nicht-naturwissenschaftlichen Fächer eignen, um das Thema Energie zu
behandeln, zeigt Ihnen u. a. ein Beispiel für den fächerverbindenden Unterricht auf Seite 7.
2Energie in der Schule – Ideen und Anregungen für den Unterricht
Ein weiterer Gedankenstopp:
Energie ist weit mehr als Strom aus der Steckdose. Energie ist vielfältig. Energie besitzt eine Vielfalt
an …
• … Themen.
• … Kompetenzen, die ich mir durch Beschäftigung damit aneignen kann.
• … Methoden zur didaktischen Vermittlung.
• … Ergebnissen und Produkten, die aus einem Projekt hervorgehen können.
• … Lernorten.
2. Energie, eine Vielfalt an Themen
Energie ist ein weites Feld, das sich schwer auf wenige Themen oder Assoziationen beschränken
lässt (vgl. Abb. 1). Physikalisch betrachtet, bedeutet Energie die Fähigkeit Arbeit zu verrichten. Das ist
die nüchterne Definition. Quergedacht ist Energie, wenn ich eine Tafel Schokolade um einen Meter
bewege. Schaffe ich das innerhalb einer Sekunde, habe ich eine Leistung von einem Watt vollbracht.
Darüber hinaus existiert eine weitere Definition, eine philosophische Definition: Energie ist eine Art
treibende Kraft, die etwas Gedachtem, einer Idee sozusagen, zur Wirklichkeit verhilft.
© PONTES-Agentur 2011
Abb. 1: Themenwirrwarr Energie (Quelle: PONTES-Agentur 2011)
Um den „Gesteinsbrocken“ Energie anschaulich zu untergliedern, kann Ihnen z. B. die Frage nach
dem Blickwinkel helfen.
• Aus welchem Blickwinkel heraus kann ich mich dem Thema Energie nähern?
• In welche übergeordneten Themenbereiche kann ich das Thema Energie einordnen?
Energie aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet:
Beispielhaft erläutern Fragen, Arbeitsaufträge, aber auch regionale Beispiele die jeweiligen
Blickwinkel.
Mensch und Natur
• Aneignung von Natur bzw. Landschaftsnutzung durch den Menschen
• Was? Wann? Wo? Wie? Wer? … Was ist durch wen entstanden und wann?
Beispiele:
• Wie und wann entstanden die sächsischen Waldheiden im Norden des Landkreises
Görlitz?
• Der Olbersdorfer See, die Entwicklungsgeschichte vom Tagebau zum
Naherholungsgebiet recherchieren und in einem Plakat abbilden.
3Energie in der Schule – Ideen und Anregungen für den Unterricht
der biologische Blick
• Welche Arten (Fauna/Flora) leben in den durch menschliche Nutzung entstandenen
Lebensräumen?
• Beobachtung von Prozessen: Was passiert mit einem aufgelassenen Tagebau?
Beispiele:
•
1
Die Rutschung .P am Berzdorfer See
• Pflanzengesellschaften: Wann „wanderte“ welche Pflanzengesellschaft z. B. auf den
Kippen und Halden des Berzdorfer Sees ein?
Politik und Gesellschaft
• Welche Gesetze fördern die Anwendung von erneuerbaren Energieträgern?
• Wie hoch ist die gesellschaftliche Akzeptanz von erneuerbaren Energieträgern?
Beispiel:
• Energiepolitik des Landkreises Görlitz
der geschichtliche Blick
• Energienutzung in der Vergangenheit
• Landnutzungsgeschichte und Landschaftswandel
Beispiel:
• Raseneisenerzverhüttung im nördlichen Teil des Landkreises Görlitz
Technik und Medien
• Umwandlung von Energie sowie Versorgung mit elektrischem Strom
• Wie kann Energie gespeichert werden?
Beispiel:
• Aufgaben der verschiedenen Stadtwerke inklusive Betriebsbesichtigung
der physikalische Blick
• Energiequellen
• Thermodynamik
Beispiel:
• das Energietechnische Kabinett der Hochschule Zittau/Görlitz
Regionalentwicklung/Regionalplanung
• Wer entscheidet, wo Windkraftanlagen aufgestellt werden können?
• Wie plane ich Entwicklung, z. B. Tagebaufolgelandschaften?
Beispiel:
•
2
Sanierungsrahmenpläne im Landkreis Görlitz
1
Die Böschungen von im Abbau befindlichen oder stillgelegten Tagebauen können sehr instabil sein. Auch die
Böschungen des Tagebaus Berzdorf gerieten in der Vergangenheit immer wieder ins Rutschen. Die größte
Rutschung am Berzdorfer See - mit insgesamt 100 Mill. m³ bewegten Erdmassen - war die Rutschung P (vgl.
Naturschutz am Berzdorfer See, URL: www.info-berzdorfer-see.eu/naturschutz.htm [06.08.2011]).
2
Für die Braunkohlegebiete in Sachsen werden durch die jeweiligen regionalen Planungsverbände für jeden
Tagebau ein Braunkohlenplan und für stillzulegende oder stillgelegte Tagebaue ein Sanierungsrahmenplan
aufgestellt. Inhalte dieser Pläne sind u. a.: Angaben zu Grenzen des Abbaus und der
Grundwasserbeeinflussung, Haldenflächen, Oberflächengestaltung, Wiedernutzbarmachung,
Landschaftsentwicklung (vgl. Landesentwicklung Sachsen URL:
www.landesentwicklung.sachsen.de/2385.htm [06.08.2011]).
4Energie in der Schule – Ideen und Anregungen für den Unterricht
Nachhaltigkeit
• bewusster Umgang mit den Ressourcen
• Blick über den Tellerrand: Wirkung des eigenen Verhaltens auf Mensch und Umwelt in der
Region und in anderen Ländern
Beispiel:
• der Landkreis Görlitz, erster Landkreis in Ostdeutschland, der sich erfolgreich am
European Energy Award®, einem europäischen Zertifizierungsverfahren zur Bewertung
der Umweltorientierung und des Energieeinsatzes von Kommunen, beteiligt – was macht
der Landkreis?
der literarische Blick
• Wie wird das Phänomen Energie und Umwelt bzw. Energienutzung in Romanen und
Gedichten verarbeitet/reflektiert?
Beispiele:
• Brigitte Reimann: Franziska Linkerhand, Aufbau-Verlag; Otfried Preußler: Krabat, dtv-
Verlag; Christa Wolf: Störfall, Suhrkamp Taschenbuch
der künstlerische/landschaftsästhetische Blick
Beispiele:
• Licht-Klang-Festival transNATURALE am Bärwalder See (seit 2005)
• Internationale Bauausstellung (IBA) Fürst-Pückler-Land (2002-2010) und deren Objekte
• Sächsische Landesgartenschau Löbau von April bis Oktober 2012
Die sächsischen Lehrpläne schlagen für die Themenfindung im Rahmen des fächerverbindenden
Unterrichts eine ähnliche Vorgehensweise vor. Näheres dazu lesen Sie dazu im Kapitel 3.
3. Energie, Klammer für den fächerverbindenden Unterricht
Durch die Vielfalt der Blickwinkel und Inhalte ist das Thema Energie gut für das fächerverbindende
Arbeiten, aber auch für Kooperationen mit außerschulischen Lernorten geeignet.
Die sächsischen Lehrpläne geben für jede Schulart einen groben Rahmen für den fächerverbindenden
Unterricht vor. Diese Art des Unterrichts setzt ein Thema als Verbindungselement voraus, wobei das
Thema Teil des Lehrplans eines oder mehrerer Fächer sein kann. Auch Fächer, die das Auswahlthema
3
nicht erfassen, lassen sich in das fächerverbindende Arbeiten integrieren. Wie das möglich ist, zeigt
das Beispiel auf der folgenden Seite. Anhand des Themas Wasserkraftnutzung wird dargestellt, wie
dieses als verbindende Klammer sowohl in natur- als auch geisteswissenschaftlichen
Unterrichtsfächern behandelt werden kann.
Wie finde ich ein Thema für das fächerverbindende Arbeiten?
Auf der vorangegangenen Seite wurde bereits erläutert, wie Sie anhand verschiedener Blickwinkel das
Phänomen Energie in überschaubare Themen untergliedern können. Analog gehen die sächsischen
Lehrpläne vor, welche zwei Orientierungspunkte (=Bezugspunkte) für die Themenfindung benennen.
Das sind (a) der Blickwinkel bzw. die Perspektive, aus denen heraus Grundfragen des menschlichen
4
Lebens beantwortet werden und (b) thematische Bereiche.
Perspektiven/Blickwinkel in den sächsischen Lehrplänen
• Raum und Zeit
• Sprache und Denken
• Individualität und Sozialität
• Natur und Kultur
3
vgl. Sächsisches Staatsministerium für Kultus (2009): Lehrplan Mittelschule, Physik, www.sachsen-macht-
schule.de/apps/lehrplandb/downloads/lehrplaene/lp_ms_physik_2009.pdf (02.08.2011)
4
wie Anm. 3
5Energie in der Schule – Ideen und Anregungen für den Unterricht
Das Thema Energie mit seinen Unterthemen kann aus allen vier genannten Blickwinkeln heraus
betrachtet werden, wobei sich die Perspektiven Natur und Kultur sowie Raum und Zeit am besten für
den Schulunterricht eignen. Zudem lässt sich das Thema Energie aus den bereits genannten
Blickwinkeln auf den Seiten 3 und 4 beleuchten. Ähnliches gilt für die Themenbereiche. Aufgrund
seiner Bandbreite lässt sich das Phänomen Energie in alle genannten Themenbereiche einordnen
(vgl. Tab. 2).
Tab. 2: Themenbereiche in den sächsischen Lehrplänen
Arbeit Gerechtigkeit
Beruf Eine Welt
Kommunikation Verhältnis der Generationen
Technik Gesundheit
Medien Umwelt
Kunst Wirtschaft
Verkehr
Das Beispiel Wasserkraftnutzung
Am Beispiel des Themas Wasserkraftnutzung wird nachfolgend dargelegt, inwiefern sich dieses für
einen fächerverbindenden (Energie-)Unterricht eignet. In Form einer Matrix werden in Tabelle 3
mögliche Unterrichtsfächer und dazugehörige Lernbereiche, Lernthemen, Lernziele sowie mögliche
Ergebnisse aufgeführt.
Thema: Wasserkraftnutzung
Themenbereiche: Hier bieten sich mehrere Themenbereiche an. Diese sind Wirtschaft, Technik,
Umwelt, Arbeit und Beruf.
Perspektive: Natur und Kultur
Schulart und Klassenstufe: Mittelschule, Klassenstufe 7
Anwendung: im Verlauf eines Schuljahres mehrwöchiger fächerverbindender Unterricht; Auch eine
Projektwoche bietet sich an, wobei hier zu prüfen ist, ob alle sieben Beispielfächer in Frage kommen.
6Tab. 3: Fächerverbindender Unterricht am Beispiel des Themas Wasserkraftnutzung (eine Auswahl)
Physik Wirtschaft Biologie Geschichte Deutsch Kunst Ethik
Technik
Haushalt/Soziales
Lernbereich Energie/Umwelt/ Fertigung von Ökologische Fortschritt und Gewusst wie Collagen Konflikte/
(Auswahl) Mensch materiellen Gütern Grundlagen/ Stagnation in Ursachen/
Vielfalt von Wirtschaft und Bewältigung
Lebensräumen/ Gesellschaft
Wechselwirkung
von Umwelt-
Wasser- und Betriebserkundung faktoren
Wahlpflicht
Windräder
Lernthema Energie, Produkt- und Der Bach als Industrielle Erschließen von Künstlerische Kennenlernen von
Energieformen und Werkstoffkunde Lebensraum Revolution im Fachliteratur und Interpretationen Richtlinien und
lt. Lehrplan
-träger 19. Jahrhundert Sachtexten Umweltgesetzen
z. B. EUWRRL 5,
SächsWG 6
Nutzung von
Wahlpflicht SächsNatSchG 7
Wasser als
regenerativer
Energieträger
Themenbezug/ vgl. Lernthema Wasserturbinen Wasserbau und Geschichtliche Heimatkundliche Naturbeobachtung
seine Wirkung auf Entwicklung des Literatur zum oder -darstellung,
Unterthema
den Lebensraum Mühlenwesens in Mühlenwesen oder Nutzungskonflikt
Ort B Sagen Wasserkraft
5
Europäische Wasserrahmenrichtlinie
6
Sächsisches Wassergesetz
7
Sächsisches Naturschutzgesetz
7Physik Wirtschaft Biologie Geschichte Deutsch Kunst Ethik
Technik
Haushalt/Soziales
Lernziele Notwendigkeit und Wasserturbinen: Kenntnisse über Einblicke in den Beherrschen von Kennenlernen von Verständnis für
Möglichkeiten der Arten und deren gewässertypische Prozess der Lesetechniken und Darstellungs- Interessenkonflikte
Nutzung von Anwendung, Lebensräume Industrialisierung, Strategien der formen, Künstlern am Bsp. Durch-
Wasserkraft z. B. Kennenlernen der sowie deren Arten Kennenlernen Texterschließung und Materialien gängigkeit von
durch Turbinen Hersteller geschichtlicher Flüssen
Quellen
Kompetenz- Physikalische Grundkenntnisse Biologische Aneignung von Verstehendes Individuelle Ethisches
ziele Phänomene ökonomischen Phänomene Arbeitsmethoden Lesen und Ausdrucks- und Reflexions- und
erschließen, Handelns, erschließen, wie Auswertung Wiedergabe von Gestaltungsfähig- Urteilsvermögen,
Naturwissenschaft- Kennenlernen harter Wechselwirkung von Bildquellen, Textinhalten mit keiten entwickeln eigene Meinung
liche Denk- und und weicher zwischen Mensch Erkennen zeitlicher eigenen Worten, bilden und
Arbeitsweisen Standortfaktoren und Natur erkennen Zusammenhänge Sprachverständnis Argumentieren,
entwickeln, Finden von
Lösen von Kompromissen
Problemen
Material und verschiedene Bildmaterial, Bestimmung der Bilder, Grafiken, Heimatkundliche verschiedene Umweltgesetze,
Methoden Modelle und Imagebroschüren Gewässergüte mit heimatkundliche Veröffentlichungen/ Materialien Experten und
Materialien, verschiedener Hilfe von Literatur Besuch eines Vertreter von
Wasserräder selbst Unternehmen, Zeigerarten Heimatmuseums Interessengruppen
bauen, Historische (Saprobienindex) Tabellen, einladen,
Experimente zum Abbildungen,
8Physik Wirtschaft Biologie Geschichte Deutsch Kunst Ethik
Technik
Haushalt/Soziales
Wasserdruck und Modelle, Diagramme Rollen- oder
zur Kraftübertragung Werksbesichtigung Bewertung der Planspiele
Durchgängigkeit 8
eines Stauwehres
Lernort Klassenzimmer, Klassenzimmer, Klassenzimmer, Klassenzimmer Klassenzimmer, Klassenzimmer Klassenzimmer,
Gewässer Gewässer Gewässer Museum Museum Gewässer
Unternehmen
Ergebnisse selbst gebaute z. B. in Kombination Artenlisten, Zeitstrahl, der die Schülerkurzvortrag großformatige thematische Karte
Anschauungs- mit Kunst Collagen thematische Karte Entwicklung des oder Collage, die z. B. Stauwehre am
modelle z. B. Gewässergüte Mühlenwesens im eigener Text z. B. eine Konflikt- Gewässer A
oder Durch- Ort B abbildet, über die Mühlen situation abbildet mit
gängigkeit eines thematische Karte des Ortes B Erläuterungen, z. B.
Flusses Mühlenentwicklung welche Stauwehre
im 19. Jahrhundert verbleiben und
welche abge-
brochen werden
sollten
8
Können Fische und Arten des Makrozoobenthos das Stauwehr überwinden?
94. Energiebildung im Landkreis Görlitz
Insbesondere der Landkreis Görlitz und seine Nachbarregionen Niederschlesien und Böhmen bieten
sehr viele Möglichkeiten, sich im Schulunterricht mit dem Thema Energie aus verschiedenen Blick-
winkeln zu beschäftigen. Dafür sprechen verschiedene Gründe und Standortfaktoren (Auswahl):
4.1 Landschaftsgeschichte der Region
4.1.1 Energienutzung der vorindustriellen Zeit
• Bis in die vorindustrielle Zeit war der Mensch für die Verrichtung von Arbeit auf seine eigene
Muskelkraft oder die von Tieren angewiesen. Werkzeuge, aber auch die Ausnutzung der
Energiequellen Wind und Wasser erleichterten ihm die Arbeit. Im gesamten Landkreis gibt es
verschiedene Museen, Wind- und Wassermühlen und andere historische Anlagen, die die
Energienutzung der vorindustriellen Zeit bezeugen. Aber nicht nur Gebäude erzählen
Geschichten über die Vergangenheit. Auch Lebensräume wie Teiche, die sächsischen
Waldheiden, Steinbrüche oder Mühlgräben sind Zeugen der vorindustriellen Landnutzung und
damit auch Zeugen der Energienutzung. Folgende Beispiele bringen Ihnen die historische
Land- und Energienutzung näher. Darüber hinaus gibt es viele weitere Möglichkeiten, Spuren
der Landnutzungsgeschichte im Landkreis Görlitz zu entdecken.
• Handwerk- & Gewerbemuseum Sagar
• Birk- und Bertholdmühle in Oderwitz
• Steinbrüche und Granitabbaumuseum in den Königshainer Bergen
• Mühlensteinbrüche in Jonsdorf: Ein Lehrpfad, angelegt vom Naturschutzzentrum
„Zittauer Gebirge“ gGmbH, erläutert die Nutzungsgeschichte.
• historisches Sägewerk im IBZ St. Marienthal
• Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft
4.1.2 Energiewirtschaft der DDR
• Die Braunkohleförderung sowie ihre Verstromung, aber auch die Braunkohleveredelung war
in der Vergangenheit der Motor für die wirtschaftliche Entwicklung der Region. Dieser
Industriezweig schuf viele Arbeitsplätze mit guter Bezahlung und hohem sozialen Status. In
der heutigen Hochschule Zittau/Görlitz wurden z. B. die Kraftwerks- und andere „Energie-
Ingenieure“ ausgebildet.
• Industrie-Denkmale und weitere Zeugen der historischen Braunkohleförderung und
-verstromung wie stillgelegte Braunkohlekraftwerke, Schaufelradbagger, Tagebauseen, aufge-
forstete Kippen und Halden und Rudimente devastierter Dörfer sind in der gesamten Region
verstreut erlebbar.
• Das „Schwarze Dreieck“: Andererseits brachte die Braunkohleförderung und -verstromung
massive Schäden für Mensch, Natur und Bausubstanz. In den 1980er Jahren wurde aus
diesem Grund der Begriff „Schwarzes Dreieck“ geprägt, der die starke Umweltverschmutzung
in der Grenzregion zwischen DDR, VR Polen und ČSSR mit zwei treffenden Wörtern
zusammenfasste.
• Die Ausstellung „Anspruch und Wirklichkeit – Energie- und Umweltpolitik der DDR zwischen
1949 und 1989“, eine von der Umweltbibliothek Großhennersdorf e. V. konzipierte Wander-
ausstellung.
• Die „Lernstraße Energie“: Dahinter verbirgt sich ein Verbund aus elf Lernorten in Polen und
im Landkreis Görlitz, die sich zu einer pädagogisch und touristisch erfahrbaren Straße zusam-
mengeschlossen haben. Sowohl die Geschichte der Energienutzung in der Neißeregion als
9
auch ihre Zukunft wird in verschiedenen Lernorten beleuchtet.
9
Weitere Informationen dazu unter www.lernstrasse-energie.de sowie in der Broschüre „Schul-Energie-Tage im
Landkreis Görlitz“.
104.2 Energiewirtschaft in Gegenwart und Zukunft
• Der Landkreis Görlitz nimmt seit November 2008 am European Energy Award® teil und stellt
sich damit praxisbezogen den Zielen des Klimaschutzes sowie den aktuellen Herausforde-
rungen der Energiewirtschaft.
• Auch in der Zukunft wird die Energiewirtschaft - insbesondere die Nutzung von erneuerbaren
Energieträgern - einen Schwerpunkt für die wirtschaftliche Entwicklung des Landkreises
Görlitz bilden.
• erneuerbare Energieträger und ihre Nutzung im Landkreis Görlitz (Auswahl)
• Biomasse z. B. in Biogasanlagen oder Biomasseheizkraftwerken
• Wind in Windkraftanlagen
• Sonne in Solarthermie- und Photovoltaikanlagen
• Wasser z. B. in Kleinwasserkraftanlagen
• aktiver Braunkohletagebau in der Region Weißwasser/O.L. sowie Braunkohlekraftwerk
Boxberg/O.L.
• geplanter Abbau der Kupfervorkommen in der Oberlausitz
In der Broschüre „Schul-Energie-Tage im Landkreis Görlitz“, herausgegeben vom Landkreis Görlitz,
finden Sie weitere Anregungen zum Energielernen an Ihrer Schule. Die Broschüre gibt Ihnen einen
Überblick über interessante Online-Portale zum Thema Energie und Klimaschutz sowie Unterrichts-
materialien und stellt verschiedene Projektbeispiele vor. Einen besonderen Schwerpunkt legt diese
Broschüre auf regionalspezifische Angebote. In Form von Kurzporträts werden außerschulische
Energie-Lernorte zwischen Bad Muskau und Zittau vorgestellt.
Lösungsvorschläge für Frage Nr. 2 auf S. 2
• Deutsch
• Geschichte
• Ethik
• evangelische und katholische Religion
• Kunst
• Musik
• Sport
• Fremdsprachen
• ...
11Sie können auch lesen