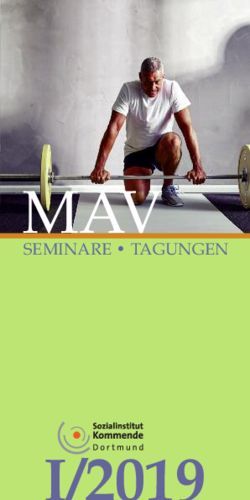Evidence-based Social Work Practice. Ein Impuls zu mehr und zu anderer Fachlichkeit
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Evidence-based Social Work Practice.
Ein Impuls zu mehr und zu anderer Fachlichkeit
Prof. Dr. Roland Schmidt (Berlin/Erfurt)1
Vorbemerkung
Soziale Arbeit, zumindest im Kontext des Gesundheitswesens und der Langzeitpflege, wird
allmählich am Rande in die Entwicklung einer Evidence-based Practice (EbP) einbezogenen.
Zum einen wird derzeit mit dem Thema „Aspekte persönlicher Lebensführung und Teilhabe
von Heimbewohnern“ hierzulande erstmals ein wissenschaftlich-professionelles Qualitätsni-
veau (= nationaler Standard) erarbeitet, in dessen multidisziplinären Ansatz Soziale Arbeit
einbezogen ist. Zum anderen wird die Methode einer EbP in der Sozialen Arbeit in den USA
bereits rezipiert und angewandt. Mein Beitrag stellt beide Entwicklungen vor und skizziert
abschließend deren mögliche Bedeutung für mehr und andere Fachlichkeit in der Sozialen
Arbeit.
Im Kontext von EbP sind zu unterscheiden: die Erstellung wissenschaftlich begründeter
Standards, die übergreifende Gültigkeit auf Zeit beanspruchen, auf der Makro-Ebene von
Praxis (= nationale Standards) und die qualitative Weiterentwicklung der Praxis Sozialer Ar-
beit in der unmittelbaren Interaktion mit Klienten (Mikro-Ebene) oder auf der betrieblich-
organisatorischen Ebene der Erbringung Sozialer Dienstleistungen (Meso-Ebene).
Man kann den englischen Begriff „Evidence“ nicht mit „Evidenz“ im Deutschen gleichsetzen.
Evidence im englischen Sprachraum bedeutet eine Aussage, die belegt bzw. bewiesen ist.
Der im deutschen Sprachraum eingeführte Begriff Evidenz hingegen meint nach Duden eine
einleuchtende Erkenntnis oder auch eine überwiegende Gewissheit. Um also Missverständ-
nisse zu vermeiden, werde ich im Nachfolgenden überwiegend von „Evidence“ sprechen, es
sei denn es handelt sich um eingeführte Fachbegriffe wie Evidenzbasierte Leitlinien.
Verantwortung der Professionen
Gesetzliche Krankenversicherung (SGB V) und Soziale Pflegeversicherung (SGB XI) ver-
pflichten Leistungserbringer und Leistungsträger zur Einhaltung von „Standards“ der Leis-
tungserbringung. In zentralen Normen beider Sozialversicherungszweige, aber auch im Be-
rufsrecht der Kranken- und Altenpflege, wird vorgegeben, dass zur Bestimmung der Leistun-
gen und Leistungsverpflichtungen sowie ihrer Qualität der „allgemein anerkannte Stand der
(...) Erkenntnisse“ zu Grunde zu legen ist:
• im SGB XI („medizinisch-pflegerischen Erkenntnisse“): § 11 Abs. 1 Satz 1, 28 Abs. 3 und
§ 69 Satz 1 und
• im SGB V § 2 Abs. 1 Satz 3 und § 70 Abs. 1 („medizinischen Erkenntnisse“) sowie § 135a
Abs. 1 Satz 2 („der jeweilige Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse“ als normative
Grundlage einer Evidenz-basierten Medizin, EbM) und
• auch das Heimgesetz greift in § 3 Abs. 1 („fachlichen Erkenntnisse“) diese Formulierung
auf.
Andere Sozialgesetzbücher - vor allem der Fürsorgebereich (SGB VIII und XII) - kennen ver-
gleichbare Verpflichtungen nicht. Hier besteht eine entscheidende Differenz zwischen den
Handlungsfeldern Sozialer Arbeit.
1
Überarbeitete und erweiterte Version. Der Beitrag erscheint in Heft 3/2006 der „Blätter der Wohlfahrtspflege“2 Die Anforderung, diesen Stand der Erkenntnisse zu definieren, richtet sich an die Professio- nen. Bei diesen Normen handelt es sich um so genannten Lege-artis-Klauseln. Es sind un- bestimmte Rechtsbegriffe, die aber gerichtlich voll überprüfbar sind (z.B. in der zivil- und strafrechtlichen Haftung). Angesichts der Wirkungsorientierung (Outcome) vor allem im Ge- sundheitswesen und in der Langzeitpflege sind wissenschaftlich-professionelle Standards auf nationaler Ebene geeignet, um die Soll-Beschaffenheit von Dienstleistungen fachlich angemessen festzulegen. Wissenschaftlich-professionellen Standards sind nicht zu ver- wechseln mit Verfahrensstandards, die z.B. im Zuge des Aufbaus eines internen Qualitäts- managements in sozialwirtschaftlichen Unternehmen entwickelt werden. Die Ausfüllung dieser Lege-artis-Klauseln mittels wissenschaftlich-professioneller Standards erfolgt im Deutschland bislang in drei Varianten: • Medizinische Leitlinien, die Ärzten als Entscheidungshilfen dienen, indem sie die nachge- wiesenermaßen wirksame Formen der Diagnostik und Behandlung beschreiben (hierzu umfassend: Kunz, Ollenschläger u.a., 2000). Es gehört zu den professionellen Aufgaben medizinischer Fachgesellschaften, Leitlinien zu entwickeln. Dies wird in breitem Umfang realisiert. Mehr als 1.000 Leitlinien stehen zur Verfügung, häufig auch konkurrierende. Aufgabe des 2004 neu gegründeten Deutschen Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit in der Medizin ist, die Güte dieser Leitlinien fachlich-methodisch zu beurteilen. Dies erfolgt im Hinblick darauf, ob die Standards des Verfahrens zur Entwicklung der Medizinischen Leitlinien eingehalten wurden (zur Methodik Europarat, 2002). • Expertenstandards in der Pflege, die ein (Mindest-) Qualitätsniveau bei bestimmten Ver- sorgungsproblemen definieren, das alle Patienten erwarten können und das nicht unter- schritten werden darf. Mit einem der bis dato vier vorliegenden Expertenstandards in der Pflege, dem Standard „Entlassungsplanung“ (DNQP, 2003; Dangl, 2004), wird im Zuge seiner Implementierung auch das Profil des Sozialdiensts im Akutkrankenhaus und in der Rehabilitationseinrichtung mit Blick auf Aufbau- und Ablauforganisation zentral berührt. • Zudem werden derzeit auf heimgesetzlicher und multidisziplinärer Grundlage für die stati- onäre Langzeitpflege drei wissenschaftlich begründete Qualitätsniveaus erarbeitet (vgl. www.buko-qs.de). Der Prozess der Entwicklung wissenschaftlich-professioneller Standards muss vier Anforde- rungen erfüllen: Transparenz, Publizität, Repräsentanz, Legitimität und Pluralität sowie Re- versibilität. Zu unterscheiden sind weiterhin • die Standardbildung selbst, • (davon getrennt) die Festsetzung von Maßstäben für die Entwicklung von Standards (= Gütekriterien des Verfahrens) und • die Festlegung von Prioritäten vor dem Hintergrund des finanziellen Aufwands der Ent- wicklung wissenschaftlich-professioneller Standards sowie • die Abschätzung des Bedarfs an Revision des Standards. Im Gegensatz zum SGB V gibt es im SGB XI keine Ermächtigung zur Umsetzung wissen- schaftlich-professioneller Standards in verbindliche, von Leistungsträger zu finanzierende „Versorgungsstandards“. Dies hat zwei Gründe: Es gibt in der Langzeitpflege keine Tradition der „gemeinsamen Selbstverwaltung“, und es existiert keine so hohe Anzahl von wissen- schaftlich-professionellen Standards (wie im Falle von Leitlinien in der Medizin), deren Güte geprüft, unter denen - auch unter Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit - auszuwählen ist und die an die Versorgungssysteme angepasst werden müssen (Bieback, 2004). Wissen- schaftlich-professionelle Standards werden auch in der Begutachtung im haftungsrechtlichen Kontext rezipiert (Hart, 2002); dies gilt bereits heute für Medizinische Leitlinien. Evidenzbasierte Leitlinien in Feldern des Gesundheitswesens Die Darlegung des „Standes der Kunst“ erfolgt national und international insbesondere durch Evidenzbasierte Leitlinien. Zentrales Dokument ist die Empfehlung Rec(2001)13 des Europa-
3 rates und Erläuterndes Memorandum. Dargelegt werden hier insbesondere die Methodik der Evidenzbasierung sowie die Definition und Zuordnung zentraler qualitätswissenschaftlicher Begriffe. Adressaten sind explizit nicht ausschließlich Ärzte in den unterschiedlichen medizi- nischen Fachdisziplinen, sondern die Gesundheitsberufe (Europarat, 2002, S. 21). Diese multidisziplinäre Perspektive wird hierzulande auch in der Medizin herausgestellt (Selbmann, Konrad, 2005, S. 4). Multidisziplinarität ist hier in der Sache begründet. Medizinische Leitli- nien z.B. im Spektrum chronischer Krankheiten müssen notwendigerweise die disziplinäre Arbeitsteiligkeit überwinden. Evidenzbasierung als Methode wird international inzwischen umfassend in Feldern des Ge- sundheitswesens im Spektrum von Prävention, Kuration Rehabilitation und Langzeitpflege rezipiert, aber auch durch verschiedene Gesundheitsprofessionen v.a. aufgegriffen (Ärzte, Gesundheits- und Krankenpfleger(in), Sozialarbeiter(in)). Mit Blick auf die Methode wird in- ternational von Evidence-based Practice (EbP) gesprochen. Bezieht man das Verfahren auf die jeweiligen Disziplinen, haben sich herausgebildet: • Evidence-based Medicine (EbM), • Evidence-based Rehabilitation (EbR), • Evidence-based Nursing (EbN) und • Evidence-based Social Work Practice (hier ohne Kürzel). Im Gesundheitswesen wird EbM mit Blick auf die klinische Praxis eingesetzt, aber auch mit Blick auf die Systemsteuerung (Makroebene: Evidenzbasierung von Gesundheitszielen). Hier unterscheidet man EbM im engeren Sinn, dann geht es darum, individuelle Patienten auf der Basis der besten zur Verfügung stehenden Daten zu versorgen, und im weiteren Sinne, dann geht es um die Beurteilung der Versorgung auf struktureller Ebene. Es handelt sich dann um evidenzbasierte Gesundheitsversorgung (Evidence-based Health Care), „bei der die Prinzipien der EbM auf alle Gesundheitsberufe und alle Bereiche der Gesundheits- versorgung angewandt werden“ (Kunz, 2005, S. XXII). Ein Beispiel für diese versorgungs- strukturelle Nutzung von EbP wurde unlängst mit Blick auf die gemeindepsychiatrische Ver- sorgung von Kallert u.a. (2005) publiziert, wobei auch die Frage nach Wirkungen von Case Management berührt wird. In der Sozialen Arbeit umfasst Evidence-based Social Work Prac- tice sowohl Evidence-based Clinical Practice als auch Evidence-based Macro Practice. Mit Blick auf die Produkte von EbP sind zu unterscheiden: (1) „Evidenzbasierte Leitlinien“, die disziplinär nicht gebunden sind und die auf der Grundla- ge der besten verfügbaren wissenschaftlichen Evidence erstellt wurden: resultierend aus einer systematischen Zusammenstellung und Aufarbeitung der Literatur, regelmäßig aktuali- siert und mit einem Hinweise auf die Geltungsdauer versehen (Europarat, 2002, S. 50) und (2) disziplinär gebundene Untergruppen, wie z.B. „Medizinische Leitlinien“, die definiert sind als „Feststellungen mit dem Ziel, wichtige Entscheidungen von Ärzten und Patienten über eine angemessene Versorgung zu unterstützen“ (a.a.O). Es handelt sich somit nicht um Richtlinien, die strikt anzuwenden sind oder nahezu aus- nahmslos befolgt werden müssen. Impuls zur Qualitätsentwicklung EbP ist auf die qualitative Weiterentwicklung der Praxis von Professionen gerichtet. Dies gilt gleichermaßen für die Medizin und ihre Teilgebiete, für Pflege und Soziale Arbeit: Die Me- thodik der EbP geht aus von konkreten Patientenproblemen, für deren Lösung unter Berück- sichtigung der Lebensauffassung und Werte des Patienten und der besten erreichbaren Evi- dence in Betracht kommende, (potentiell) wirksame Vorgehensweisen gesucht werden (vgl. z.B. mit Blick auf die Diagnostik und Behandlung von Menschen mit Demenz Müller, 2003).. EbP ist gekennzeichnet durch eine Schrittfolge bei der es eingangs darum geht, die Aufga- benstellung zu klären. Hier ist von Gewicht, sich die wesentlichen klientenbezogenen Aufga-
4 ben der Einrichtung, in der man tätig ist, vor Augen zu führen und nicht die geronnen Routi- nen und Überzeugungen der beruflich Tätigen. Von diesem Ausgangspunkt aus realisiert sich EbP in fünf Schritten: • Das in der Praxis besser zu lösende, eingangs fokussierte Problem ist in eine beantwort- bare Fragestellung zu überführen (Schritt 1). Im Zuge der Formulierung dieser Frage sind die Situation des Klienten, die interessierende Intervention (im Vergleich mit anderen) und das angestrebte Ergebnis (Soll) zu reflektieren. • Die präzise Fragestellung wird der anschließenden Literaturrecherche in zentralen Litera- turdatenbanken zu Grunde gelegt (Schritt 2). • Hieran schließt sich die kritische Beurteilung der Studien an. Das impliziert, dass man sich die hierzu unabdingbare Expertise erarbeitet haben muss. Lehrbücher, die als Ein- führung in EbP konzipiert sind, widmen diesem Schritt entsprechend hohe Aufmerksam- keit, die sich im Seitenumfang niederschlägt (Schritt 3; vgl. Behrens, Langer, 2004; Greenhalg 2000). Substantiell ist, dass Berufsgruppenangehörige in der Lage sind, das in ihrer Disziplin vorhandene Wissen kritisch im Hinblick auf seine Qualität und Aussagekraft zu bewerten. • Die Veränderung der Praxis Sozialer Arbeit, die durch Anwendung der EbP-Methode er- reicht werden soll, stellt den entscheidenden Schritt 4 dar. Die erfolgreiche Implementie- rung hängt ab von drei Faktoren: der Stärke der Evidence, dem Organisationskontext, in den eine neue EbP eingeführt werden soll, und der Güte der Facilitatoren, die als Promo- toren oder Prozessbegleiter Kollegen dabei unterstützen, ihre Arbeitsgewohnheiten und - einstellungen zu ändern. • Nach einer erfolgreichen Implementierung schließt sich die Evaluation von Struktur-, Pro- zess-, Prozessergebnis- (= Output) und Zielerreichungsqualität (= Outcome) an (Schritt 5). Dies entspricht im Kern auch der Schrittfolge, wie sie im einleitenden Beitrag zu Heft 1 des „Journal of Evidence-Based Social Work“ dargelegt wird, mit Ausnahme der die Handlung einleitenden Abklärung der Aufgabenstellung. „EbP consits the following sequence of events: 1. Convert the need for information into an answerable question(s) (...). 2. Track down the best available evidence to answer each question. 3. Critically evaluate this evidence in terms of its validity, impact and potential relevance to our client. 4. Integrate relevant evidence with our clinical expertise and client values and circumstances. 5. Evaluate our expertise in con- ducting Steps 1 - 4 above, and evaluate the outcomes of our services to the client, especially focusing on an assessment of enhanced client functioning and/or problem resolution“ (McNeece, Thyer, 2004, S. 10). Bei der Stärke solcher Empfehlungen werden in der EbP zumeist drei Grade unterschieden: A (= basiert auf wissenschaftlichen Studien hoher Qualität), B (= basiert auf sonstigen Stu- dien) und C (= basiert auf Konsensusaussagen oder Expertenurteilen). Die Zuordnung der Beweisstärke zu diesen Evidenceklassen erfolgt über die Bewertung der Qualität des For- schungsdesigns. Gemäß EbP in der Sozialen Arbeit werden, so McNeece, Thyer (2004, S. 8 ff.), Studien mit folgenden Forschungsdesigns in eine Hierarchie hoher bis niedriger Eviden- ce-Grade gebracht: Systematic Reviews/Meta-Analyses und Randomized Controlled Trials (als höchster Evidencenachweis), Quasi-Exerimental Studies, Case-Control and Cohort Stu- dies, Pre-Experimental Group Studies, Surveys (mit mittlerer) und schließlich Qualitative Studies (als niedrigster). Die Soziale Arbeit folgt mit dieser Reihung in etwa der in Medizin und Pflege eingeführten Hierarchie (vgl. Schrappe, Lauterbach, 2001, S. 64 und Behrens, Langer 2004, S. 108). Dass in den jeweiligen Disziplinen oder Professionen auch eine kritische Rezeption von EbP als Methode stattfindet, ist nicht verwunderlich. Egal, ob es sich um Akutmediziner, Psychia- ter, Pflegewissenschafter oder Sozialarbeitswissenschafter handelt: Zentrale kritische Ein- wände werden vor allem dann vorgebracht, wenn die EbP in ihrer Flexibilität und Transpa- renz nur eingeschränkt rezipiert wurde. Zudem wird EbP mit Blick auf Forschungstraditionen unterschiedlich bewertet. Länder, die traditionellerweise Theorieentwicklung stärker mittels
5
empirischer Forschung generieren und die in der Forschung quantitative Methoden breit an-
wenden, haben hier weniger „kulturelle Hürden“ zu überwinden. Umgekehrt: Vertreter von
Disziplinen mit defizitärer empirischer Forschung oder von Disziplinen, in denen qualitativer
Forschungsstrategien verbreitet sind, sehen sich durch EbP im Nachteil.
Dies könnte auch für die Sozialarbeitswissenschaft in Deutschland Folgen zeitigen. Sie ist
auf der Theorieebene eher rationalistisch-deduktiv ausgerichtet. Eine Theoriegenerierung
durch Forschung impliziert jedoch ein induktives Vorgehen und eine Ausrichtung auf Theo-
rien mittlerer Reichweite, die eine größere Nähe zur Problemen der Praxis Sozialer Arbeit
aufweisen. In der Pflegewissenschaft - zunächst in den USA, nun allmählich auch hierzulan-
de - wurde dieser Perspektivwechsel bereits vollzogen bzw. eingeleitet (Moers, Schaeffer,
2000, S. 55 f. und 61 f.), in der Sozialarbeitswissenschaft hingegen ist in Deutschland eine
vergleichbare Entwicklung - trotz des Plädoyers von Olk, Otto, Backhaus-Maul (2003, S. LXI)
- bislang nicht zu erkennen.
Beste erreichbare Evidence
Bei vielen Aussagen handelt es sich gerade in der Sozialen Arbeit vor allem um Experten-
meinungen, hinzu kommen qualitative Studien und Evaluationsberichte (ohne Vergleichs-
gruppe), die allesamt keine hohe Evidence für sich beanspruchen können. Würde man nur
diejenigen Stufen der Evidence berücksichtigen, die erreicht sein müssen, um eine Bildung
nationaler Standards auf der Makro-Ebene vornehmen zu können (Goldstandard), bestünde
für die Soziale Arbeit heute kaum die Möglichkeit, mit Hilfe von EbP die Qualität ihrer Dienst-
leistungen zu sichern und eine kontinuierliche Qualitätsentwicklung mittels Überprüfung, ob
die praktizierte Diagnostik und Behandlung noch dem Stand der Erkenntnisse entsprechen,
anzustoßen. Erst durch das Konstrukt einer besten erreichbaren Evidence ist man auch in
der Sozialen Arbeit grundsätzlich in die Lage versetzt, eine wissensbasierte Weiterentwick-
lung praktischen Handelns im Sinne der EbP einzuleiten: „EbP says that one should rely on
the best AVAILABLE evidence, not only on BEST evidence, such as based on RCT (= ran-
domisiert-kontrollierte Studien - R.S.) (because often there is no BEST evidence available)“
(McNeece, Thyer 2004, S. 10).
Mit dem Konstrukt der besten erreichbaren Evidence wird auch unterschiedlichen Umstän-
den Rechnung getragen, die es verhindern, hohe Grade an Evidence zu erreichen.
• Es gibt klinische Situationen, wo ethisch und/oder forschungsmethodisch randomi-
siert-kontrollierte Studien nicht in Betracht gezogen werden können (weil ein Behand-
lungsbedarf besteht, weil im Falle komplexer Intervention die Bedeutung einzelner
Variablen schwer zu kontrollieren ist);
• In diesen Fällen oder bei Fehlen methodisch hoch bewerteter Studien können auch
qualitative Forschungen in die Ermittlung einbezogen werden oder
• Expertenempfehlungen, die durch strukturierte Konsensbildung erzielt werden, bei
nicht nachgewiesener oder strittiger Evidence.
Die Vorhaltung, EbM sei auf randomisiert-kontrollierte Studien fokussiert, ist so nicht haltbar
und wird der Flexibilität des Verfahrens EbP keineswegs gerecht. Zentral ist u.a. die Offenle-
gung der Güte eines Wirksamkeitsbelegs und die Herstellung von Transparenz. Im Falle
komplexer Interventionen kann dies z.B. mittels eines Algorithmus dargestellt werden, wo
dann für einzelne Schritte im Prozess der Diagnostik und Behandlung differenziert unter-
schiedliche Grade von Evidence (= Empfehlungsklassen) ausgewiesen werden können. So
kann z.B. die pharmakologische Behandlung auf der Grundlage hoher Evidence empfohlen
werden, während in der sozialtherapeutischen Behandlung keine Behandlungsmethode
naachweislich einer anderen überlegen ist. Man kann das exemplarisch an der Demenz-
Leitlinie, die an der Universität Witten-Herdecke entwickelt wurde, nachvollziehen
(www.evidence.de).6 EbP umfasst auf dem höchsten Level neben der Ermittlung systematischer Evidenzbasie- rung auch die strukturierte Konsensfindung (Selbmann, Konrad, 2005 S. 2). Bei der Entwick- lung von Medizinischen Leitlinien wird dringend empfohlen, in das Verfahren der Leitlinien- Entwicklung die klinische Expertise der Praktiker synergetisch einzubeziehen. Zu verbinden sind das systematisch ermittelte wissenschaftliche Wissen und das Wissen der Kliniker, die als Experten in einem strukturierten Verfahren identifiziert werden konnten. Bei Fragenstel- lungen zur optimalen Versorgung von Patienten/Klienten, wo mehrere Diszipli- nen/Professionen beteiligt sind, muss die Perspektive der systematischen Wissensermittlung entsprechend breit angelegt werden, und es ist auf eine interdisziplinäre/multiprofessionelle Beteiligung von Experten an der strukturierten Konsensfindung zu achten. „Zwei Dinge wird man aber im Auge behalten müssen. Erstens steht außer Frage, dass die Methodik von EbM sich auf Fragen von Lebensqualität und ganze Versorgungsansätze an- wenden lässt; man muss die erforderlichen hochwertigen Studien nur kennen und für die Zukunft mehr Geld hierfür bereitstellen. (...) Diese Mängel (gemeint ist die naturwissenschaft- liche Verengung klinischer Forschung - R.S.) (..:) können nicht der EbM angelastet werden, sondern sind Ausdruck einer selbstzufriedenen klinischen Medizin. Zweitens hat noch nie- mand erklärt, warum das Herausfinden unzureichender Evidenz für diagnostische und thera- peutische Verfahren „inhuman“ sein soll“ (Schmacke, 2002, S. 18). Zwei Linien der Entwicklung von Evidence-based Social Work Practice Man kann im Hinblick auf die allmählich einsetzende Entwicklung von Evidence-based Social Work Practice zwei Richtungen unterscheiden: die Einbeziehung des Wissens über die Wir- kungen von Interventionen Sozialer Arbeit im Kontext von Fragestellungen anderer Diszipli- nen und die in den Vereinigten Staaten seit etwa dem Jahr 2000 einsetzenden eigenen An- strengungen der Soziale Arbeit, ihre Interventionen wissenschaftlich zu begründen. Sozialarbeitsnahe Themen in Evidence-based Practice anderer Disziplinen Interventionen Sozialer Arbeit sind in Handlungsfeldern, die eng an die Medizin grenzen, gelegentlich auch (Neben-) Thema von Reviews, die im Rahmen einer EbM erstellt wurden. In solchen Fällen ist Soziale Arbeit nicht direkt als Akteur beteiligt, sondern es werden For- schungsergebnisse, die zu Wirkungen bestimmter Aktivitäten des Krankenhaussozialdiens- tes vorliegen, im Zusammenhang mit der Beantwortung einer übergreifenden Frage nach bestmöglichen Behandlungswegen für Patienten mit definierten Gesundheitsproblemen erör- tert und bewertet. Zum Beispiel wird u.a. der Frage nach der Wirkung nahtloser sozialer Be- ratung im Zuge einer optimierten Entlassungsplanung in einem Review (Meier-Baumgartner u.a., 2002) zur Effektivität der postakuten Behandlung und Rehabilitation älterer Menschen nach einem Schlaganfall oder einer hüftgelenksnahen Fraktur nachgegangen. Einbezogen in diese Analyse sind im internationalen Schrifttum vorliegende Untersuchungen, in denen un- ter randomisiert-kontrollierten Bedingungen Patientengruppen u.a. mit oder ohne Entlas- sungsvorbereitung und mit oder ohne nahtlose soziale Beratung verglichen werden. Ein anderes Beispiel dafür, dass mögliche Inhalte Sozialer Arbeit im Rahmen ärztlicher Leit- linien recherchiert werden, ist die von der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin e.V. erstellte Leitlinie zum Thema „Ältere Sturzpatienten“ (DEGAM, 2002). Neben Fragen und Tests im Zusammenhang mit Screening und Diagnostik in der Hausarzt- praxis werden den Ärzten Maßnahmen empfohlen. Die Stärke dieser Empfehlungen diffe- riert, wie oben dargelegt, im Hinblick auf die unterschiedlichen Qualitätsniveaus wissen- schaftlicher Studien. Unter „supportive Maßnahmen“ wird in dieser Leitlinie mit der höchsten Empfehlungsstärke (A) der „präventive Hausbesuch“ genannt, der mitunter in der Sozialen Arbeit in geriatrischen Kliniken oder geriatrischen Rehabilitationseinrichtungen eingeführt ist. Allein Hüftprojektoren zum Schutz gegen hüftnahe Frakturen erreichen noch diese höchste
7 Stärke der Evidence. Andere erörterte Maßnahmen hingegen bewegen sich (nur) im Bereich mittlerer Empfehlungsstärke. Dass Recherchen und Bewertungen der Qualität vorliegender Forschungsberichte allerdings divergieren können, kann gleichfalls exemplarisch am Thema „präventiver Hausbesuch“ dar- gelegt werden. Eine aktuelle systematische Bewertung der vorliegenden Evidence, die von Meinck u.a. (2004) durchgeführt wurde, gelangt zu konträren Schlussfolgerungen. Die Auto- ren führen aus, dass randomisiert-kontrollierte Studien für Deutschland nicht existieren und international publizierte systematische Übersichtsarbeiten (Meta-Analysen) zu divergieren- den Ergebnissen gelangen Eine Übertragbarkeit dieser Studien wird zudem skeptisch beur- teilt, weil die Erfolgsdeterminanten als weitgehend ungeklärt gelten und ermittelte Wirksam- keitsnachweise als unspezifisch anzusehen sind. Die Autoren empfehlen vor diesem Hinter- grund in Deutschland zunächst kontrollierte und aufeinander abgestimmte Studien durchzu- führen. Eine darüber hinausgehende Empfehlung zur Einführung präventiver Hausbesuche kann aus Sicht der Autoren derzeit nicht ausgesprochen werden. Solche Schlussfolgerungen sind von Belang, weil das SGB V Leistungserbringer und Leis- tungsträger, wie eingangs dargelegt, verpflichtet, die Leistungen dem jeweiligen Stand der medizinischen bzw. wissenschaftlichen Erkenntnisse entsprechend zu erbringen. Mit der zweiten Formulierung (§ 135a Abs. 1 SGB V) wird zum einen die rechtliche Basis für die Evi- dence-based Medicine (EbM) gelegt, zum anderen wendet der Gemeinsame Bundesaus- schuss das EbM-Verfahren bei der Überprüfung des Leistungskatalogs und bei der Ent- scheidung über neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden an (Bieback, 2004, S. 30 ff.). Denn: Ist die Wirksamkeit einer Leistung nicht belegt, kann sie nicht als wirtschaftlich gelten: Leistungen aber müssen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein (§§ 2 Abs. 4, 12 Abs. 1 SGB V). Leistungen, die diese Kriterien nicht erfüllen, dürfen Versicherte/Nutzer nicht beanspruchen und dürfen Leistungsträger nicht bewilligen. EbM ist so gesehen auch Verfahren zur Herstellung von Transparenz bei Entscheidungen über Rationalisierung und Rationierung von Leistungen. Mit ihrer Hilfe kann unterschieden werden, was nachweislich der Stand der Kunst einer Disziplin ist und welches Niveau an Versorgung und gesundheitlicher Lebensqualität man (das sind der Gesetzgeber oder die zur Weiterentwicklung des Leistungskatalogs berechtigte Instanz, der Gemeinsame Bundes- ausschuss) sich bei knappen Ressourcen leisten kann und mag. Fachlichkeit wird gegen- über gesundheitspolitischen Entscheidungen profiliert in einem nachvollziehbaren Verfahren und bei differenzierter Verantwortlichkeit. Anstöße zu Evidence-based Social Work Practice In den USA ist Evidence-based Social Work Practice auf unterschiedlichen Ebenen Thema der Disziplin und Gegenstand ihrer Professionalisierungsbestrebungen. Nebenneueren Fach- und Handbüchern (z.B. über EbP in der Klinischen Soziale Arbeit mit Familien oder EbP-gestützte Interventionen bei Kindesmisshandlung; vgl. McNeece, Thyer 2004, S. 11 f.) und Beiträgen in Fachzeitschriften der Sozialen Arbeit (O’Hare, 2002), die diese Entwicklung aufgreifen, erschien im Frühjahr 2004 die erste Ausgabe des neuen „Journal of Evidence- Based Social Work“ (u.a. mit einem allgemeinen Beitrag zur Methode der EbP und speziellen Beiträgen u.a. über die Behandlung von Anorexia Nervosa und Bulimia Nervosa oder zu Ri- sikofaktoren, Assessment und Behandlung von Kindern und Jugendlichen bei Alkoholmiss- brauch). Schließlich existieren Literatur-Datenbanken, mit deren Hilfe Interessenten mittels Internet Zugang zu „systematic reviews of the best available research evidence“ bei definier- ten psychosozialen und Gesundheitsproblemen erhalten können.2 2 Neben der bekannten Cochrane Collaboration (http://www.cochrane.org) weisen McNeece, Thyer, 2004, S. 11 auf folgende web pages: Campbell Collaboration (http://campbell.gse.upenn.edu/) und dBandolier Database (http://www.jr2.ac.uk/bandolier). Deren Datenbasis wird fortlaufend aktualisiert und erweitert.
8 Nutzern stehen zur Beantwortung ihrer Fragen nach der bestmöglichen Evidence zur Lösung eines Praxisproblems Zusammenfassungen des Wissenstands - erstellt auch durch interna- tionale und interdisziplinäre Teams - als Download zur Verfügung. Wann und wie umfassend das Fachwissen in dieser kondensierten Form vorliegt, hängt ab von der Dynamik die Evi- dence-based Practice in den unterschiedlichen Disziplinen entfalten wird. Insbesondere die zuletzt genannten Datenbanken sind im Zuge dieser Entwicklung von be- sonderem Gewicht, da sie von Praktikern via Internet jederzeit und unabhängig von ihrem Aufenthaltsort recherchiert und konsultiert werden können. Die Zugänglichkeit solcher Er- gebnisse stellt z.B. ein Qualitätskriterium im Übergang zu einer EbM dar, und das Internet ist das Medium, das zur Einlösung der Publizitätspflicht prioritär genutzt wird (Kirchner u.a., 2003, S. 77). Fazit Die Perspektive einer EbP in der Sozialen Arbeit, wenn sie auch hierzulande Fuß fassen sollte, hat Charme. Sie zwingt systematisch dazu, zu fragen, was das vorhandene empiri- sche Wissen der Disziplin im Sinne einer besten erreichbaren Evidence zur Lösung der Le- bensprobleme von Klienten individuell oder bedarfsgruppenbezogen beitragen kann. Diese Orientierung könnte mehrere Effekte zeitigen: • EbP ist gerichtet auf den Kern der Disziplin, der sich allmählich und immer konturierter werdend herauszuschälen kann. Durch EbP werden Ressourcen und Potentiale der Dis- ziplin deutlich, aber auch ihre Begrenzungen zu einer bestimmten Zeit. Es wird erforder- lich, darlegen zu können, welchen Beitrag professionsspezifische Dienstleistungen zur Lösung komplexer Probleme zu leisten im Stande sind. • Das würde auch bedeuten, dass Soziale Arbeit gerade in interdisziplinären Kontexten wie im Gesundheitswesen und in der Langzeitpflege an Kommunikationsfähigkeit gewönne. Bemerkenswert ist hierbei, dass nach der Medizin nun auch Pflege und Soziale Arbeit die EbP-Methode aufgreifen. Das heißt, dass selbst dann, wenn professionelle Perspektiven differieren, eine übergreifende Systematik trotzdem u.U. mehr Bezugnahme ermöglicht. Und nebenbei geht es bei EbP auch darum, das Theorie-Praxis-Verständnis in der Sozialen Arbeit zu modernisieren. Literatur Johann Behrens, Gero Langer: Evidence-based Nursing. Vertrauensbildende Entzauberung der Wis- senschaft. Bern 2004 Karl-Jürgen Bieback: Qualitätssicherung der Pflege im Sozialrecht. Heidelberg 2004 Bärbel Dangel: Pflegerische Entlassungsplanung. Ansatz und Umsetzung mit dem Expertenstandard. München 2004 Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin e.V. (DEGAM): Leitlinie Nr. 5 Ältere Sturzpatienten. Unauthorisierte Version (Praxistest). Kiel, Stand: Oktober 2002 Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) (Hrsg.): Sonderdruck Experten- standard Entlassungsmanagement in der Pflege einschließlich Kommentierung und Literaturanalyse. Osnabrück 2002 Europarat: Empfehlung Rec(2001)13 und Erläuterndes Memorandum. In: Zeitschrift für ärztliche Fort- bildung und Qualitätssicherung (2002) Supplement III Trisha Greenhalgh: Einführung in die Evidence-based Medicine. Kritische Beurteilung klinischer Stu- dien als Basis einer rationalen Medizin. Bern 2000 Dieter Hart: Qualitätssicherung durch Leitlinien. In: Vierteljahresschrift für Sozialrecht (2002)4, S, 265- 297 T. W. Kallert u.a.: Evidenzbasierung gemeindepsychiatrischer Versorgungsangebote in Deutschland: eine Bestandsaufnahme. In: Das Gesundheitswesen 67(2005)5, S. 342-354
9 Hanna Kirchner u.a.: Bewertung und Implementierung von Leitlinien. In: Rehabilitation, 42(2003), S. 74-82 Regina Kunz: EbM-Glossar. In: Günter Ollenschläger u.a. (Hrsg.): Kompendium evidenzbasierte Me- dizin. Bern/Göttingen/Toronto/Seattle 2005 (4. Aufl.), S. XXXI-XXXVII Regina Kunz, Günter Ollenschläger u.a.: Lehrbuch Evidenzbasierte Medizin in Klinik und Praxis. Köln 2000 Aaron McNeece, Bruce A. Thyer: Evidence-Based Practice and Social Work. In: Journal of Evidence- Based Social Work, 1(2004), S. 5-23 Hans Peter Meier-Baumgartner u.a.: Die Effektivität der postakuten Behandlung und Rehabilitation älterer Menschen nach einem Schlaganfall oder einer hüftgelenksnahen Fraktur. Eine Literaturüber- sicht des Zeitraums 1992 bis 1998. Stuttgart 2002 Mathias Meinck u.a.: Präventive Hausbesuche im Alter: eine systematische Bewertung der vorliegen- den Evidenz. In: Gesundheitswesen, 66(2004), S. 732-738 Martin Moers, Doris Schaeffer: Pflegetheorien. In: Beate Renner-Allhoff, Doris Schaeffer (Hrsg.). Handbuch Pflegewissenschaft. Weinheim/München 2000, S. 35-66 Ulrich Müller u.a.: Nationale und internationale Demenz-Leitlinien im Vergleich. In: Fortschritte der Neurologischen Psychiatrie, 71(2003), S. 285-295 Thomas O’Hare: Evidence-Based Social Work Practice with Mentally Ill Persons Who Abuse Alcohol and Other Drugs. In: Social Work in Mental Health, 1(2002), S. 43-62 Thomas Olk, Hans-Uwe Ott, Holger Backhaus-Maul: Soziale Arbeit als Dienstleistung - Zur analyti- schen und empirischen Leistungsfähigkeit eines theoretischen Konzepts. In: Soziale Arbeit als Dienst- leistung München/Unterschleißheim 2003, S. IX-LXXII Norbert Schmacke: Evidenzbasierte Medizin: Fundament zur Vereinbarung individueller Therapiezie- le. In: G+G Wissenschaft, 2(2002)2, S. 16-25 Hans-Konrad Selbmann, Ina Konrad: Nutzen und Grenzen systematischer Reviews bei der Entwick- lung von S3-Leitlinien. Vortrag, gehalten auf der 6. Jahrestagung Deutsches Netzwerk EbM am 4. März 2005 (www.leitlinien.net) Matthias Schrappe, Karl W. Lauterbach: Evidence-based Medicine: Einführung und Begründung. In: Karl W. Lauterbach, Matthias Schrappe (Hrsg.): Gesundheitsökonomie, Qualitätsmanmagement und Evidence-based Medicine. Eine systematische Einführung. Stuttgart 2001, S. 57-66
Sie können auch lesen