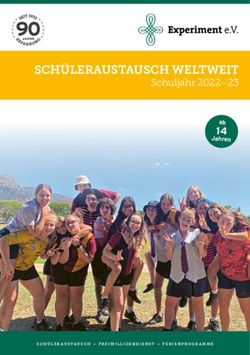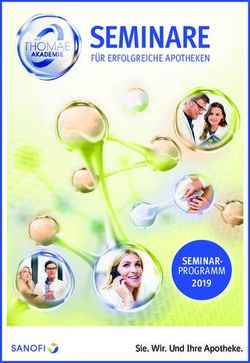Gesundheitsförderung in Haft
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Gesundheitsförderung in Haft –
Ein modulares Konzept
für den Justizvollzug
Entwicklung und Konzeption:
Aidshilfe Hamburg e.V.
im Auftrag des
Landesverbandes Hamburger Straffälligenhilfe e.V.
Sonja Lohmann
Diplom-Pädagogin
Christian Szillat
Master of Health Science
Veröffentlichung: August 2021„Gesundheitsförderung unterstützt die
Entwicklung von Persönlichkeit und Fähigkeiten
durch Information, gesundheitsbezogene Bildung
sowie die Verbesserung sozialer Kompetenzen und
lebenspraktischer Fertigkeiten.
Sie will dadurch den Menschen helfen, mehr
Einfluss auf ihre eigene Gesundheit und ihre
Lebenswelt auszuüben, und will ihnen zugleich
ermöglichen, Veränderungen in ihrem Lebensalltag
zu treffen, die ihrer Gesundheit zu gute kommen.“
– Ottawa-Charta, WHO 19861 Einleitung 05
Ausgangssituation 05
Zeit der Haft nutzen 06
2 Ziel, Aufbau und Handhabung des Konzepts zur
Gesundheitsförderung 08
Ziel und Entwicklung des Gesundheitsförderungskonzepts 08
Zielgruppen 09
Besondere Situation inhaftierter Frauen 09
Die Module 10
2.1 Umsetzung der Module für Inhaftierte 11
2.2 Umsetzung der Module für Mitarbeiter:innen 13
2.3 Hinweise zur organisatorischen Umsetzung 14
3 Förderung und Stärkung der Kompetenzen von
Menschen in Haft 15
3.1 Schwerpunkt Substanzkonsum 15
Modul 01: Substanzkonsum –
Auswirkungen, Risiken, Prävention 15
3.2 Schwerpunkt Prävention 18
Modul 02: HIV und Hepatitiden 18
Modul 03: Tattoo und Piercing 20
Modul 04: Leber 22
Modul 05: Gesundheit im Alter 24
Fokus: Sexualität 26
Modul 06: Sexuell übertragbare Infektionen 27
Modul 07: Verhütung 29
3.3 Schwerpunkt Psychosoziale Kompetenzen 30
Modul 08: Umgang mit Stress 30
Modul 09: Soziale Kontakte 32
Modul 10: Haltung und Wertesysteme 34
Modul 11: Gewaltfreie Kommunikation und Sprache 363.4 Schwerpunkt Alltagspraktische Fähigkeiten 38
Modul 12: Hygiene 38
Modul 13: Ausgewogene Ernährung 40
Modul 14: Wirtschaftliche Möglichkeiten und Perspektiven 42
4 Förderung und Stärkung der Kompetenzen von
Mitarbeiter:innen im Haftalltag 44
Module für das Personal in JVA 44
Modul M01: Sucht und Abhängigkeit 45
Modul M02: HIV, Hepatitiden und weitere
übertragbare Infektionen 47
Modul M03: Sexualität versus Sexualisierte Gewalt 49
Modul M04: Seelische Gesundheit. 52
Modul M05: Herausforderung beruflicher Alltag –
Stressreduktion durch professionelle Abgrenzung 54
Modul M06: Alternde Gefangene 56
5 Schlussbetrachtung 58
Weitere Unterstützungsmöglichkeiten 58
Unabhängige Gesundheitsberatung 60
Nachwort 61
Abkürzungsverzeichnis 62
Anhang: Beispiele guter Praxis 63
Quellen 651 Einleitung
„Die Gesundheit der Gefangenen betrifft die Gesundheit aller, denn
Gefangene kommen aus der Gesellschaft und kehren in den allermeisten
Fällen in ihre Lebensverhältnisse zurück. Die Gesundheit der Gefangenen ist
daher ein Thema der Öffentlichen Gesundheit, das uns alle angeht (…)“
(Heino Stöver, in: Stöver, H./ Egler, B. 2008: S. 126)
Ausgangssituation
In deutschen Gefängnissen sitzen jährlich rund 70.000 Menschen im offenen
oder geschlossenen Justizvollzug ein (Belegung am letzten Tag des Dezember
2020: 72.385, davon befanden sich 12.064 Menschen in den Untersuchungs-
haftanstalten (Statistisches Bundesamt 2021).
Die Insass:innen der Justizvollzugsanstalten stammen häufig aus sozio-
ökonomisch schlecht gestellten und bildungsarmen Bevölkerungsteilen.
Mehrfache Haftaufenthalte sind nicht selten. Ein erheblicher Teil lebt mit
kritischem Substanzkonsum (illegale Drogen, Alkohol) und schlechtem
Allgemein- und Gesundheitszustand.1 Neben der im Vergleich zur extramuralen
Bevölkerung höheren Prävalenz von Infektionserkrankungen – hier sind vor
allem HIV, Hepatitis B (HBV) und Hepatitis C (HCV) 2 zu nennen – finden sich
bei Gefangenen vermehrt psychische und psychiatrische Krankheitsbilder.
Unter Depressionen sowie einer - besonders in Untersuchungshaft - erhöhten
Neigung zu Suizidalität leiden Gefangene häufiger als die
Allgemeinbevölkerung (Keppler, K. et al. 2010). Insbesondere bei zuvor
wohnungslosen Menschen und Drogenkonsument:innen zeigt sich neben den
Folgen von Mangel- und Fehlernährung oft ein desaströser Zahnstatus, der sich
negativ auf den Gesamtorganismus auswirken kann (z.B. Arteriosklerose,
Herzklappenentzündung).
Menschen, die in Haft kommen, sind vor ihrer Inhaftierung oftmals nicht ins
medizinische oder psychosoziale Versorgungssystem eingebunden. Das gilt
besonders für Obdachlose, Drogenkonsument:innen bzw. Substanzabhängige
ohne familiäre oder soziale Einbindung sowie Menschen mit ungesichertem
Aufenthaltsstatus und fehlender Sozialversicherung.
1Schätzungen zufolge sind 22 - 30% der Gefangenen Konsument:innen illegaler Drogen.
2 „Insbesondere „Infektionskrankheiten sind (…) im Vollzug deutlich überrepräsentiert,
Risikogruppen wie DrogenkonsumentInnen, psychisch Kranke, SexarbeiterInnen sowie
Alkohol“abhängige“ werden häufiger inhaftiert und tragen ein höheres Risiko einer HIV-Infektion
(….), so dass schon bei Haftantritt viele Infektionen vorhanden sind.“ (Thane, K. 2015: S. 59)
5„Menschen in Haft leiden nicht nur unter einem schlechteren
gesundheitlichen Allgemeinzustand als die Normalbevölkerung, sie
unternehmen auch aus vielfältigen Gründen weniger für ihre Gesundheit.
Das hängt vor allem von ihren deutlichen eingeschränkten Möglichkeiten
zur Teilhabe an der Gesellschaft ab und äußert sich zum Beispiel darin,
dass Informationen zur Gesundheit erst gar nicht bei ihnen ankommen oder
aus innerpsychischen Gründen nicht wahrgenommen werden.“ (Reuter, S./
Behrens, M. 2014: S. 444).
Zum weit überwiegenden Teil sitzen Männer ein (unter den Ende Dezember
2020 bundesweit gut 72.000 Gefangenen stellen Frauen mit rund 4.400 eine
deutliche Minderheit dar), die sich auch außerhalb der Haft in der Regel weniger
um ihre Gesundheit bemühen als Frauen es tun (RKI 2020).
Zeit der Haft nutzen – Belastung und Chance Haft
Der Freiheitsentzug wirkt sich für Gefangene in vielerlei Bereichen negativ aus:
die Trennung von Familie und gewohntem sozialem Umfeld, das Fehlen
adäquater Gesprächspartner führen zu Isolation, es mangelt an positiven
Außenreizen. Unterbringung in Zwangsgemeinschaft, fehlende Intimsphäre,
Verlust der Autonomie im streng hierarchischen Gefüge Justizvollzug stellen
weitere Belastungen dar. Offen gebliebene Angelegenheiten und Probleme,
beispielsweise ungeklärte Wohnverhältnisse, Schulden, Beziehungsprobleme
aus Haft heraus zu erledigen und zu lösen, gestaltet sich meist sehr schwierig
und kann Gefühle von Hilflosigkeit und Ohnmacht hervorrufen.
Inhaftierte Frauen sind oftmals (alleinerziehende) Mütter von minderjährigen
Kindern, sodass eine Inhaftierung besondere Probleme und Belastungen mit
sich bringt, insbesondere, wenn die Kinder von der Mutter getrennt werden.
Dazu gibt es aufgrund der geringen Anzahl weiblicher Gefangener weniger
Haftanstalten für Frauen, die entsprechend oft nicht in Wohnortnähe liegen,
sodass der Kontakt zu Familie, Kindern und Freunden zusätzlich erschwert ist.
„Haft bedeutet immer Stress: Die Haftsituation, polizeiliche Vernehmungen,
Gerichtstermine können Angst und Unsicherheit auslösen, die Trennung
von Angehörigen, Partner(innen) und Freund(innen) belastet, Langeweile
und Ohnmachtgefühle stellen sich ein, es kommt zu Konflikten mit
Mithäftlingen oder Bediensteten, man erlebt Bedrohung, Aggression und
Gewalt.“ (Keppler, K. 2014: S. 137).
Neben Belastungen bietet die Zeit der Haft auch Chancen: Menschen können
erreicht werden, die außerhalb der Mauern durch die Versorgungsnetze fallen
bzw. von Hilfsangeboten nicht erreicht werden. Neben einem Dach über dem
Kopf, regelmäßigen Mahlzeiten und der Möglichkeit zur Körperpflege profitieren
vor allem – meist durch Wohnungslosigkeit und Sucht - verelendete Gefangene
von der medizinischen Versorgung in den Vollzugsanstalten. Auch der
erzwungene Verzicht auf bzw. die reduzierte Verfügbarkeit
6bewusstseinsverändernder Substanzen macht die Gefangenen ansprechbarer
– zumindest, wenn der körperliche Entzug überstanden ist oder die bestehende
Sucht medikamentengestützt behandelt wird. Für Gefangene kann die Zeit der
Haft daher durchaus auch eine Zeit der körperlichen Genesung sein: „Die
Inhaftierung wirkt mitunter deutlich stabilisierend, ja sogar lebensrettend (…)“
(Woltmann, J. 2014: S. 346).
In Haft nehmen Gefangene oftmals ihren Körper wieder deutlicher wahr und
entwickeln ein stärkeres Interesse für ihre Gesundheit als zuvor. Neben der
Gesundheitsfürsorge im Sinne rein medizinischer Versorgung können
Justizvollzugsanstalten hier die Chance und einen Rahmen bieten, mit
geeigneten pädagogischen Angeboten zu einem verbesserten
Gesundheitsbewusstsein beizutragen und die Entwicklung von
Gesundheitskompetenz zu fördern.
„Unter Gesundheitskompetenz wird das Wissen, die Motivation und die
Fähigkeit verstanden, gesundheitsrelevante Informationen finden,
verstehen, beurteilen und anwenden zu können, um die eigene Gesundheit
zu erhalten, sich bei Krankheiten die nötige Unterstützung zu sichern und
die dazu nötigen Entscheidungen zu treffen.“ (Hurrelmann et al. 2020: S. 3)
In der aktuellen Haftsituation können Angebote zur Gesundheitsförderung den
oft eintönigen Alltag bereichern, das Zuwenig an Außenreizen etwas
ausgleichen sowie Langeweile und Ohnmachtsgefühle abmildern. Der erlebte
Autonomieverlust kann partiell relativiert werden, da man selbst aktiv etwas für
sich tun und die Zeit der Haft sinnvoll gestalten kann. Die Möglichkeit,
Kompetenzen zu erwerben, die auch für das Leben in Freiheit nützlich sind,
stärkt Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein der Gefangenen und schafft
Perspektiven. In seiner „Charta gesundheitsfördernde Haftanstalten“ formuliert
Heino Stöver:
„Das Gefängnis ist zwar einerseits ein Ort mit besonderen gesundheitlichen
Belastungen aber andererseits auch einer, an dem medizinische und
psycho-soziale Hilfen und Unterstützungen von vielen Gefangenen
erstmalig und systematisch in Anspruch genommen werden und zum Teil
zu einer erheblichen Verbesserung ihres Gesundheitszustandes führen.
Gleichwohl sind diese Erfolge oft nur von kurzer Dauer und werden
entweder von Risikoverhalten noch in Haft oder unmittelbar nach
Haftentlassung wieder zunichte gemacht.“ (Stöver, H./ Egler, B. 2008: S.
126ff).
Der Erwerb von Gesundheitskompetenzen kann und soll auch nach Haft
wirksame Grundlage für eine dauerhaft gesündere Lebensführung bieten.
72 Ziel, Aufbau und Handhabung des
Konzepts zur Gesundheitsförderung
Ziel und Entwicklung des Gesundheitsförderungskonzepts
Seit langem werden vielerorts auch Angebote aus dem Bereich der
Gesundheitsförderung umgesetzt3. Für letztere war die Deutsche Aidshilfe mit
ihren bundesweit durchgeführten Veranstaltungen „Gesundheit in Haft“ ein
maßgeblicher Vorreiter. Allerdings sind die Angebote zumeist
Einzelveranstaltungen oder Pilotprojekte, die nur über begrenzte Zeiträume
verfügbar sind.
Der Anspruch an dieses Konzept war es, gesundheitsfördernde (Lern-)
Einheiten zu entwickeln, die in allen Justizvollzugseinrichtungen Deutschlands
variabel einsetzbar sind und die idealerweise als Regelangebot dauerhaft
etabliert werden.
Der erste Gedanke, zu ausgewählten Themenfeldern detaillierte Curricula (inkl.
methodischer Herangehensweise) zu konzipieren, wurde schnell verworfen. Die
Anstalten und die Voraussetzungen vor Ort sind so divers, dass die Entwicklung
„starrer“ Curricula den zu vermittelnden Inhalten, den Einrichtungen – und vor
allem den Inhaftierten – nicht gerecht werden würde.
Nicht nur die Vollzugsformen unterscheiden sich teilweise gravierend – man
vergleiche Untersuchungshaft, offenen und geschlossenen, Lang- und
Kurzstrafenvollzug, Erwachsenen- und Jugendvollzug. Auch die
Rahmenbedingungen der einzelnen Justizvollzugsanstalten differieren je nach
Art und Größe, Standort und Bundesland, Häusern für Frauen, für Männer und
für Jugendliche. Jeder Standort ist so unterschiedlich wie die Menschen, die
dort arbeiten oder inhaftiert sind. Ebenso unterschiedlich sind die Bedarfe in den
jeweiligen Häusern oder Abteilungen.
Aus diesem Grund ist das Konzept nicht als Curriculum entwickelt worden und
soll auch so nicht verstanden werden. Vielmehr soll es mit seinen einzelnen
Elementen einen Ein- und Überblick darüber geben, welche Themenkomplexe
und Schnittstellen in Bezug auf die Förderung von Gesundheitskompetenz und
Gesundheit miteinander verwoben sind und Vorschläge zur inhaltlichen
Ausrichtung für die Umsetzung vor Ort machen.
Entsprechend ist das Konzept nicht notwendig als Gesamteinheit einzusetzen.
Es ist nach Themenschwerpunkten aufgebaut, denen einzelne
Themenbereiche – die Module – zugeordnet sind. Die Inhalte der Module
erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können variabel nach
Bedarfs- und Interessenlage sowie zeitlichen Ressourcen angepasst und/oder
modifiziert werden.
3 Einige Beispiele guter Praxis werden im Anhang aufgeführt.
8Nachfolgend werden die verschiedenen Zielgruppen des Konzepts
beschrieben, sowie Hinweise und Erklärungen zum Aufbau, zur Struktur, der
Handhabung und dem geeigneten Rahmen zur Durchführung der Module
gegeben. Besondere Aspekte, die unserer Ansicht nach sehr wichtig sind für
eine gute Umsetzung, finden sich am Ende dieses Kapitels.
Zielgruppen
In dem Konzept finden sich Module für unterschiedliche Zielgruppen: die in
Kapitel 3 richten sich an inhaftierte Frauen und Männer4, die Module in Kapitel
4 an Mitarbeiter:innen der JVA.
Besondere Situation inhaftierter Frauen
Frauen stellen mit derzeit rund 6% nur einen geringen Anteil an der
Gefangenenpopulation. Sie sind häufiger wegen Verstößen gegen das
Betäubungsmittelgesetz und/oder Eigentumsdelikten, seltener wegen
Gewaltdelikten verurteilt - somit zu kürzeren Haftstrafen als Männer, dennoch
sind sie den in Relation zu den von Frauen verübten Delikten überhöhten
Sicherheitsstandards des Männervollzuges unterworfen. Auch die weiblichen
Gefangenen sind oftmals mehrfach hafterfahren.
Im bundesweiten Durchschnitt (die Angaben unterscheiden sich nach
Bundesland und Haftanstalten/Vollzugsform) wird geschätzt, dass ungefähr bei
der Hälfte der weiblichen Gefangenen Drogenkonsumerfahrung bzw. ein
riskanter Drogenkonsum bis hin zu Sucht vorliegt. Wie die männlichen
Gefangenen kommen auch inhaftierte Frauen häufig aus benachteiligten
Verhältnissen; Geschichten von körperlicher, sexueller und emotionaler Gewalt-
und Missbrauchserfahrung sind nicht selten. Der Frauengesundheitsbericht des
RKI geht davon aus, dass rund 35% aller Frauen über 15 Jahre in Deutschland
bereits Opfer von körperlicher und/oder sexualisierter Gewalt geworden sind –
inhaftierte Frauen sind in ihrer Lebensgeschichte noch häufiger betroffen (RKI
2020; Ochmann, N. 2018). Im Vergleich zu männlichen Inhaftierten findet sich
bei Frauen eine höhere Prävalenz psychischer Komorbiditäten wie
Depressionen, Angstzustände, selbstverletzendes Verhalten, PTBS etc. Aber
auch physische Erkrankungen wie Hepatitis, Tuberkulose, Diabetes,
Hypertonie, Adipositas etc. sind häufiger zu sehen.
Des Weiteren unterscheiden sich die Lebenswelten von Frauen in Haft häufig
dadurch von denen der Männer, dass der Aspekt der Familie besonders
belastet ist. Viele der Frauen haben Kinder geboren, für die sie aber aufgrund
ihrer Lebensumstände kein Sorgerecht haben. Oder sie mussten sich aufgrund
der Inhaftierung von ihren Kindern trennen und diese anderweitig unterbringen.
4Das Konzept ist vorrangig für Erwachsene entwickelt worden, kann aber, entsprechend
modifiziert, auch für Jugendliche genutzt werden.
9Aufbau und Gestaltung der Module sollten geschlechtersensibel sein. Oft genug
berücksichtigen haftinterne Versorgungsstrukturen die Unterschiedlichkeit der
Geschlechter nicht ausreichend (Reuter, S./ Behrens, M. 2014). So beklagen
inhaftierte Frauen, dass zu häufig männliche Ärzte die gynäkologische
Versorgung durchführen. Wir empfehlen aufgrund der besonderen
Vulnerabilität inhaftierter Frauen ausdrücklich, die Veranstaltungen im
Frauenvollzug von Referentinnen durchführen zu lassen.
Die Module
Die Module für Gefangene, entwickelt auf Grundlage unterschiedlicher
Fachexpertisen, zielen ab auf Stärkung der Gesundheitskompetenz. Die
Module sind in verschiedene Themenschwerpunkte eingebettet, die mit
Hintergrundinformationen und Argumenten hinsichtlich der Wichtigkeit und
Bedeutung der Thematik ausgestattet sind. Die Module für die Mitarbeiter:innen
der JVA haben denselben Aufbau und dieselbe Struktur wie die Module für
Inhaftierte.
Die Struktur der Module ist einheitlich: Ziele, Inhalt, Kooperation, Anmerkungen.
Jedes Modul benennt mehrere mögliche Ziele. Welche(s) Ziel(e) bei der
Umsetzung fokussiert werden soll, obliegt den Fachpersonen, die mit der
Durchführung betraut werden.
Dies gilt ebenso für den Abschnitt Inhalte. Hier werden Aspekte,
Fragestellungen und Themenfelder erwähnt, die mit dem jeweiligen
Modulschwerpunkt in Verbindung stehen. Es muss nicht jeder einzelne
Punkt/Aspekt aus dem Abschnitt Inhalt in einer Veranstaltung
untergebracht/bearbeitet werden. Die Auflistung im Anschnitt der Inhalte ist als
Anregung und gedanklicher Anstoß zu verstehen. Auch hier obliegt es der – an
den Bedarfen der jeweiligen Zielgruppen/Teilnehmer:innen orientierten –
Entscheidung der durchführenden Fachperson(en), welche Inhalte umgesetzt
werden sollen.
Im Abschnitt Kooperation sind Organisationen, Institute, Fachexpert:innen
und/oder Einrichtungen aufgelistet, die bei der Umsetzung der Inhalte
unterstützend sein können – sei es als durchführende Partner:innen vor Ort
oder als Inputgeber:in im Zuge der Planung und Vorbereitung der
Veranstaltungen. Aus bisherigen Erfahrungen mit Veranstaltungen in
Justizvollzugsanstalten wissen wir, dass aus Kapazitäts- und
Akzeptanzgründen eine Umsetzung häufig leichter mit Hilfe externer
Kooperationspartner:innen gelingt.
Unter dem Abschnitt Anmerkungen sind ergänzende Hinweise und
Anregungen zu finden, die aus unserer Sicht hilfreich sein können.
102.1 Umsetzung der Module für Inhaftierte
Elementare Voraussetzung für eine gute Umsetzung des Konzeptes und der
einzelnen Module sind Überlegungen zu Herangehensweise, Setting sowie
Bewerbung der Veranstaltung(en).
Format und Methodik
Das Konzept gibt weder Format noch Methodik für die Module vor. Die Art der
Umsetzung ist sehr von Expertise, gestalterischen und methodischen Ansätzen
der Fachperson(en), Schwerpunktsetzung und inhaltlicher Zielausrichtung
aufgrund der Bedarfe der Teilnehmenden sowie den Rahmenbedingungen des
Hauses abhängig. Nicht jedes mögliche Format – wie Workshop,
Informationsveranstaltung, interaktives Gruppensetting – ist für jedes Thema
geeignet oder überall umsetzbar.
Generell ist es möglich – und häufig empfiehlt es sich – aus den Inhalten eines
Moduls eine Reihe oder Serie zu konzipieren. Inhalte verschiedener Module zu
kombinieren und eine modifizierte Veranstaltung(sreihe) zusammen zu stellen
ist ebenfalls eine weitere Option.
Gruppengröße
Um die Inhalte der verschiedenen Schwerpunkte im Diskurs mit den
Teilnehmenden erarbeiten zu können, sollten die Module in nicht zu großen
Gruppen durchgeführt werden. Erfahrungsgemäß ist eine Anzahl von 10 bis
maximal 15 Personen geeignet, Raum für Fragen und Interaktion zu bieten.
Freiwilligkeit
Die Teilnahme an einer Veranstaltung sollte auf freiwilliger Basis erfolgen. Eine
Teilnahme unter Auflagen (beispielsweise als obligatorisch nach positiver
Drogen-Urinkontrolle), Nachteile oder gar Sanktionen bei Nichtteilnahme sind
nicht zielführend und produzieren Widerstände.
Setting/Rahmen der Veranstaltungen
Aufmerksamkeitsspanne und Konzentrationsfähigkeit der Teilnehmenden sind
bei der Festlegung der Veranstaltungsdauer und Pausenplanung zu
berücksichtigen.
Der Veranstaltungsraum sollte so störungsfrei wie möglich sein. Insbesondere,
da teilweise auch sensible Themen angesprochen werden, muss ein
„geschützter Rahmen“ angestrebt werden (kein Durchgangsraum, nicht
einsehbar, auch akustisch ungestört).
11Zu einem geschützten Rahmen gehören auch klare Umgangsregeln (Respekt,
Verschwiegenheit etc.), die zu Beginn jeder Veranstaltung besprochen werden
und die für alle verbindlich sind.
Kommunikation und Didaktik
Die sprachliche Verständigung muss sichergestellt sein. Da in
Justizvollzugsanstalten der Anteil von Menschen nichtdeutscher Herkunft
teilweise sehr hoch ist, kann der Einsatz von Sprachmittlern erforderlich sein5.
Die Veranstaltungen sind auf Kommunikationsbedürfnisse und -fähigkeiten
sowie Lernniveau der Teilnehmer:innen abzustimmen. Grundsätzlich ist
einfache Sprache zu bevorzugen, in der auch komplexe Sachverhalte möglichst
verständlich darstellbar sind.
Da es in keinem Modul ausschließlich um Informationsvermittlung geht, ist
„Frontalunterricht“ nicht angemessen. Vielmehr soll der Diskurs mit den
Teilnehmer:innen gesucht werden, indem sie zu vertrauensvoller Mitarbeit
ermutigt und angeregt werden und die Möglichkeit bekommen, Fragen,
Erfahrungen und eigene Expertise einzubringen.
Die Erzeugung einer „entspannten“ Atmosphäre, spielerische
Herangehensweise und Humor erleichtern erfahrungsgemäß den Zugang zu
den Teilnehmer:innen.
Bewerbung der Veranstaltungen
Die Erfahrung mit den Angeboten der Veranstaltungsreihe der Deutschen
Aidshilfe zeigt, wie wichtig es ist, einen ansprechenden Titel zu finden, der die
möglichen Interessent:innen nicht abschreckt. Er muss so gewählt sein, dass er
keine Grundlage für Stigmatisierung oder Outing von Teilnehmer:innen ist.
Es empfiehlt sich die rechtzeitige Klärung der idealen Bekanntmachungswege
für die jeweilige Veranstaltung. Je nach Thema können dies Aushänge sein
oder Informationen durch beispielsweise Abteilungsleiter:innen,
Kursleiter:innen/ Werksbeamt:innen, interne/externe Berater:innen.
Weitere Aspekte
Die Teilnahme an Veranstaltungen darf Gefangenen nicht zum Nachteil
gereichen (z.B. Verdienstverlust, Anrechnung auf Besuchszeiten).
Idealerweise – und als möglicher zusätzlicher Anreiz zur Teilnahme – werden
die Veranstaltungen als Elemente von Resozialisierungsmaßnahmen/sozialem
Training anerkannt.
5Zu berücksichtigen ist der erhöhte Zeitaufwand pro zu übersetzender Sprache – je mehr
Sprachen, desto länger wird die Veranstaltung dauern.
12Die Anbindung von Veranstaltungen an bestehende Strukturen, wie
beispielsweise Schulklassen, Ausbildungskurse, ehrenamtlich angeleitete
Gruppen, Angebote der Drogenhilfe verringert den organisatorischen Aufwand
erheblich.
2.2 Umsetzung der Module für Mitarbeiter:innen
Bei Veranstaltungen für Mitarbeiter:innen sind ebenfalls einige Aspekte zu
berücksichtigen:
Format und Methodik
Auch für die Umsetzung der Module für Mitarbeiter:innen gibt es keine
Vorgaben für Format und Methodik. Allerdings kann in der Arbeit mit Personal
auch Frontalunterricht sinnvoll sein.
Gruppengröße
Die Gruppengröße sollte 20 Personen nicht übersteigen. Da die
Stationen/Abteilungen aber häufig personell unterbesetzt sind, finden
Veranstaltungen für Mitarbeiter:innen – wenn sie nicht anstaltsübergreifend
organisiert sind – eher mit weniger Personen statt.
Freiwilligkeit
Eine freiwillige Teilnahme an einer Veranstaltung ist immer anzustreben, kann
unter Umständen aber nicht immer eingehalten werden (Notwendigkeit der
Aktualisierung des Wissensstandes, akute Bedarfe des Hauses).
Setting/Rahmen der Veranstaltungen
Auch hier sind die Anforderungen an das Setting ähnlich wie in der Arbeit mit
Gefangenen: Einhalten der Gruppenregeln (Einigung auf Verschwiegenheit,
Einigung respektvollen Umgang u.a.) und ein geeigneter ruhiger Ort ohne
Störfaktoren sind sehr wichtig.
Bei Modulen/Veranstaltungen, die über reine Informationsvermittlung
hinausgehen, sollte darauf geachtet werden, dass die
Gruppenzusammensetzung möglichst homogen ist. Die Anwesenheit von
Kolleg:innen in Leitungspositionen beispielsweise kann sich auf die Bereitschaft
zur Mitarbeit auswirken.
Weitere Aspekte
Veranstaltungen sollten als Dienstzeit anerkannt werden, auch wenn sie
freiwillig besucht werden (Erhöhung der Bereitschaft zur Teilnahme).
132.3 Hinweise zur organisatorischen Umsetzung
Eine Installation des Konzeptes kann nur gelingen, wenn eine hauptamtliche
Person mit der Umsetzung verantwortlich betraut und zuverlässig erreichbar ist.
Eine Vertretung für Urlaubs- und Krankheitszeiten muss gewährleistet sein.
Der Stundenumfang richtet sich an der Nachfrage (Anzahl und Frequenz der
Veranstaltungen) aus und daran, ob die verantwortliche Person auch selbst als
Referent:in tätig ist oder sich auf die Organisation beschränkt.
Werden die Veranstaltungen nicht von den JVA selbst organisiert, ist die
Einhaltung von Genehmigungswegen besonders wichtig (Aidshilfe Köln et al.
2008).
Mittel für Honorare und Fahrtkosten müssen ebenso sichergestellt sein wie
ausreichende Sachmittel (Beamer, Flipchart, Bewerbung usw.).
143 Förderung und Stärkung der
Kompetenzen von Menschen in Haft
3.1 Schwerpunkt Substanzkonsum
In Haftanstalten befinden sich viele Menschen, die an Sucht oder Abhängigkeit
erkrankt sind – nicht zwangsläufig stoffgebunden. Auch Spielsucht
beispielsweise kann durchaus im Zusammenhang mit Straffälligkeit stehen.
Deutlich überrepräsentiert sind aber Menschen, die aufgrund oder im
Zusammenhang mit ihrer Substanzabhängigkeit im Justizvollzug einsitzen.
Schätzungen zufolge sind bis zu 30% der inhaftierten Männer und rund 50%
der inhaftierten Frauen Menschen mit intravenösem Substanzkonsum
illegalisierter Substanzen. Hinzu kommen die Gefangenen, die in
gesundheitsgefährdendem Ausmaß legale Substanzen wie Alkohol,
Medikamente, NPS (sogenannte Designerdrogen) oder Tabak konsumieren.
Obschon insbesondere die meisten Opioidkonsument:innen als Expert:innen
ihrer Abhängigkeit, zumindest was die Beschaffenheit der Substanzen angeht,
anzusehen sind und zum Teil bereits Therapieerfahrung gemacht haben, treten
doch häufig Fragen im engeren und weiteren Zusammenhang mit dem Konsum
psychoaktiver Substanzen auf, die in diesem Modul besprochen werden
können.
Da der Themenkomplex sehr umfangreich ist, kann es schwierig sein, allen
Bereichen innerhalb einer Veranstaltung gerecht zu werden. Es bietet sich also
an, die jeweiligen Schwerpunkte als Einzelveranstaltung zu planen.
Modul 01:
Substanzkonsum – Auswirkungen, Risiken, Prävention
Ziel Kompetenzstärkung
Schärfung des Problembewusstseins
Stärkung der Selbstverantwortung
Aufzeigen von Strategien zur Risikominimierung und
Verhaltensprävention
Inhalt Darstellung der Zusammenhänge von
Substanzkonsum und möglichen Auswirkungen auf
den Organismus:
Infektionserkrankungen
Fehl-/Mangelernährung
15Erkrankungen der Organe:
Lunge, Leber, Haut, Hirn, Herz,
Gefäßerkrankungen
Zahngesundheit
Leistungsfähigkeit/Belastbarkeit
Libido
Fertilität
Psyche, Wahrnehmung, Urteilsfähigkeit
Bei Frauen zusätzlich:
Zyklus
Schwangerschaft, Entbindung, Stillen
(vorzeitiger Beginn des) Klimakteriums
Erläuterung von Therapieansätzen:
Abstinenzorientierte Therapien
Substitutionstherapie
Konsumreduktionsprogramme:
Tabakentwöhnung
Akupunktur
Möglichkeiten der Selbsthilfe
Informationen zu gängigen Präventionsmaßnahmen:
Risiko unklarer Inhaltsstoffe (z.B. NPS),
Verunreinigungen
Safer Use
Safer Sex
Unterstützungsangebote in Haft:
Akupunktur
Beratung
Substitution
16Haftentlassung:
Risiko Überdosierung
Erste Hilfe, Naloxon
Kooperation Deutsche Aidshilfe/Regionale Aidshilfen
Internisten:innen
Drogenhilfeeinrichtungen bzw. Fachberatungsstellen
mit dem Schwerpunkt Sucht – Substanzkonsum -
Substitution
Einrichtungen der Selbsthilfe, z.B. JES
Anmerkung Als thematische Ergänzung bieten sich folgende
Module an:
HIV und Hepatitiden
Leber
Ausgewogene Ernährung
Hygiene
Gesundheit im Alter
173.2 Schwerpunkt Prävention
HIV und Hepatitiden
Neben einer grundsätzlich höheren Prävalenz somatischer Erkrankungen gibt
es in Haftanstalten überproportional viele Menschen mit Suchterkrankung, mit
der häufig Erkrankungen wie Hepatitiden und HIV einhergehen. Gefängnisse
gelten dadurch als Hochrisikobereich für Infektionserkrankungen. Menschen
werden in Zwangsgemeinschaften zusammengebracht, auch auf engem Raum
in Saalunterbringung. Das Wissen um Infektionserkrankungen bei
Mitgefangenen verunsichert, weckt Ängste und kann zu Ausgrenzung führen.
Welche Infektionserkrankungen sind insbesondere in Haft von Bedeutung, mit
welchen wird man auch nach der Entlassung konfrontiert? Wie groß ist die
Infektionsgefahr? Welche Schutzmaßnahmen gibt es, was muss berücksichtigt
werden, welche Maßnahmen sind in Haft verfügbar? Wie geht man mit
Infektionen im Umfeld oder mit der eigenen möglichen Infektion um?
Modul 02: HIV und Hepatitiden
Ziel Aktualisierung des Wissensstandes
Entwicklung eines Problembewusstseins
(Blood-Awareness)
Kompetenzstärkung für adäquate individuelle
Risikoeinschätzung
Abbau von Unsicherheiten als Basis von
Diskriminierung und Stigmatisierung Infizierter
Stärkung der Selbstverantwortung
Verhaltensänderung, Entwicklung präventiver
Routinen
Inhalt Aktuelle Informationen zu viralen
Infektionserkrankungen (Hepatitis A, Hepatitis B,
Hepatitis C, HIV/AIDS)
Infektionswege, Infektionsrisiko im Haftalltag, im
Betrieb, im privaten Umfeld (Ausgang/Freigang/nach
Entlassung)
Infektionsvermeidung, Präventionsmöglichkeiten:
Allgemeine Hygiene: Gebrauch von Zahnbürsten,
Rasierern, Schneidewerkzeugen, Vermeidung von
Spritzenabszessen
18Safer Sex: Aufklärung zum Kondomgebrauch,
Femidom, HIV-Schutz durch Therapie, HIV-PrEP
Sprechen über medikamentöse Notfallmaßnahmen
bei HIV und HBV
Safer use: Informationen zum sichereren
Substanzkonsum
Informationen zu Schutzimpfungen
Therapieoptionen
Rechtliche Fragen: Gibt es eine Informationspflicht?
Recht auf informationelle Selbstbestimmung,
Anspruch auf Verschwiegenheit
Kooperation Deutsche Aidshilfe/Regionale Aidshilfen
Infektiolog:innen
Drogenhilfeeinrichtungen bzw. Fachberatungsstellen
mit dem Schwerpunkt Sucht (zur Unterstützung für
den Bereich safer use)
Hochschulen mit Studiengang
Gesundheitswissenschaften
Anmerkungen Kontroverse Haltungen zum Thema Übernahme von
Verantwortlichkeit und Schuld (-zuweisung) sind in
diesem Modul erwartbar und sollten zeitlich
eingeplant werden.
Selbstverständlich kann dieses Modul um aktuelle
Themen, wie SARS COV2/Corona erweitert werden.
Als thematische Ergänzung bieten sich folgende
Module an:
Tattoo und Piercing
Sexuell übertragbare Infektionen
Verhütung
Leber
19Tattoo und Piercing
In Haft zwar nicht gestattet, dennoch beliebt: Gefangene lassen sich während
ihrer Inhaftierung tätowieren oder piercen. Mehr oder weniger erfahrene Laien
stechen Mitgefangenen mithilfe phantasievoll gebastelter Maschinen und
Nadeln und selbst angerührter Farben Tattoos oder Piercings. Die für Tattoo-
Studios geltenden Hygiene- und Materialanforderungen für steriles und
sicheres Arbeiten können nicht erfüllt werden (Ausnahme Luxemburg: im
dortigen Gefängnis Schrassig gibt es seit 2017 ein „Inmates-Tattoo-Studio“).
Modul 03: Tattoo und Piercing
Ziel Aufklärung über mögliche gesundheitliche Risiken
von Tattoo und Piercing.
Schadensminimierung
Förderung des Risikomanagements
Anregung zur Reflexion über die Entscheidung für
Körperschmuck
Inhalt Tattoo/Piercing als Gesundheitsrisiko:
Infektionen mit Bakterien und/ oder Viren (HBV,
HCV, HIV)
Nerven- und Gewebeschädigungen v.a. beim nicht-
professionellen Piercen
Mögliche Langzeitfolgen durch giftige Bestandteile
der Tattoo-Farben: Allergien, Hauterkrankungen,
Organerkrankungen, Krebserkrankungen
Besprechung/Klärung folgender Fragen:
Welche Hygienemaßnahmen sind Voraussetzung
für risikoarmes Tätowieren/Piercen?
Welche Schutzmöglichkeiten habe ich/stehen mir
zur Verfügung?
Wie pflege ich die Wunden durch ein frisch
gestochenes Tattoo/Piercing?
Woran erkenne ich, dass eine Infektion
stattgefunden hat? Sollte ich damit zur Ärztin/zum
Arzt gehen?
Können Tätowierungen rückgängig gemacht
werden? Welche Voraussetzungen gibt es dafür?
Wo finde ich geeignete Ärzt:innen?
20Tattoo/Piercing als Ausdruck der Persönlichkeit:
Aus welchen Gründen möchte ich ein Tattoo oder
Piercing? Wo soll es platziert sein?
Was soll das Tattoo/Piercing über mich aussagen?
Passt das Tattoo auch in einigen Jahren oder in
einer veränderten Lebenssituation noch zu mir?
Wie wirkt mein Körperschmuck auf die Außenwelt?
Gibt es soziale Nachteile insbesondere nach
Entlassung (Beispielsweise bei der Arbeits-
und/oder Wohnungssuche)?
Bin ich mir bei meiner Entscheidung wirklich sicher?
Muss das Tattoo unbedingt in Haft gestochen
werden?
Wo finde ich außerhalb der Haft ein Studio und wie
erkenne ich, dass nach den aktuellen
Hygienestandards gearbeitet wird?
Kooperation Deutsche Aidshilfe/Regionale Aidshilfen
Mitarbeiter:innen von Tattoo-Studios
Dermatolog:innen
Anmerkung Das Modul ist geeignet das Interesse an einer
intensiveren Auseinandersetzung mit HIV und
Hepatitiden zu wecken.
21Leber
Die Prävalenz von Lebererkrankungen ist bei Gefangenen im Vergleich zur
Allgemeinbevölkerung deutlich erhöht. Der Konsum illegaler Drogen, v.a.
intravenös appliziert, führt zu viral bedingten Hepatitiden. Der erhöhte Konsum
legaler Substanzen wie Alkohol birgt das Risiko der Entwicklung einer
alkoholbedingten Fettleber (ASH); Fehlernährung, Übergewicht, erhöhte
Blutfettwerte und Medikamentengebrauch können zur nicht-alkoholischen
Fettleber (NASH) führen.
Dieses Modul bietet Gefangenen die Möglichkeit, ihr Wissen um das
lebenswichtige Organ zu vertiefen.
Modul 04: Leber
Ziel Wissensvermittlung zu Bedeutung und
Funktionsweise des größten Entgiftungsorgans
Aufbau eines Problembewusstseins
Erlernen von Möglichkeiten zur Unterstützung der
Leberfunktion
Inhalt Bedeutung der Leber für den Gesamtorganismus,
wie beispielsweise Entgiftung, Bildung von
Hormonen.
Funktion und Aufbau
Reaktion der Leber auf:
Alkohol
Ernährung
Illegale Substanzen
Infektionen
Medikamente
Regenerationsfähigkeit der Leber
Leberstützende Maßnahmen
(Ernährung, Bewegung)
Prävention (Impfung)
Risikomanagement (safer sex, safer use)
22Kooperation Deutsche Aidshilfe/Regionale Aidshilfen
Infektiolog:innen/Hepatolog:innen
Leberhilfe
Ökotropholog:innen
Anmerkung Als thematische Ergänzung bieten sich folgende
Module an:
HIV und Hepatitiden
Hygiene
Substanzgebrauch
Ausgewogene Ernährung
23Gesundheit im Alter
Die Gesellschaft altert, somit finden sich auch im Justizvollzug zunehmend
ältere Menschen, entweder, weil sie lange oder immer wieder inhaftiert sind,
oder weil sie als ältere Menschen – eine besondere Herausforderung – erstmals
zu einer Haftstrafe verurteilt sind. Der Alterungsprozess kann sich massiv auf
die eigene Identität auswirken und das gewohnte Selbstbild und
Selbstvertrauen in Frage stellen.
Dieses Modul richtet sich nicht nur an schon Ältere, sondern an alle
interessierten Gefangenen, die sich mit dem Thema (drohendes) Alter
beschäftigen oder sich vielleicht auch darum sorgen.
Modul 05: Gesundheit im Alter
Ziel Informationsvermittlung zu sich im Laufe der Jahre
entwickelnden Veränderungen von Körper und Geist
Auseinandersetzung mit möglichen zu erwartenden
Körperveränderungen und Erkrankungen
Erarbeitung von (präventiven)
Handlungsmöglichkeiten zur Aufrechterhaltung von
Mobilität und Vitalität auch im höheren Alter
Stärkung der Selbstsorge
Inhalt Fortschreitendes Lebensalter geht einher mit
psychischen wie physischen bis hin zu
hirnorganischen Veränderungen.
Häufig auftretende Einschränkungen:
Verlust von Körperkraft und Beweglichkeit
Gewichtsveränderungen
Veränderung der Sexualität
(Libidoverlust, Trockenheit der Schleimhäute,
Prostataprobleme, Dysfunktionen)
Stimmungsschwankungen, Schwermut, depressive
Verstimmungen
Veränderung der Gehirnleistung
(u.a. Demenzerkrankungen)
Hirnschädigungen durch Substanzkonsum
Herz-Kreislauferkrankungen
Diabetes/Stoffwechselerkrankungen
Tumorerkrankungen
24Möglichkeiten zur Statuserhaltung und Prävention:
Bewegung: Muskelaufbau bzw. Verhinderung von
Muskelabbau, Trainieren von Gleichgewichtssinn
und Koordination
„Gehirnjogging“: Trainieren von Konzentration und
Aufnahmefähigkeit
Aufbau/Förderung sozialer Kontakte
Ernährung
Medizinische Untersuchungen zur Früherkennung
Reduktion von Rauchen und/oder Substanz-
/Alkoholkonsum
Kooperation Deutsche Aidshilfe/Regionale Aidshilfen
Mediziner:innen
Geriatrische Fachkräfte
Fitness-Trainer:innen
Hochschulen mit Studiengang Pflegewissenschaften
Selbsthilfegruppen (Fit im Alter o.ä.)
Anmerkungen Die Themen Tod, Sterben und der Umgang mit Trauer
und Verlust sollten bei Bedarf angemessenen Raum
finden können.
Als thematische Ergänzung bietet sich folgendes
Modul an:
Ausgewogene Ernährung
25Fokus: Sexualität
Die haftbedingte Trennung von Familie, Partner:innen, Freunden und die
fehlenden Möglichkeiten frei gewählter sozialer Kontakte mindern nicht den
Wunsch und die Sehnsucht nach Beziehungen, Familie, Sexualität. Eher ist das
Gegenteil der Fall und Gefangene erhoffen von einer (zukünftigen)
Partnerschaft und Familiengründung sehr viel an Zugewinn von Geborgenheit,
Stabilität, Absicherung bis hin zur Beendigung ihrer Abhängigkeitsprobleme.
Das Ausleben von Sexualität in Haft ist offiziell nur sehr begrenzt möglich.
Selbst wenn eine Anstalt über Langzeitbesuchsräume verfügt, kann nicht jede:r
Gefangene eine stabile Partnerschaft vorweisen, die die Voraussetzung für die
Gewährung von Langzeitbesuch darstellt.
Geschlechtergetrennte Unterbringung unterbindet zwar heterosexuelle
Kontakte zwischen den Gefangenen, sexuelle Bedürfnisse und das Bedürfnis
nach Nähe bleiben jedoch – Stichwort „Knasthomosexualität“. Auch kann davon
ausgegangen werden, dass sexuelle Dienstleistungen in Haftanstalten
angeboten werden.
Sexualität sollte kein Tabuthema sein – auch nicht in Haft.
Die beiden folgenden Module befassen sich auf den ersten Blick vorrangig mit
der Vermeidung unerwünschter Folgen gelebter Sexualität. Sie bieten über den
Zugang der Prävention aber eine Einstiegsmöglichkeit in das aus Gründen wie
Unsicherheit oder Scham oft vermiedene Thema Sexualität. So kann - über die
Vermittlung rein biologisch-medizinischer Fakten hinausgehend - auf
psychosoziale Dynamiken von Sexualität eingegangen werden.
Erfahrungsgemäß können in diesen Zusammenhängen weitere Themen wie
Kinderwunsch, Schwangerschaft, Partnerschaft, sexuelle Orientierung u.a. zur
Sprache kommen. Bei Bedarf sollte geprüft werden, ob entsprechend
weiterführende sexualpädagogische Einheiten entwickelt und angeboten
werden.
26Modul 06: Sexuell übertragbare Infektionen
Ziel Wissensvermittlung zu einzelnen sexuell
übertragbaren Infektionen (STI)
Förderung individuellen Problembewusstseins
Abbau von Unsicherheiten in Bezug auf
Übertragungswege
Stärkung der Risikoeinschätzungskompetenz
Aufzeigen von Strategien zur
Infektionsvermeidung/Prävention
Inhalt Basisinformationen zu STI (Syphilis, Gonorrhoe,
Chlamydien, HPV)
Übertragungswege und mögliche Symptome der
jeweiligen Infektionen
Hemmungen überwinden mit Ärztin/Arzt über eine
befürchtete STI zu sprechen
Schutzmöglichkeiten/Verhütungsmethoden:
Kondomgebrauch, Lecktücher (Dental Dam),
Femidom, Impfung HPV
Welche Präventionsmöglichkeiten gibt es auch in
Haft?
Wie wirkt sich das Risiko einer Infektion auf die
Ausübung meiner Sexualität aus? Kann ich diese
noch leben wie gewünscht?
Wie spreche ich mit meiner Sexualpartnerin/meinem
Sexualpartner über den Umgang mit einem
STI-Risiko?
Wer trägt Verantwortung für die
Infektionsvermeidung?
Kooperation Deutsche Aidshilfe/Regionale Aidshilfen
Fachärzt:innen aus den Bereichen
Gynäkologie
Venerologie
Infektiologie
pro familia Beratungsstellen/
Familienplanungszentren
27Anmerkung Bei der Umsetzung in einer JVA für Frauen sollen
vorzugsweise Referentinnen und weibliche
Fachärztinnen eingesetzt werden (siehe Kapitel 2:
Besonderer Situation inhaftierter Frauen).
Kontroverse Haltungen zu den Themen
„Verantwortlichkeit“ und „Schuld (-zuweisung)“ sind in
diesem Modul erwartbar.
Als thematische Ergänzung bietet sich folgendes
Modul an:
HIV und Hepatitiden
28Modul 07: Verhütung
Ziel Informationen zu gängigen und alternativen
Verhütungsmethoden
Risikomanagement
Vermeidung von Infektionserkrankungen und
ungewollter Schwangerschaft
Abbau von Hemmungen über Verhütung und
Sexualität zu sprechen
Inhalt Ziel von Verhütung
Aufbau und Funktionen der primären und
sekundären Geschlechtsorgane
Darstellung unterschiedlicher
Verhütungsmöglichkeiten
Hinweise zur praktischen Anwendung der jeweiligen
Methoden/Mittel
Chancen und Risiken der jeweiligen
Verhütungsmethode/-mittel
Alternative Verhütungsmöglichkeiten
Welche Verhütungsmethode ist für meine Situation
passend?
Wie spreche ich mit meiner Partnerin/meinem
Partner über Verhütung?
Wer übernimmt Verantwortung für die Verhütung?
Kooperation Deutsche Aidshilfe/Regionale Aidshilfen
pro familia Beratungsstellen/
Familienplanungszentren
Anmerkung Erfahrungsgemäß bietet sich ein Exkurs zu
„Sexualität und Sprache“ an: angemessene
Benennung von Körperbereichen/-regionen im
Gegensatz zu diskriminierend-abwertender Sprache.
Kontroverse Haltungen zu den Themen
„Verantwortung“ und „stereotype Rollenzuweisungen“
sind in diesem Modul erwartbar.
293.3 Schwerpunkt Psychosoziale Kompetenzen
Das psychische Befinden ist ebenso elementarer Bestandteil der Gesundheit
wie das körperliche und kann unter anderem durch Stress stark belastet
werden. Die Zeit in Haft bringt einige Stressoren mit sich. Die Module in diesem
Kapitel widmen sich daher den Schwerpunkten „Stress“, „Erhalt sozialer
Kontakte“, „Haltungen und Wertesysteme“ und „gewaltfreie Kommunikation“.
Sie bieten den Teilnehmenden an, sich aktiv mit unterschiedlichen belastenden
Situationen zu beschäftigen und individuelle Wege zur Stressreduktion zu
erkunden.
WICHTIG: Es handelt sich hierbei nicht um gruppentherapeutische Angebote.
Therapeutische Angebote im Einzel- oder Gruppensetting sollten entsprechend
von den dafür zuständigen psychologischen Mitarbeiter:innen entwickelt und
angeboten werden.
Ein besonderer Stressor in Haft ist Erleben von oder Angst vor Gewalt. Zur
Bearbeitung des Gewaltthemas empfehlen wir die Nutzung der inzwischen
etablierten Antigewalttrainings und Angebote zu Gewaltprävention in Haft.
Modul 08: Umgang mit Stress
Ziel Darstellung verschiedener Methoden und Strategien
zur Stressbewältigung
Aneignung von Bewältigungskompetenzen und
Coping-Strategien
Stärkung der Resilienz
Inhalt Einführung in das Thema Stress:
Begriffsdefinition (Eustress, Disstress)
Ursachen, Entstehung und Auslöser von Stress
Eingehen auf Kontraindikationen
(z.B. Substanzgebrauch, provozierendes Auftreten)
Für die Entwicklung individueller Präventions- und
Bewältigungsstrategien können folgende Themen
und Fragestellungen hilfreich sein:
Auseinandersetzung mit der aktuellen
Situation: Eingesperrtsein, Aggressionen,
Unsicherheiten, Überforderungen,
Einsamkeit
Eigene Erfahrungen im Umgang mit Stress
30mentale und physische
Entlastungsmethoden: Sport, Yoga,
Entspannungstechniken, Akupunktur,
Singen, kreatives Schreiben, künstlerische
Angebote u.ä.
Kooperation Anti-Stress-Trainer:innen
Psycholog:innen
Anmerkung Dieses Modul sollte – nach einem kurzen Input durch
die Referent:innen – als offener Gruppendiskurs
angeboten werden.
Das Modul könnte als Impuls für eine
Entspannungsgruppe dienen. Interesse daran wird es
wahrscheinlich eher im Langstrafenvollzug geben, da
dort die Positionen in der Hierarchie ausgefochten
und gefestigt sind. Im Kurzstrafenvollzug muss mit
weniger Interesse gerechnet werden, da sich niemand
als „Weichei“ präsentieren will.
31Soziale Kontakte
Inhaftierung und Verurteilung betreffen nicht nur die Gefangenen selbst,
sondern wirken sich auch auf ihr soziales Umfeld, ihre Freunde und Familien
aus. Dies wiederum bedeutet eine weitere Belastung für Inhaftierte. Ihnen sind
die Hände gebunden, wenn sie um Probleme in ihrem sozialen Umfeld wissen,
und sie sorgen sich, ob ihre Inhaftierung sie nicht von Familie und Freunden
trennen wird. Manch einer bricht vorsorglich, um einem möglichen
Trennungsprozess vorzugreifen, Kontakte ab.
Dieses Modul ist als Anregung gedacht, individuelle Wege zu entdecken, mit
der Belastung durch die Veränderung sozialer Bezüge lösungsorientiert
umzugehen und Perspektiven zu entwickeln.
Modul 09: Erhalt sozialer Kontakte
Ziel Erarbeitung und Entwicklung von
Entlastungsstrategien
Aufbau und/oder Stärkung der Selbstwirksamkeit im
Kontakt mit dem sozialen Umfeld
Anregung zur Perspektivenentwicklung
Inhalt Folgen der Inhaftierung:
Trennung von Familie, Freunden, Bezugspersonen
Verlust von Haushaltseinkommen = Folgeprobleme
wie drohender Wohnungsverlust
Ächtung/Kontaktabbruch aufgrund des Deliktes
Scham und Schuldgefühle
Ohnmacht, Hilflosigkeit
Unsicherheit im Umgang mit dem sozialen Umfeld
Erwartungen, Befürchtungen, Ängste in Bezug auf
Familie und Freunde:
abgelehnt zu werden
eine emotionale und finanzielle Belastung zu sein
nahestehende Menschen zu stigmatisieren
den Kontakt zu verlieren, verlassen zu werden
32Typische Fragestellungen, die daraus resultieren:
Wie sage ich es meiner Familie, meinen
Bezugspersonen, meinem sozialen Umfeld?
Wie kann es mir gelingen, meine
Partnerschaft/Freundschaften/Kontakt zur Familie
aufrecht zu erhalten?
Wie kann ich verlorenen Kontakt auch aus der Haft
heraus wieder aufnehmen?
Welche Möglichkeiten habe ich, mit meinen
Befürchtungen und Sorgen umzugehen, Grübeleien
und „Kopfkarussel“ abzustellen?
Wie löse ich innere Konflikte? Wie treffe ich die
richtigen Entscheidungen?
Aufzeigen der vor Ort vorhandenen Angebote und
Möglichkeiten: Freizeitangebote, die bei Stressabbau
helfen können (z.B. Sport, Yoga, Chor)
Eigene Möglichkeiten: Tagebuch/Briefeschreiben,
Malen/Zeichnen u.a.
Unterstützungsmöglichkeiten durch z.B. Seelsorge,
Soziale Dienste, Beratungsangebote durch externe
Einrichtungen in der JVA
Kooperation Psycholog:innen/Systemiker:innen
Beratungsstellen für Inhaftierte, Haftentlassene und
ihre Angehörigen
Anmerkung Da das Thema auf Seiten der Gefangenen sehr
emotional besetzt sein kann, ist besonders darauf zu
achten, es möglichst auf der Sachebene zu halten.
Möglicherweise zeigt sich ein Bedarf nach Angeboten
speziell für Eltern. In manchen JVA gibt es bereits
Eltern- oder Eltern-Kind-Gruppen. Sollte es vor Ort
noch kein Angebot geben, sollte der Bedarf geprüft
und ein Angebot geschaffen werden.
33Haltungen und Wertesysteme
Im Justizvollzug werden Menschen räumlich zusammengebracht, die
unterschiedliche persönliche Hintergründe haben. Gemeinsam ist ihnen die
Straffälligkeit – und selbst die Straftaten unterliegen unterschiedlichsten
Bewertungen und hierarchischen Einordnungen. Das Aufeinanderprallen
differierender Haltungen, Kulturen und Wertesysteme birgt Konfliktpotential,
das den Stresslevel erhöhen kann.
Respektvoller Umgang mit Unterschiedlichkeit kann Stressoren reduzieren und
somit den Haftalltag erleichtern. Perspektivisch dient die Auseinandersetzung
mit den Themen des Moduls der Vorbereitung auf die Rückkehr in die
Gesellschaft, deren Haltungen und Wertesysteme sich stetig weiterentwickeln.
Modul 10: Haltungen und Wertesysteme
Ziel Abbau von Verunsicherung durch vom eigenen
Lebensentwurf abweichende Lebensgestaltungen
Abbau von Vorurteilen und stereotypen Bewertungen
Sensibilisierung für Stigmatisierung und
Diskriminierung anderer Lebens- und Liebesweisen
Stärkung respektvollen Umgangs
Inhalt Wissensvermittlung Grund- und Menschenrechte
Recht auf (auch sexuelle) Selbstbestimmung
Unterschiedliche Perspektiven auf Lebensentwürfe –
konventionell/unkonventionell
Diversität von Lebens- und Liebesweisen (LSBTIQ*)
Begriffsdefinition und Abgrenzung von Toleranz,
Respekt, Akzeptanz
Auswirkungen von Diskriminierung, Stigmatisierung,
Sexismus, Rassismus und grenzüberschreitendem
Verhalten
Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Normen
und Werten
Reflexion eigener Vorurteile und persönlicher
Grenzen
34Kooperation Mitarbeitende aus interkulturellen Beratungsstellen
Deutsche Aidshilfe/Regionale Aidshilfen
Netzwerk Rassismus und Antidiskriminierung
Bildungsinstitute
Anmerkung Aufgrund der besonderen Komplexität dieses
Themenbereichs bietet es sich an, das Modul als
mehrere Einheiten zu konzipieren.
Als thematische Ergänzung bietet sich folgendes
Modul an:
Gewaltfreie Kommunikation und Sprache
35Gewaltfreie Kommunikation und Sprache
Der Haftalltag ist geprägt von teilweise aggressiven verbalen oder körperlichen
Auseinandersetzungen. Provokantes Auftreten, Missverständnisse und
Verständigungsprobleme können dabei – insbesondere durch den hohen Anteil
nicht Deutsch sprechender Gefangener – eine große Rolle spielen. Um einen
psychisch und physisch stressärmeren und konfliktfreieren Haftalltag zu
schaffen, erscheint es sinnvoll, die Kompetenzen Inhaftierter hinsichtlich
gewaltfreier Kommunikation zu stärken, zu erweitern oder erst zu entwickeln.
Modul 11: Gewaltfreie Kommunikation und Sprache
Ziel Eskalationsprävention
Erlernen gewaltfreier Kommunikation
Inhalt Differenzierung verbaler und nonverbaler
Kommunikation
Dynamiken der Kommunikation:
unterschiedliche Formen verbaler Kommunikation
verschiedene Arten des Zuhörens
Einfluss nonverbaler Botschaften auf die
Kommunikation
unterschiedliche Wahrnehmungen
Aufgreifen von Alltagssituationen:
provozierendes Verhalten
emotionsgeladene Situationen
unterschiedliche Sprachkompetenzen
divergierende Kommunikationsmuster
Sprache als Machtinstrument: rassistischer,
diskriminierender, stigmatisierender und
sexistischer Sprachgebrauch
Kooperation Kommunikationstrainer:innen
Antigewalttrainier:innen
36Anmerkung Bei der Bearbeitung des Themas Kommunikation und
Sprache wird zwangsläufig der Bereich Wertesysteme
berührt. Mit kontroversen Diskussionen muss
gerechnet werden.
Bietet man dieses Modul als Serie an, kann es als
Trainingseinheit zum Erlernen und Erproben
gewaltfreier Kommunikation genutzt werden.
Das Modul kann ebenso als ein Element im
Sprachkurs „Deutsch als Fremdsprache“ eingesetzt
werden.
Als thematische Ergänzung bietet sich folgendes
Modul an:
Umgang mit Stress
373.4 Schwerpunkt Alltagspraktische Fähigkeiten
Bei Gesprächen in Haft und nach Haftentlassung zeigen sich insbesondere bei
Männern, die tradierte Rollenbilder pflegen, oftmals fehlende
Alltagskompetenzen aufgrund mangelnder Kenntnisse und Fähigkeiten.
Ernährung wird in Form von „fast food“/Convenienceprodukten bevorzugt,
welche mit Nährwertbilanz ernährungsphysiologisch und mit relativ hohen
Kosten auch ökonomisch negativ ins Gewicht fallen, insbesondere für ALGII-/
Sozialhilfebezieher und Geringverdienende. Basisinformationen zu Hygiene
und Hauswirtschaften fehlen oftmals ebenso wie ein angemessenes Verhältnis
zu Geld und wirtschaftlichen Möglichkeiten.
Hygiene
Menschen, die lange Zeit Drogen konsumieren oder wohnungs- oder sogar
obdachlos leben, fallen nicht selten durch unzureichende Körperpflege auf.
Hinzu kommt häufig ein sehr schlechter Zahnstatus. Die konsumierten
Substanzen (inklusive Tabak) können Zahnsubstanz und Zahnfleisch angreifen.
Darüber hinaus führen gestörtes Schmerzempfinden und unzureichende
Mundhygiene zu behandlungsbedürftigen Gebissen. Neben der speziellen
Lebenssituation verhindern auch Angst und Scham allzu oft die
Inanspruchnahme (zahn-) medizinischer Behandlung – mit dem Risiko weiterer
gesundheitlicher Schäden (Woltmann, J. 2014).
In Haft allerdings achten die meisten Gefangenen auf sich – eine gute
Gelegenheit, ihnen das Thema Hygiene anzubieten, das den Fokus nicht nur
auf individuelle Körperpflege setzt, sondern mit der Notwendigkeit von
Sauberkeit im Alltag – Küche, Bad, Lebensmittel – kombiniert und damit auf das
Leben in einer (im Idealfall eigenen) Wohnung vorbereiten kann.
Modul 12: Hygiene
Ziel Darstellung der Bedeutung von Hygiene für die
Prophylaxe von Erkrankungen
Vermittlung von Hygieneregeln bei Körperpflege und
im Haushalt
Abbau von Ängsten und Vorurteilen gegenüber
Ärzt:innen (Zahnheilkunde, Dermatologie)
Befähigung zum respektvollen Umgang mit sich
selbst
38Sie können auch lesen