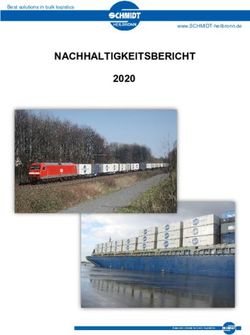Green Shorts NETZWERK - Pflanzenbasierte Ernährung - in Deutschland und Korea
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Bizarr, grotesk und unverständlich – so verhält sich die Vegetarierin ( 채식주의자 ,
chaesigjuuija) für die anderen Charaktere im gleichnamigen Roman der koreanischen
Autorin Han Kang. Yeong-hye, die nach einem Traum über die grausame Natur des
Menschen kein Fleisch mehr isst, sieht sich dem Unverständnis ihres Umfelds
ausgesetzt und wird von ihrem Ehemann für verrückt erklärt. Jenseits dieser Fiktion
erleben vegetarische und vegane Ernährungsformen gerade einen Aufschwung -
besonders in westlichen Ländern. Es gibt eine große Auswahl pflanzlicher Produkte in
den Supermärkten, vegane Restaurants und sogar vegane Alternativen in Fast-Food-
Ketten. Doch wie sieht die Situation in Südkorea aus, Handlungsort von Hang Kangs
Roman und ein Land bekannt für fleischlastige Speisen wie Bulgogi, Chicken und
Korean BBQ? Welche Alternativen gibt es und wie wird Vegetarismus von
Koreaner*innen wahrgenommen?
Nach einem Überblick über die Geschichte der fleischlosen Ernährung in Europa und
Asien geben wir euch Einblicke darin, wie gesellschaftliche Normen und Rollenbilder
die Entscheidung für oder gegen Vegetarismus beeinflussen. Im Anhang findet ihr
schließlich einen kleinen Guide mit Restaurantempfehlungen, Vokabeln und
Rezeptideen für eine möglichst fleischfreie Ernährung in Südkorea. Dieser Short bildet
dabei den Auftakt einer ganzen Reihe von kürzeren Publikationen: Unter dem neuen
Label Green Shorts werden wir uns zukünftig mit dem Themenkomplex Nachhaltigkeit
in Deutschland und Südkorea auseinandersetzen.
Begriffe und Konzepte
Die Zahl der Menschen, die sich pflanzenbasiert ernähren, steigt (siehe Abb. 1). Doch
was genau bedeutet “pflanzenbasierte Ernährung”? Im europäischen Raum prägte der
Ernährungswissenschaftler T. Colin Campbell den Begriff in seinen Studien ab 1980
und dem darauf basierenden Buch China Study: Die wissenschaftliche Begründung für
eine vegane Ernährungsweise maßgeblich. Dort fasst Campbell folgende
Ernährungsweisen unter “pflanzenbasierter Ernährung” zusammen: Flexitarische Diät,
Vegetarische Diät, Vegane Diät, Mittelmeer-Diät und Rohkost-Diät. Was alle diese
Diäten gemeinsam haben, ist der insgesamt größere Anteil pflanzlicher Erzeugnisse als
tierischer Produkte (Wissen Heute Gesundheit 2021). Die Bezeichnung
„pflanzenbasierte Ernährung“ umfasst somit verschiedene Ernährungsweisen, die
ausschließlich oder zu großen Teilen aus pflanzlichen Erzeugnissen bestehen.
1Historische Entwicklungen
Bereits Philosoph*innen des alten Griechenlands debattierten über die Frage, ob es
moralisch vertretbar sei, tierische Produkte zu sich zu nehmen. Ein bekanntes Beispiel
ist Pythagoras, welcher seinen Anhänger*innen geraten haben soll, sich vegetarisch zu
ernähren, da Fleischessen dem Verzehr der eigenen Verwandten gleichkäme
(Leitzmann & Keller 2020: 46). Während der Spätantike war der Fleischkonsum jedoch
mit ca. 20-30 Kg pro Person und Jahr nach heutigen Maßstäben sehr gering. Mit der
Epoche der Völkerwanderung wurde die Schweinemast in Europa immer beliebter und
machte Fleisch günstiger verfügbar. Aufgrund starken Bevölkerungswachstums und
mangelnder Weideflächen, sank der Fleischkonsum zu Zeiten des Hochmittelalters von
einem Niveau von ca. 100 Kg wieder auf 40 Kg pro Person jährlich ab und wurde ein
Statussymbol der Adligen. Erst infolge der Pest und der daraus resultierenden
Bevölkerungsdezimierung bewegte sich der Fleischkonsum aus der Rezession des
Mittelalters heraus und übertraf sogar vorherige Höchstzahlen. Die ca. 110 Kg pro
Person zu Beginn der Neuzeit konnten sich jedoch nur bis zum erneuten Anstieg der
Bevölkerung halten und bis zur Industrialisierung war die Ernährung eines Großteils
der Europäer*innen von Proteinunterversorgung geprägt. Ab 1900 jedoch,
unterbrochen durch die beiden Weltkriege, wurde eine vermehrte Versorgung durch
die Revolutionierung der Produktion, der Wissenschaft und den wirtschaftlichen
Aufschwung möglich. So entwickelte sich Fleisch als Nahrungsmittel zu einem Symbol
des Wohlstandes und der guten Versorgung (ZDF 2013).
Noch älter als die griechische ist die indische Tradition des Vegetarismus, welche fest
im Hinduismus und Buddhismus verankert ist. Gerichte, die in Europa als Trend
wahrgenommen werden, bringen eine lange Tradition und kulturelle Geschichte mit
sich. So stammen beispielsweise die sogenannten 'Buddha Bowls’ aus der meditativen
Ōryōki-Ernährungsweise von Mönchen des Zen-Buddhismus. Die Mahlzeit wird in
absolutem Schweigen und mit größter Achtsamkeit zu sich genommen. Die Schüsseln
beinhalten genau so viel Nahrung, wie zur Deckung des täglichen Bedarfs nötig ist
(Fitneo 2021). Solche kulturellen und religiösen Hintergründe sind vielen europäischen
Konsument*innen nicht bewusst, da z.B. asiatische Praktiken häufig ohne Bezug auf
ihren traditionellen Kontext in westlichen Ländern übernommen werden. Statt
kultureller Wertschätzung handelt es sich dann um kulturelle Aneignung, da
entsprechende Kulturgüter lediglich zur Vermarktung und zum Konsum gebraucht
werden.
2Bis heute leben die meisten Vegetarier*innen in Indien. Hier liegt der durchschnittliche
Jahresfleischverzehr bei vier Kilogramm pro Kopf (FAO 2018). Auch indische
Restaurants in Deutschland und Südkorea sind erfahrungsgemäß ein sicherer Hafen
für Menschen, die sich vegetarisch ernähren. Eines der weltweit berühmtesten
Vorbilder ist Mahatma Gandhi, welcher sagte: “Ich glaube, dass geistiger Fortschritt an
einem gewissen Punkt von uns verlangt, dass wir aufhören, unsere Mitlebewesen zur
Befriedigung unseres körperlichen Verlangens zu töten” (Gandhi 1959: 16).
Im europäischen Raum begann die Geschichte des Vegetarismus und Veganismus im
Jahr 1801 in London mit dem ersten vegetarischen Verein. 1847 gründete sich die
Vegetarian Society und hundert Jahre später im Jahr 1944 dann auch die Vegan
Society. Daraufhin entstanden weitere Initiativen in ganz Europa. Die Motivationen
dabei variierten, lassen sich aber allgemein in die auch heute noch relevanten Themen
Tierwohl, Gesundheit, Klimaschutz und die Bekämpfung des Welthungers einteilen.
Bekannte europäische Vertreter des Vegetarismus waren bzw. sind z.B. Albert Einstein
oder Paul McCartney (ProVeg International 2019).
Gerade in Deutschland wird jedoch traditionell viel Fleisch konsumiert. Das Land liegt
mit ca. 79 Kg pro Kopf sogar über dem europäischen Durchschnitt von ca. 76 Kg. Im
Vergleich dazu liegt der Durchschnitt in Asien bei ca. 31 Kg. Südkorea übersteigt diesen
mit ca. 62 Kg pro Kopf deutlich. (FAO 2018). In Deutschland geht der Trend in Richtung
Verringerung des Fleischverzehrs. Laut einer Umfrage des Bundesministeriums für
Ernährung und Landwirtschaft gaben im Jahr 2020 55 % der Deutschen an, sich
flexitarisch zu ernähren (Wissen Heute 2021).
Pflanzenbasierte Fleischimitate waren im asiatischen Raum schon seit Jahrhunderten
bekannt, bevor sie in den 1980er Jahren auf den amerikanischen Markt gelangten.
Besonders in und um China wird Fleischersatz traditionell in buddhistischen Klöstern
als Einstieg in die vegetarische Ernährung genutzt. Um für rituelle Opfer keine
Lebewesen töten zu müssen, werden an besonderen Feiertagen ebenfalls seit
Jahrhunderten Fleischersatzprodukte genutzt. Die taiwanesisch-amerikanische
Aktivistin Darice Chang schreibt: "In the West, we just try to emulate dishes that are
already meaty and we just give vegan replacements. Whereas in Taiwan, because of the
monks and religions, the cuisine is very much its own thing" (Wei 2021).
Historisch betrachtet war und ist Südkorea stark geprägt von Landwirtschaft, welche
Gemüse basierte Gerichte begünstigte. Erst seit einigen Jahrzehnten, insbesondere mit
dem Beginn des Wirtschaftswunders in den 1970ern und 1980ern, wurde der Verzehr
von Fleisch erschwinglich und dadurch popularisiert (Ock 2017). Fleisch als
Statussymbol trug ebenso zu einer Überkonsumation bei. Nach Schätzungen der
“Korean Vegetarian Union” aus dem Jahr 2018 gibt es in Südkorea heutzutage ca. 1,5
Millionen Menschen, die sich fleischlos ernähren. Dies entspricht einem Anteil von ca.
3 % der Gesamtbevölkerung – ein starker Anstieg.
3Vor zehn Jahren waren es lediglich ca. 150.000 Menschen die sich einer fleischlosen
Ernährung verschrieben haben. Gut ein Drittel der 1,5 Millionen Menschen bekennt
sich dabei zum Veganismus (Kang 2021). Laut Lee Won-bok, dem Leiter der "Korean
Vegetarian Union“ finden sich die Ursprünge des modernen Vegetarismus in Südkorea
in den frühen 2000ern: "(…) people started to share information about vegetarianism
online. Foreign books on going meat-free began to be translated into Korean, too, at
the time“. Dieser Trend ist nach seinen Aussagen besonders bei jungen Menschen
zwischen 20 - 30 Jahren stark ausgeprägt. Durch soziale Medien wird es immer
einfacher Gleichgesinnte zu finden und gemeinsam die besten veganen und
vegetarischen Restaurants zu testen (Lee 2021). Dadurch nimmt die positive
Wahrnehmung einer pflanzenbasierten Ernährung in dieser Altersgruppe, sowie die
Nachfrage nach entsprechenden Restaurants und Büchern stark zu (Ock 2017). Auch
der Markt für pflanzenbasierte Produkte profitiert davon und befeuert diesen Trend.
Verschiedene koreanische Marken haben inzwischen vegetarische oder vegane
Produktreihen entworfen. Im Januar 2020 hatte der Lebensmittelkonzern Nongshim
bereits 18 vegetarische Produkte wie veganen Käse und gefrorene Gerichte auf den
Markt gebracht. Laut dem US-amerikanischen Marktforschungsunternehmen CFRA
wird der globale Markt für Fleischersatzprodukte bis zum Jahr 2030 ca. 87 Billionen
EUR betragen im Vergleich zu 16 Billionen EUR 2018. Neben Nongshim versucht auch
Pulmuone den veganen Markt zu erobern. So hat das Unternehmen die ersten offiziell
von der Korea Agency of Vegan Certification and Services zertifizierten veganen
Ramyeon entwickelt. Seit dem Release im November 2020 wurden bereits über
2.000.000 Packungen verkauft (Lee 2021).
Deutschland Korea
Vegetarisch
Vegetarisch 3%
Vegan 1.5% Vegan 1%
8%
*
Omni Omni
90.5% 96%
Ernährungsformen in Deutschland 2020 und Korea 2020
*Anmerkung: Omni = Omnivore Ernährung,"Allesesser"
4Kulturelle Faktoren
Trotz aller positiven Entwicklungen in den Bereichen Aktivismus und Wirtschaft gibt es
kulturelle Faktoren, welche eine pflanzenbasierte Ernährung stigmatisieren können. In
Südkorea ist das Interesse an einer vegetarischen Ernährungsform seit den 2000ern
als Reaktion auf einen ansteigenden Fleischkonsum und die damit einhergehenden
negativen Folgen für die Gesundheit stark gestiegen. Das Konzept der Gesundheit ist
aufgrund von kulturhistorischen Entwicklungen stark mit dem Konsum von tierischen
Produkten verknüpft. In einer Untersuchung zu dieser Verbindung gaben viele Befragte
an, dass ihre Ernährungsform häufig auf Unverständnis stieße, weil sich Freund*innen
und Verwandte Sorgen über die Gesundheit beim Fehlen tierischer Produkte machten
(Yoo & Yoon 2015: 112; 121).
Die Gesundheit ist jedoch nicht der einzige Aspekt der Kritik, welcher sich
Vegetarier*innen in ihrem Umfeld ausgesetzt sehen. Einen viel schwerwiegenderen
Einfluss hat diese Ernährungsform auf die Bildung der Gruppenidentität und des
Dividuums. In Südkorea kann die Persönlichkeit eines Menschen nicht als Individuum,
sondern als Dividuum verstanden werden. So wird das “Sein” eines Menschen nicht als
Einheit, sondern als fließendes Konstrukt durch die Beziehung der Person zu seiner
Umwelt und seiner wahrgenommenen Rolle in der Gesellschaft konstruiert und muss
in jeder gesellschaftlichen Situation neu verhandelt werden (Markus & Kitayama 1991
in Yoo & Yoon 2015: 116). In der koreanischen Gesellschaft wird die Gruppe somit als
entitätsgebend und als Maßstab der Gruppenzugehörigkeit einer Person besonders
stark hervorgehoben. In diesem Kontext wird die Anpassung an Gruppennormen
besonders stark bewertet. Das gemeinsame Essen bildet dabei in ritualisierter Form
die Zugehörigkeit zu einer spezifischen Gemeinschaft (Yoo &Yoon 2015: 116). Das
bewusste zurückweisen einer „gemeinsamen“ Ernährungsform wird als Bruch mit einer
Tradition und als Gefahr für die Homogenität einer Gruppe interpretiert (Roth 2005 in
Yoo & Yoon 2015: 114). Laut Barth (1998) ist dieses Verhalten ein grundlegendes,
konstituierendes Merkmal einer Gruppenidentität. Diese entsteht durch
“Grenzziehung”, wobei die Akteure selbst Kategorien (Selbstidentifikation) auswählen,
die ihre Identität konstruiert. Diese Kategorien der Zugehörigkeit variieren je nach
Kontext. Durch diesen Prozess werden aktiv soziale Grenzen zwischen Gruppen
gebildet und die Gruppe wird zum Produkt der Grenzziehung (11; 14-15). Im Kontext
eines gemeinsamen Essens in Südkorea bedeutet dies, dass die fleischhaltige
Ernährungsform als Kategorie der Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe definiert
wird. Alle, die diese Ernährungsform ablehnen, können somit kein Teil der Gruppe
werden. Vegetarier*innen und Veganer*innen bewegen sich deshalb konstant in
einem Spannungsfeld zwischen der Realisierung der eigenen Identität und dem Erhalt
sozialer Beziehungen (Yoo & Yoon 2015: 115).
5Yoo & Yoon (2015) merken an, dass die Sanktionen, welche aufgrund eines
Abweichens von der Gruppenidentität verhängt werden, durch gesellschaftliche
Faktoren in ihrem Ausmaß relativiert werden können. Der Druck, der diesbezüglich auf
eine Person ausgeübt wird, ist stark abhängig von ihrem sozialen Rang und Alter. Bei
höher gestellten Personen wird eine alternative Ernährungsform häufiger akzeptiert
(126). Vegetarier*innen verfolgen zudem unterschiedliche Strategien, um
gesellschaftliche Sanktionen zusätzlich abzumildern. Zu diesen Strategien zählen unter
anderem das Vermeiden formaler Treffen sowie zuvorkommendes und umsorgendes
Verhalten, um Verstimmungen möglichst auszugleichen (Yoo & Yoon 2015: 127-128).
Eine weitere Strategie ist das Abweichen von der vegetarischen Ernährungsform und
das zeitweilige Verzehren von tierischen Produkten (Yoo & Yoon 2015: 129).
Was wäre wenn... Geschlechterrollen
Neben diesen sozio-kulturellen
... alle Koreaner*innen für 1 Jahr pflanzenbasiert Faktoren scheint auch das
leben würden? 52 000 Quadratkilometer* Geschlecht eine bedeutsame
Regenwald könnten gerettet werden - das ist Rolle bei der Entscheidung für
etwas mehr als die Fläche von Niedersachsen! oder gegen eine fleischlose
Ernährung zu spielen. Studien
aus den USA und Großbritannien
zeigen, dass sich dort zwischen
60 % und 70 % aller
Veganer*innen als Frauen
identifizieren (HRC 2014; The
Vegan Society 2016). Auch in
Deutschland ist dieses Muster
klar erkennbar. Laut Robert Koch
Institut ernähren sich 6,1 % der
.... alle Deutschen für 1 Jahr pflanzenbasiert leben
Frauen und nur 2,5 % der Männer
würden? Circa 84 000 Quadratkilometer* können
üblicherweise vegetarisch
gerettet werden - das ist etwas weniger als die
(Robert-Koch-Institut 2016: 8) und
Fläche von Südkoreas.
schon 2007 beschrieb die
Universität Jena in ihrer
Außerdem fand eine Oxford-Studie heraus, dass
Vegetarierstudie den/die
6 - 10 Prozent der Sterbefälle reduziert werden
typische*n Vegetarier*in als
könnten und Treibhausgase von 1kg pro Person
"weiblich, jung, über-
eingespart werden könnten - wenn ganz
durchschnittlich gebildet und […]
Deutschland und Korea vegetarisch leben würde
in einer Großstadt [lebend]“
für ein Jahr, wären das die Emissionen von knapp
(Universität Jena 2007).
80.000 Economy-Flügen von Frankfurt nach
Incheon und zurück!
6
*based on the numbers provided at https://www.cowspiracy.com/factsFür Südkorea ist die Quellenlage zu diesem Thema deutlich limitierter. Dennoch zeigen
sich auch hier tendenziell Unterschiede zwischen den Geschlechtern. In einer vom
koreanischen Lebensmittelindustrieverband veröffentlichten Umfrage gaben deutlich
mehr Frauen (51,3 %) als Männer (38,1 %) an, dass ihnen das Konzept des
Vegetarismus gut bekannt sei (ATFIS 2020: 328). Auch in Han Kangs einleitend
erwähnten Roman "Die Vegetarierin" lässt sich eine Verknüpfung zwischen Weiblichkeit
und fleischloser Ernährung erkennen. Wenn man außerdem die Online-Präsenz
koreanischer Idols betrachtet, so wird deutlich, dass sich insbesondere weibliche Stars
öffentlich zu einer pflanzenbasierten Ernährung bekennen (Jeong 2020).
Wie lässt sich diese Diskrepanz zwischen den Geschlechtern erklären? Zum einen wird
eine fleischhaltige Ernährung häufig mit Männlichkeit in Verbindung gebracht. So
beschreibt Sobal (2005: 137-138) die Genderisierung und Hypermaskulinisierung
insbesondere von rotem Fleisch. Männer sehen sich durch den mit Fleischkonsum
einhergehenden Bezug auf die Jäger- und Versorgerrolle in ihrer Kraft und Dominanz
bestärkt. Dieses Bild des männlichen Fleischkonsumenten wird auch in den Medien
reproduziert. Zum anderen zeigen Studien, dass sich Frauen öfter mit ihrer Ernährung
auseinandersetzen und eher versuchen, ungesunde Lebensmittel zu vermeiden
(Modlinska et al 2020: 8). Da eine fleischlose Ernährung als gesundheitsförderlich gilt,
entscheiden sich daher mehr Frauen als Männer für den Vegetarismus. Dabei muss
jedoch auch der gesellschaftliche Schlankheitsdruck miteinbezogen werden, der
Frauen in größerem Maße betrifft. Zudem scheinen auch ethische Beweggründe bei
weiblichen Individuen eine größere Rolle zu spielen. So sind Frauen deutlich häufiger
im Tierschutz aktiv und geben eher an, dass das Töten von Tieren zum Verzehr
moralisch nicht gerechtfertigt werden kann (Herzog 2015: 12; Goodie & Haslam 2002:
477).
7Zwischen Tradition und Trend – so lässt sich pflanzliche Ernährung in Deutschland und
Südkorea wohl am besten zusammenfassen. Obwohl die vegetarische/ vegane
Ernährung in Südkorea andere Ursprünge hat als in Deutschland, sind es heute in
beiden Ländern eher Frauen und junge Menschen, die diese Ernährungsform wählen.
Während Deutschland eines der Länder ist, in welchem am meisten pflanzliche
Ersatzprodukte zu kaufen sind, sehen sich viele Vegetarier*innen und Veganer*innen
in Südkorea sozialem Druck ausgesetzt. Auch für Besucher*innen des Landes können
bestimmte kulturelle Gegebenheiten oder die eher fleischlastige Küche Südkoreas
verunsichernd sein – daher ist diesem Short ein Survival Guide angehangen, in dem
alle wichtigen Informationen rund um die pflanzliche Ernährung in Südkorea zu finden
sind.
8QUELLEN
ATFIS (2020):홀로만잔 진화하는 그린슈머 취향소비 안심푸두테크 동내상권의 재발견 . Online
unter: https://www.atfis.or.kr/fip/article/M000010300/view.do?articleId=4208
[07.10.2021].
Barth, F. (1969): Ethnic Groups and Boundaries : The Social Organization of Culture
Difference.
Beardsworth, A., Bryman, A., Keil, T., Goode, J., Haslam, C., Lancashire, E. (2002):
Women, men and food: the significance of gender for nutritional attitudes and choices.
In: British Food Journal 104 (7), S. 470–491.
FAO (2018): Food Balances. Online unter: https://www.fao.org/faostat/en/#data/FBS
[19.12.2021]
Fitneo (2021): Buddha Bowls: Das steckt hinter den bunten Schüsseln. Online unter:
https://fitneo.de/buddha-bowls/ [19.12.2021]
Wei, C. (2021): Plant-Based Meat Has Thrived in Asia for Centuries-and it’s Still Going
Strong. Food & Wine. Online unter: https://www.foodandwine.com/cooking-
techniques/plant-based-meat-china-taiwan-buddhist-vegetarian [19.12.2021]
Gandhi, M.K. (1959): The Moral Basis of Vegetarism. Navajivan, Ahemadabad. Online
unter: https://www.mkgandhi.org/ebks/moralbasis_vegetarianism.pdf [19.12.2021]
Herzog, H. A. (2007): Gender Differences in Human–Animal Interactions: A Review. In:
Anthrozoös 20 (1), S. 7–21.
HRC (2014): Study of Current and Former Vegetarians and Vegans. Online unter:
https://faunalytics.org/wp-content/uploads/2015/06/Faunalytics_Current-Former-
Vegetarians_Full-Report.pdf [07.10.2021].
Jeong, L. (2020): Vegan K-pop and K-drama stars: 4 Korean celebrities who follow a
plant-based diet (well, mostly) – Lee Hyori, Im Soo-jung, Claudia Kim and Lee Ha-nui.
Online unter: https://www.scmp.com/magazines/style/celebrity/article/3098911/vegan-
k-pop-and-k-drama-stars-4-korean-celebrities-who [07.10.2021].
Kang, H. (2021): Inconvenient truth about meat-based life. The Korea Times. Online
unter: https://m.koreatimes.co.kr/pages/article.asp?newsIdx=283074 [12.12.2021].
9Lee, S. (2021): Plant-based lifestyles prove popular in pandemic. Korea JoongAng Daily.
Online unter:
https://koreajoongangdaily.joins.com/2021/04/22/culture/foodTravel/vegan/202104222
03000381.html [12.12.2021].
Leitzmann, C., Keller M. (2020): Vegetarische und vegane Ernährung, utb GmbH,
Stuttgart.
Modlinska, K., Adamczyk, D., Maison, D., Pisula, W. (2020): Gender Differences in
Attitudes to Vegans/Vegetarians and Their Food Preferences, and Their Implications for
Promoting Sustainable Dietary Patterns – A Systematic Review. In: Sustainability 12 (16),
S. 6292.
Ock, H. (2017): Korea turns corner on going meat-free. The Korea Herald. Online unter:
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20170616000617 [12.12.2021].
ProVeg International (2019): Vegan-vegetarische Prominente. Online unter:
https://proveg.com/de/pflanzlicher-lebensstil/vegan-vegetarische-prominente/
[19.12.2021]
Robert-Koch-Institut (2016): Verbreitung der vegetarischen Ernährungsweise in
Deutschland. Online unter:
https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/G
BEDownloadsJ/Focus/JoHM_2016_02_ernaehrung1a.pdf?__blob=publicationFile
[07.10.2021].
Sobal, J. (2005): Men, Meat, and Marrige: Models of Masculinity. In: Food and Foodways
13 (1-2), S. 135–158.
The Vegan Society (2016): Find out how many vegans there are in Great Britain. Online
unter: https://www.vegansociety.com/whats-new/news/find-out-how-many-vegans-
there-are-great-britain [07.10.2021].
Universität Jena (2007): Ergebnisse der Vegetarierstudie. Online unter:
http://web.archive.org/web/20151118230119/http://www.vegetarierstudie.uni-jena.de/
[07.10.2021].
Wissen Heute Gesundheit (2021): Plant Based Food. Juni-September 2021
Yoo, T., Yoon., I. (2015): Becoming a Vegetarian in Korea: The Sociocultural Implications
of Vegetarian Diets. In: Korean Society. Korea Journal 55 (4): 111–135.
ZDF (2013): ZDF Mediathek Fleischkonsum im Laufe der Geschichte:
https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/fleischkonsum-im-laufe-der-geschichte-
102.html
10NACHWORT
Das Netzwerk Junge Generation Deutschland-Korea
Verständnis, Vertrauen und Respekt füreinander sind die Basis einer jeden
Freundschaft. Das gilt auch für Freundschaften zwischen Ländern. Daher ist es für die
bilateralen Beziehungen Deutschlands und Koreas von enormer Bedeutung, junge
Menschen aus beiden Ländern an die jeweils andere Kultur heranzuführen und sie für
lebendigen Austausch in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft zu
begeistern.
Die Jugend Deutschlands und Koreas sollte sich daher den Herausforderungen des 21.
Jahrhunderts gemeinsam stellen, voneinander lernen, sich kennen und verstehen, um
das solide Fundament der deutsch-koreanischen Beziehungen auch in Zukunft zu
sichern und weiterzuentwickeln.
Das Deutsch-Koreanisches Forum (DKF) und Juniorforum (DKJF) diskutieren einmal im
Jahr die wichtigen Themen der bilateralen Zusammenarbeit und erarbeiten
Empfehlungen an beide Regierungen.
Wie ein Think-Tank beschäftigt sich nun das Netzwerk Junge Generation Deutschland-
Korea das ganze Jahr über mit aktuellen deutsch-koreanischen Fragen und formuliert
Positionen und gibt der jungen Generation beider Länder so eine Stimme.
11Zu den Autor*innen
Liza Hong hat ihren Bachelor an der Ruhr Universität in Wirtschaft unf Politik Ostasiens
abgeschlossen und studiert nun als Postgrad Asian and Pacific Studies an der Australian
National University. 2020 und 2021 war sie Teilnehmerin des Junior-Forums und engagiert
sich seit Beginn 2021 in der AG 3 „Themen und Politik: Entwicklung von Positionen und
Empfehlungen“ sowie der AG 6 "Events" des Netzwerks. Nach diversen Praktika im
ostasiatischen Raum verbrachte sie nach ihrem Bachelorabschluss 5 Monate in Korea, um
an der Sogang Universität die koreansiche Sprache besser zu erlernen. Aufgewachsen auf
dem Land mit dem elterlichem Betrieb der Schweinezucht und Felderwirtschaft wurde sie
2017 Vegetarierin und ein Jahr darauf vegan aus vorwiegend ethischen Gründen.
Felix Fröhlich studiert Internationale Beziehungen in Berlin und Potsdam. Seine
Forschungsinteressen beinhalten u.a. zwischenstaatliche Dynamiken in Ostasien und die
geopolitischen Entwicklungen im Indo-Pazifik. In Studium und Freizeit beschäftigt er sich
außerdem mit gesellschaftlichen Themen wie Anti-Rassismus und Geschlechtergerechtigkeit.
Felix ist seit seinem 18. Lebensjahr Vegetarier, ursprünglich aus Rebellion gegen die
fleischlastige Esskultur in seiner bayerischen Heimat. Er hat mehrere Auslandsaufenthalte in
Korea und Japan absolviert und unterstützt die Arbeitsgruppe 3 "Themen und Politik:
Entwicklung von Positionen und Empfehlungen" seit Anfang 2021.
Ariane Odendahl schloss im Juli 2021 ihr Abitur am Liborius-Gymnasium Dessau ab und
verbrachte daraufhin 3 Monate in der Republik Korea. Dort absolvierte sie ein Praktikum im
Büro der Hanns-Seidel-Stiftung und nahm am Deutsch-Koreanischen Juniorforum teil.
Weiterhin strebt sie ein Studium der Internationalen Beziehungen in Kombination mit
Rechtswissenschaften an. Ihr Fokus liegt auf sozialpolitischen Themen wie Geschlechter-
gerechtigkeit und Antidiskriminierungspolitik, sowie die Unterstützung marginalisierter
Gesellschaftsgruppen, aber auch in der Rolle und Vernetzung der jungen Generationen auf
globaler Ebene, sowie kulturellem Austausch und nachhaltige Entwicklung. Als Teil des
Netzwerks Junge Generation Deutschland-Korea, engagiert sie sich vorrangig in der
Öffentlichkeitsarbeit durch die Arbeitsgruppe 1.1 „Social Media”, arbeitet aber auch an
Projekten der Arbeitsgruppe 3 „Themen und Politik: Entwicklung von Positionen und
Empfehlungen" mit und unterstützt die allgemeine Vernetzung zwischen den vielfältigen
Arbeitsgruppen des Netzwerks. Ariane ist vor mehr als 5 Jahren, aufgrund ethischer
Vorbehalte, Vegetarierin und zeitweise Veganerin geworden.
Karin Ziegner arbeitet bei einer Deutschen Mittlerorganisation des Auswärtigen Amtes im
Bereich Migration. Ihren Bachelor absolvierte Sie an der Universität Heidelberg in den
Fächern Ethnologie und Ostasienwissneschaften mit den Schwerpunkten Korea und Japan.
Nach einem Praktikum im Auslandsbüro einer politischen deutschen Stiftung in Südkorea
2017, entschloss sie sich ihren Master in an der London School of Economics and Political
Sciences in „Global Politics“ zu machen. Hier beschäftigte sie sich vor allem mit den
Themenbereichen Nationalismus und Globalisierung in Südkorea. Seit 2021 engagiert sie
sich im Netzwerk Junge Generation Deutschland-Korea in der AG 3 „Themen und Politik:
Entwicklung von Positionen und Empfehlungen“. Karin lebt seit ca. 4 Jahren hauptsächlich
vegan, zunächst aus gesundheitlichen Gründen, später auch aus ethischen und Klima
Gründen.
Illustration: Gwendolyn Domning
12Sie können auch lesen