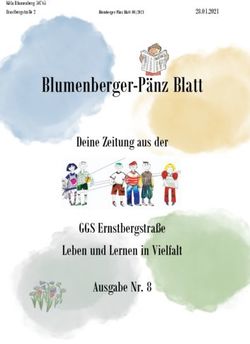Inklusive Lerngruppen erfolgreich unterrichten: Didaktische Grundlagen
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Inklusionskongress der GEW NRW
27. Mai 2014
Inklusive Lerngruppen erfolgreich unterrichten:
Didaktische Grundlagen
Abbildung in der
Online-Fassung
der Präsentation
leider nicht verfügbar
Dr. Harry Kullmann
Vertretung der Professur für Theorie und Planung des Unterrichts
an der Ruhr-Universität BochumGliederung
1. Inklusion als menschenrechts- und bildungspolitischer Auftrag
2. Inklusion: Erweiterte Perspektive
3. Prämissen Inklusiver Didaktik
4. Inklusive Didaktik als Balanceaufgabe
5. Weitere Bedingungen für inklusiven Unterricht
6. Schluss: VN-BRK über die Schulung von Fachkräften
2VN-Behindertenrechtskonvention
Konkretisierung der allgemeinen Menschenrechte
• Rechte von Kindern, Frauen, Menschen
unterschiedlicher Hautfarbe
• „Erkenntnis, dass […] Behinderung aus der Wechselwirkung
zwischen Menschen mit Beeinträchtigungen und
einstellungs- und umweltbedingten Barrieren entsteht,
die sie an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten
Teilhabe an der Gesellschaft hindern“
(Präambel, Abs. e, VN-BRK 2008)
3Recht behinderter Menschen auf Bildung
„ohne Diskriminierung zu verwirklichen“ (Art. 24, 1)
„nicht aufgrund von Behinderung vom allgemeinen
Bildungssystem ausgeschlossen werden“ (Art. 24, 2a)
„gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, in der sie
leben, Zugang zu einem integrativen, hochwertigen […]
Unterricht“ (Art. 24, 2e)
„zur wirklichen Teilhabe an einer freien Gesellschaft […]
befähigen“ (Art. 24, 1c, VN-BRK 2008)
4Kultusministerkonferenz
„Das allgemeine Bildungssystem ist aufgefordert,
sich auf die Ausweitung seiner Aufgabenstellungen
im Sinne einer inklusiven Bildung und Erziehung
vorzubereiten.“ (KMK 2010, S. 9)
Sylvia Löhrmann
KMK-Präsidentin 2014
5Inklusion ‒ Erweiterte Perspektive
der Erziehungswissenschaft
Sensibilität und Engagement in Bezug auf alle Dimensionen
von Heterogenität:
Lern- und Leistungsvoraussetzungen
- psychisch-kognitiv
- physisch Abbildung in der
Online-Fassung
Geschlecht der Präsentation
leider nicht verfügbar
Behinderung
Erst- bzw. Familiensprache
Sozio-kultureller Hintergrund
(z.B. Hinz 2009)
6Prämissen Inklusiver Didaktik (Auswahl)
1. Zentrale Unterrichtsziele:
- Mündigkeit und Allgemeinbildung
- Fähigkeit zu Selbstbestimmung,
Mitbestimmung und Solidarität (Klafki 1996) Wolfgang Klafki
2. Unterricht für eine maximal heterogene Lerngruppe
3. Konstitutiv zieldifferentes Unterrichten
→ Leistungsschere öffnet sich!
7Inklusive Didaktik als Balanceaufgabe
Lehrersteuerung
- Frontalunterricht - Förderunterricht
- Kreisgespräche - Einzelarbeit
Grobraster:
Gemeinschaftliche - Planung
Individuelle
Lernsituation - Analyse Lernsituation
- Projektunterricht - Freiarbeit
- Kooperatives Lernen - Wochenplanarbeit
Schülersteuerung
(z.B. Werning & Lütje-Klose 2012; Wocken)
9Inklusive Didaktik als Balanceaufgabe
Lehrersteuerung
- Frontalunterricht - Förderunterricht
- Kreisgespräche - Einzelarbeit
Grobraster:
Gemeinschaftliche - Planung
Individuelle
Lernsituation - Analyse Lernsituation
- Projektunterricht - Freiarbeit
- Kooperatives Lernen - Wochenplanarbeit
Schülersteuerung
(z.B. Werning & Lütje-Klose 2012; Wocken)
10Fokus: Individuelle Lernsituation
erung
- Förderunterricht
- Einzelarbeit
Individuelle Lernsituation Sozialform
ter: Adaptierte Pflichten / Lernwirksamkeit /
ng Angebote Motivation
se
Koexistentes Lernen Inklusiver Effekt
- Freiarbeit
- Wochenplanarbeit
uerung
(Wocken 1998, 2013) 11Fokus: Gemeinschaftliche Lernsituation
Lehrersteuerung
- Frontalunterricht - Förderunterricht
- Kreisgespräche - Einzelarbeit
Grobraster:
Gemeinschaftliche - Planung
Individuelle
Lernsituation - Analyse Lernsituation
- Projektunterricht - Freiarbeit
- Kooperatives Lernen - Wochenplanarbeit
Schülersteuerung
(z.B. Werning & Lütje-Klose 2012; Wocken 2013)
12Fokus: Gemeinschaftliche Lernsituation
Lehr
- Frontalunterricht
- Kreisgespräche
Gemeinsame Lernsituation Sozialform G
Nicht- o. teiladaptierte Lernwirksamkeit /
Pflichten / Angebote Motivation
Kommunikative, Inklusiver Effekt - Projektunt.
prosoziale, - Kooperatives
komplementäre,
solidarische
Lernsituationen Sch
(Wocken 1998, 2013 ) 13Ausgewählte Vorteile in den Quadranten
- Frontalunterricht Lehrersteuerung - Förderunterricht
- Kreisgespräche - Einzelarbeit
Planung, Durchführung (?) Adaptierte
Evaluation (?) des Lernangebote
Unterrichts
Gemeinschaftliche Individuelle
Lernsituation Lernsituation
– Selbstwirksamkeit
– Viele Bildungsziele – Eigenverantwort-
– Inklusiver Effekt lichkeit
- Projektunterricht - Freiarbeit
- Kooperatives Lernen Schülersteuerung - Wochenplanarbeit
z.B. Werning & Lütje-Klose 2012; Wocken 2013
14Gesamtbalance anhand des Indikators Sozialform
inklusive…
Wertschätzung und
fehlerfreundliches Klima
Kognitive Aktivierung /
Klassen- herausfordernde Aufgaben
einzeln
verband
Häufigkeit, Zeitpunkt und
Dauer
Lernzeitnutzung
…
Kooperative
Gruppen → Optimale Balance noch
empirisch unbestimmt
→ Frontalunterricht von 30% in
inklusiven Lerngruppen
(Helmke 2013, Wocken 2013)
kaum günstig 15Entkopplung von Selbstkonzept und Leistung
Individuelle Bezugsnorm / individualisierte Rückmeldung zu
- Prozessen (z.B. Selbststeuerung, Anstrengung)
- Erfolgen und Misserfolgen (inkl. Ursachen und Hilfen)
Kriteriale Bezugsnorm / Urteil anhand von Kompetenzzielen
- zur Unterstützung der individualisierten Rückmeldung
- nach Möglichkeit (zweite) Hauptbasis der Notengebung
- Möglichkeit in NRW: Portfolio statt Klassenarbeit!
Soziale Bezugsnorm / Vergleich mit Lerngruppe
- Misserfolgserfahrungen
- Gefahr für Selbstkonzept
(z.B. Hattie 2013, Helmke 2009)
16Weitere Bedingungen inklusiven Unterrichts
1. Akzeptanz aller Schüler*innen in ihrer Individualität
und förderpädagogische Haltung Abbildung in der
Online-Fassung
2. Co-Teaching und Kooperation der Präsentation
- Sonderpädagog*innen leider nicht verfügbar
- Integrationshelfer*innen
Abbildung in der
3. Proaktive und forschende Haltung Online-Fassung
der Präsentation
- Unterrichtsentwicklung
leider nicht verfügbar
- Klassenraumentwicklung
„Es ist leichter, um Verzeihung zu bitten als um Erlaubnis.“
(Eine erfolgreiche Schulentwicklerin aus dem
Schulverbund Blick über den Zaun)
(z.B. Kullmann, Lütje-Klose und Textor 2014)
17VN-BRK: Schulung von Fachkräften
„Verwendung geeigneter ergänzender und alternativer
Formen, Mittel und Formate
der Kommunikation
pädagogischer Verfahren und Materialien“
(Art. 24, 4, VN-BRK 2008)
Co-Referat: Dr. Michael Schwager,
IGS Köln-Holweide
ausführliches Praxisbeispiel zum
Deutschunterricht in inklusiven Lerngruppen
18Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Zitationsvorschlag für diesen Vortrag:
Kullmann, Harry (2014): Inklusive Lerngruppen erfolgreich unterrichten: Didaktische Grundlagen.
Vortrag am Inklusionskongress der GEW NRW am 27.05.2017. Online unter: www.gew-
nrw.de/index.php?id=2894 am 06.06.2014.
Kontakt:
Dr. Harry Kullmann
Vertretung der Professur für Theorie und Planung des Unterrichts
Institut für Erziehungswissenschaft
Ruhr-Universität Bochum
Universitätsstr. 150/ Raum GA 1/51 (Süd)
D-44801 Bochum
E-Mail: Harry.Kullmann@rub.de
Harry.Kullmann@uni-bielefeld.de
Internet: www.ife.rub.de/institut/arbeitsbereiche/node/23
www.uni-bielefeld.de/wels/mitarbeiter.html#Kullmann
19Literatur
Hattie, J. (2013). Lernen sichtbar machen. Deutschsprachige Ausgabe von "Visible learning", besorgt von Wolfgang
Beywl und Klaus Zierer. Baltmannsweiler: Schneider.
Helmke, A. (2009). Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des
Unterrichts. 4. Aufl. Seelze: Kallmeyer.
Helmke, A. (2013). Individualisierung: Hintergrund, Missverständnisse, Perspektiven. Pädagogik(2), 34–37.
Hinz, A. (2009): Inklusive Pädagogik in der Schule. In: Zeitschrift für Heilpädagogik 60, H. 5, S. 171–179.
KMK ‒ Kultusministerkonferenz (2010b): Pädagogische und rechtliche Aspekte der Umsetzung des Übereinkommens
der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
(Behindertenrechtskonvention - VN-BRK) in der schulischen Bildung. Beschluss der KMK vom 18.11.2010.
Bonn: Sekretariat der KMK. Online unter:
www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2010/2010_11_18-Behindertenrechtkonvention.pdf
am 28.4.2011.
Kullmann, H., Lütje-Klose, B. & Textor, A. (2014): Eine Allgemeine Didaktik für inklusive Lerngruppen – fünf Leitprinzipien
als Grundlage eines Bielefelder Ansatzes der Inklusiven Didaktik. In: Amrhein, B./Dziak-Mahler, M. (Hrsg.)
(2014): Fachdidaktik inklusiv - Auf der Suche nach didaktischen Leitlinien für den Umgang mit Vielfalt in der
Schule. Münster: Waxmann, S. 89–107.
Lütje-Klose, B., Serke, B. & Urban, M. (2013): Didaktik für heterogene Lerngruppen im Spannungsfeld von
Individualisierung und Kooperation. Fortbildung für das Kultusministerium des Landes Niedersachsen.
Werning, R. & Löser, J. M. (2011). Alle Kinder fördern? Möglichkeiten zur Verringerung des Schulversagens - eine
internationale Perspektive. SchulVerwaltung(9), 243–245.
Wocken, H. (1998): Gemeinsame Lernsituationen. Eine Skizze zur Theorie des gemeinsamen Unterrichts. In:
Hildeschmidt, A./Schnell, I. (Hrsg.) (1998): Integrationspädagogik. Auf dem Weg zu einer Schule für alle.
Weinheim: Juventa, S. 37–52.
Wocken, H. (2013): Inklusion als Balance. Eine theoretische Skizze zu Grundstrukturen der inklusiven Pädagogik. In:
Wocken, H. (Hrsg.) (2013): Zum Haus der inklusiven Schule. Ansichten - Zugänge - Wege. 2. Auflage.
Hamburg: Feldhaus, S. 171–198.
VN-BRK (2008): Gesetz zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen. Bundesgesetzblatt Teil II Nr. 35, ausgegeben zu Bonn am
31. Dezember 2008, S. 1419‒1457.
20Abbildungsverzeichnis
Foto Wolfgang Klafki: e-ducation.datapeak.net
Foto Sylvia Löhrmann: www.kmk.org/
Daumen hoch mit grünem Grund: http://prezi.com/lj8j1taqm7u-/untitled-
prezi/
21Sie können auch lesen