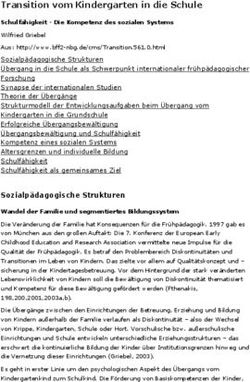Integration von Eltern stationär betreuter Kinder - Hintergründe, Voraussetzungen und Schwierigkeiten
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Chirurgische Klinik
Im Neuenheimer Feld 110
69120 Heidelberg
FACHWEITERBILDUNG
zur Pflege und Betreuung des Tumorpatienten und
schwerst-chronisch Kranken
Integration von Eltern
stationär betreuter Kinder
Hintergründe, Voraussetzungen
und Schwierigkeiten
Kurs 98/00
HAUSARBEIT
vorgelegt von Anja Häffner-Butterer
am 30.12.1999
1I. Inhalt
Seite 1: I. Inhaltsangabe
Seite 2: II. Vorwort
Seite 3: III. Bedürfnisse des kranken Kindes
Seite 4/5: Die Bedürfnisse kranker Kinder im
Einzelnen
Seite 6: Aufgabenverteilung
Seite 7: IV. Was bedeutet Integration ? –
Begriffsklärung
Seite 8: V. Voraussetzungen für die Integration
von Eltern
Seite 9: VI. Unterstützende Hilfestellungen für die
Eltern durch das Pflegepersonal
Seite 10/11: Aufnahmesituation
Seite 12: Strukturvorgaben während des
Krankenhausaufenthalts / Wochenplan
Seite 13/14: VII. Schwierigkeiten der Integration
Seite 15: Mögliche Vorgehensweise zur
Problembeseitigung
Seite 16: VIII. Resümee
Seite 17: Literaturverzeichnis
Seite 18: Erklärung
Anhang
1. Elterninformation der Station II der Univ.-Klinik Heidelberg
2. Charta für das Kind im Krankenhaus
2II. Vorwort
Seit 1998 ist die Integration von Eltern im Krankenhaus als ein Pflege-
leitziel der Kinderklinik Heidelberg festgelegt.
Der Begriff „Integration“ ist vom Prinzip her zwar jedem bekannt, jedoch
wird er von jedem auch etwas anders interpretiert.
Obwohl er mittlerweile bereits im Pflegealltag, ja sogar schon in der
Ausbildung, immer wieder auftaucht, versteht ihn jeder etwas anders.
Die Meinungen gehen hierbei von reiner Übernachtungsmöglichkeit, über
Zusammenarbeit, bis zu intensivem Auseinandersetzen mit den Eltern in
einem breitgefächerten Spektrum auseinander.
Das empfinde ich als ein großes Problem, denn eigentlich müßte eine
einheitliche, verbindliche Definition, sowie ein entsprechender Umgang mit
Integration von Eltern im Krankenhaus gefunden werden, damit er zu einem
festen, praktikablen Bestandteil im Kliniksalltag wird.
Gerade auf der Station II der Kinderklinik Heidelberg, auf der ich seit
Jahren tätig bin, habe ich das Gefühl, daß Integration weder für die Eltern,
noch für das Pflegepersonal zufriedenstellend erfolgt. Die Eltern haben zwar
schon seit langem die Möglichkeit bei ihrem Kind zu bleiben, sind aber in
ihrem Bemühen, ihrem Kind zu helfen, auf professionelle Hilfe angewiesen.
Diese Hilfe wird am häufigsten durch den Kontakt mit dem
Kinderkrankenpflegepersonal geboten.
Da auf der Station II, einer recht großen Station mit vielen Belegbetten, aber
auch viel Personal vorhanden ist, das entsprechend oft wechselt, sehen sich
die Eltern vielen verschiedenen Charakteren gegenüber, auf die sie sich
einlassen müssen. Jede meiner Kolleginnen (*) versteht aber Integration
etwas anders und unterstützt die Eltern entsprechend auf ihre ganz
individuelle Art. Anstatt Sicherheit zu gewinnen, werden Eltern dadurch oft
verunsichert, mit dem Ergebnis, daß ein Miteinander, ein Hand-in-Hand-
Arbeiten erschwert, wenn nicht sogar unterbunden wird.
Mein Bestreben in dieser Hausarbeit liegt nun darin, daß sich Teams
darüber bewußt werden, daß es „die Integration“ nicht gibt. Es ist wichtig,
daß man sich zusammensetzt und gemeinsame Richtlinien zur Integration
überlegt, die verbindlich geregelt werden sollen, um Pflegepersonal
einerseits, aber auch Eltern (Selbst-)Verständnis, Vertrauen und Sicherheit
zu vermitteln.
(*) = Folgend wird immer wieder, wenn auch nicht immer separat erwähnt,
von jeweils beiden Geschlechtern gesprochen werden, der Einfachheit
halber aber nur eine Berufsbezeichnung genannt.
3III. Bedürfnisse des kranken Kindes
Noch bis vor kurzem lag das Hauptaugenmerk in der Kinderkrankenpflege
auf optimaler medizinischer Versorgung und Heilung des Kindes. Beteiligt
daran waren Ärzte und Krankenschwestern, während die Einbeziehung von
Eltern gar nicht in Erwägung gezogen, bzw. eher als störend betrachtet
wurde. Das drückte sich schon durch sehr eingegrenzte Besuchszeiten aus.
Bekannte Familienstrukturen standen den Krankenhausstrukturen eher
unvereinbar gegenüber.
Inzwischen hat sich in dieser Hinsicht viel verändert, da erkannt wurde, daß
Kinder grundsätzlich - und verstärkt in der Ausnahmesituation
Krankenhausaufenthalt - das Bedürfnis haben, zu ihren Eltern engen
Kontakt zu halten.
Der Elternverband „Aktionskomitee Kind im Krankenhaus, Bundesver-
band e.V.“ (kurz: AKiK), setzt sich seit dreißig Jahren für eine Integration
der Eltern im Krankenhaus ein. Mit der Forderung seiner Mitglieder :
„Kinder brauchen ihre Eltern“, stößt er bei Kinderärzten und Kinder-
krankenschwestern auf immer größere Resonanz, die mit ihm der
Auffassung sind, daß kranke Kinder mehr brauchen als „nur“ eine gute
kindgerechte medizinische und pflegerische Versorgung.
Grundlegend ist, alle Bedürfnisse des Kindes im Krankenhaus zu kennen
und ernst zu nehmen, um patientenorientiert handeln zu können.
4Die Bedürfnisse kranker Kinder im Einzelnen
1)
Laut AKiK gehören dazu folgende acht Punkte (die Auflistung erfolgt
ohne Priorität) :
Kindgemäße medizinische Versorgung : Darunter wird die Versorgung
von Kindern in speziell dafür eingerichteten Versorgungseinheiten , z.B.
Kinderklinik, Kinderchirurgie,... verstanden. Versorgende sind pädiatrisch
ausgebildete Mediziner. Werden weitere Fachärzte hinzugezogen, arbeiten
alle in einem interdisziplinären Team.
Kindgemäße pflegerische Betreuung : Die Kinder werden durch
ausgebildetes Kinderkrankenpflegepersonal versorgt.
Eine kindgemäße Umgebung bedeutet, daß die Gestaltung der
Räumlichkeiten und die Auswahl des Mobiliars auf Kinder ausgerichtet ist.
Es gibt Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten für jedes Alter.
Unter Beibehaltung familiärer und sozialer Kontakte wird verstanden,
daß die Eltern-Kind-Beziehung , bzw. der Kontakt zu anderen, dem Kind
vertrauten Personen, bestehen bleibt. Die Eltern haben die Möglichkeit,
während des stationären Aufenthaltes bei ihrem Kind zu bleiben und sie zu
Untersuchungen, Therapiestunden,... zu begleiten. Bei operativen Eingriffen
können die Eltern bis zur OP-Vorbereitung , postoperativ bei dem
aufwachenden Kind sein.
Fortsetzung der gewohnten Lebensumstände bedeutet, daß das bisherige
soziale Umfeld weiterhin Bestandteil im Leben des Kindes ist. Dazu werden
Kontakte zu Kindergarten, Schule, Jugendgruppen,... aufrechterhalten.
1)
AKiK 1996
5Zur Gewährleistung neuer Kontakte wird den Kindern Möglichkeiten
gegeben, andere Personengruppen (Kinder, Ärzte, Krankenpflegepersonal,
Therapeuten, Erzieher,...) kennenzulernen und dadurch neue Beziehungen
einzugehen. Annahme und Akzeptanz kann dem Kind helfen, seine
Situation zu verstehen und pflegerische, sowie medizinisch notwendige
Maßnahmen zu tolerieren. Das Zusammensein mit anderen kranken Kindern
kann tröstend, aufmunternd und nützlich für die Verarbeitung der
ablaufenden Prozesse sein. Spielpartner werden gefunden und neue
Freundschaften geschlossen.
In dem Begriff Fortsetzung der altersentsprechenden Entwicklung
steckt die Forderung an Eltern und Klinikpersonal, das Kind
altersentsprechend zu fördern. Das Kind wird in seiner bisherigen
Entwicklung weiter bestärkt. Es soll weder über- noch unterfordert werden.
Kindgemäße psycho-soziale Betreuung sollte durch dafür ausgebildete
Berufsgruppen, wie Erzieher, Pädagogen, Therapeuten, Psychologen,...
erfolgen. Besonders wichtig ist diese Betreuung, wenn das Kind eine
fehlende familiäre Unterstützung ausgleichen muß.
Einzelne Bedürfnisse können je nach Krankheitsumstand, Krank-
heitsverlauf, sowie der individuellen Situation des Kindes und der Familie
in den Vordergrund treten. Bei einem Kind, das z.B. lebensbedrohlich
erkrankt ist, wird die medizinische und pflegerische Versorgung, sowie die
psychologische Unterstützung der Angehörigen Vorrang haben, während
andere Bedürfnisse in den Hintergrund treten. Nach Bewältigung der akuten
Situation können bzw. werden sich die Schwerpunkte der Bedürfnisse
ändern.
6Wenn sowohl von familiärer Seite, als auch seitens der im Krankenhaus
tätigen Berufsgruppen (Ärzte, Kinderkrankenschwestern/-pfleger,
Psychologen, KG´s, Ergo´s etc.) die Bereitschaft besteht, sich mit den oben
aufgeführten Bedürfnissen auseinanderzusetzen, diese zu akzeptieren und
sich darauf einzulassen, so liegt hiermit die wesentliche Voraussetzung
einer ganzheitlichen, am Kind orientierten Betreuung vor.
Aufgabenverteilung :
Personen können Bedürfnis .... erfüllen
Im Krankenhaus tätige - Kindgemäße medizinische Versorgung
Berufsgruppen - Kindgemäße pflegerische
Betreuung/Versorgung
- Kindgemäße Umgebung
- Kindgemäße psycho-soziale Betreuung
Eltern/Familie - Beibehaltung familiärer und sozialer
Kontakte
- Fortsetzung gewohnter
Lebenszusammenhänge
Beide Seiten - Gewährleistung neuer Kontakte
in Zusammenarbeit - Fortsetzung der altersentsprechenden
Entwicklung
Die in Bezug auf die beteiligten Personen formulierten Bedürfnisse eines
stationär behandelten Kindes veranschaulichen die Notwendigkeit, neben
den aufgeführten fachspezifischen Berufsgruppen auch die Eltern/Familie
mit einzubeziehen.
Der Familie sollte also die Möglichkeit gegeben werden, sich auch im
Krankenhausalltag zu integrieren, damit eine Kooperation aller Beteiligten
stattfinden kann, denn nur wenn alle im Interesse des Kindes
zusammenarbeiten, können die Bedürfnisse erfüllt und umgesetzt werden.
7IV. Was bedeutet Integration ? - Begriffsklärung
Definition von Integration
Integration : Wiederherstellung eines Ganzen
(nach : Großes Wörterbuch der deutschen Sprache Bd. 4/1993):
Im Zusammenhang: Bei Integration von Eltern stationär betreuter Kinder,
kann das „Ganze“ als die Eltern-Kind-Beziehung gesehen werden.
Integration ist also die Wiederherstellung der Eltern-Kind-Beziehung.
Wiederherstellung deshalb, weil noch vor dreißig Jahren ein
Krankenhausaufenthalt gleichbedeutend einer Trennung von Eltern und
Kind war. Erst seit den 70-er Jahren wurden die von „außen“, also von
Elterninteressenverbänden an die Klinik herangetragenen Integrations-
forderungen allmählich umgesetzt, so daß Besuchszeiten der Eltern zunächst
erweitert wurden und heute weitgehend zeitlich unbegrenzte Anwesenheit
der Eltern möglich machen.
Definition von Integration laut AKiK
Integration als "Angebot an Eltern, den individuellen Bedürfnissen des
Kindes und den aus familiären und beruflichen Möglichkeiten bestehenden
Aktionsrahmen der Eltern so einzusetzen, daß alle Hilfe ermöglicht wird,
2)
die das Kind im Augenblick benötigt "
.
2)
AKiK 1998, Seite 2
8IV. Voraussetzungen für die Integration von Eltern
Die Grundvoraussetzung ist, daß ...
! ... Eltern im Krankenhaus anwesend sein dürfen, d.h. :
- Öffnung der Kinderkrankenhäuser für die Familien
- unbegrenzte Besuchsmöglichkeiten
- teilweise Mitaufnahme der Eltern (in wenigen Fällen wird diese
Leistung bereits von den Krankenkassen übernommen, z.B.: bei
stillenden Müttern)
- Akzeptanz durch Krankenhausberufsgruppen
- Übernachtungsmöglichkeiten (Elternliegen, Elternduschen,
Elterntoiletten)
- Möglichkeiten zur Selbstversorgung (z.B. Einkaufsmöglichkeiten
und Kochgelegenheiten)
! ... Eltern im Krankenhaus sein können, d.h. :
- keine bzw. geringe finanzielle Einbußen (Freistellung durch den
Arbeitgeber)
- es muß überlegt werden, welche Personen noch zur Familie gehören
und versorgt werden müssen, bzw. wer die Aufgaben im Haushalt
übernimmt,...
! ... Eltern im Krankenhaus sein wollen .
Eine alleinige Anwesenheit wird jedoch den Bedürfnissen der Kinder nicht
gerecht. Deshalb ist die Einbindung der Eltern in das behandelnde Team
notwendig. Durch konkrete, schriftlich fixierte Aufgaben (Rollenzuteilung),
entläßt man die Eltern aus einer passiven, unklaren Rolle, welche sowohl
die Eltern, als auch die im Krankenhaus tätigen Mitarbeiter als irritierend
und zum Teil auch störend empfinden. Das Gefühl der Hilflosigkeit und der
Eindruck des Überflüssigseins kann durch aktive Beteiligung an der Pflege
des Kindes überwunden werden.
9Im Rahmen der Integration wird den Kindern ermöglicht, ihre Eltern
weiterhin als primäre Bezugspersonen zu erleben. Dies beinhaltet die
Ausführung von zu Hause gewohnter Tätigkeiten, wie z.B. Hilfe bei der
Körperpflege, gemeinsames Essen, zu Bett bringen, ...., wodurch Ver-
änderungen durch den stationären Aufenthalt so gering wie möglich
gehalten werden. Familienspezifische Rituale und Kommunikations-
strukturen bieten sowohl den Eltern, als auch dem kranken Kind, Sicherheit
und Verläßlichkeit.
Für das Krankenhauspersonal, insbesondere für die Kinderkranken-
schwestern/-pfleger, bedeutet dies klare Rollenabsprachen, sowie das
Abtreten von Aufgaben an die Eltern. Durch das Übertragen dieser
Tätigkeiten müssen nun neue Koordinations- und Kooperationsformen
erarbeitet werden. Das Fachpersonal kann sich als Begleiter und Beobachter
zur Verfügung stellen und die Kinder zu einem gewissen Teil in ihrer
gewohnten, familiären Situation kennen- und verstehen lernen.
VI. Unterstützende Hilfestellungen für die Eltern
durch das Pflegepersonal
Hilfe zur Integration können und sollen Pflegende anbieten, damit Eltern
sich im Krankenhaus, auf der Station orientieren können, sich willkommen
fühlen und in ihrer Kompetenz anerkannt werden.
Anhand der Beispiele „Aufnahmesituation“ und „Strukturvorgaben“ werde
ich erläutern, wie die Integration von Eltern idealerweise unterstützt werden
kann :
10Aufnahmesituation
Die Aufnahme ins Krankenhaus stellt in den meisten Fällen eine
Ausnahmesituation bis hin zur Krisensituation dar. Eltern und Patient haben
Ängste, sind oft verunsichert, fühlen sich vielleicht aufgrund der Ereignisse
überrollt und sehen sich einer ungewohnten Umgebung gegenüber. Daher
ist gerade die Aufnahmesituation ein entscheidender Moment für eine
konstruktive Zusammenarbeit zwischen Eltern und Krankenhauspersonal
auf der Grundlage gegenseitiger Annahme, Wertschätzung und Akzeptanz.
Eltern gewinnen einen ersten Eindruck darüber, wie gut ihr Kind versorgt
wird, wie strukturiert die Abläufe sind. Im Rahmen dieses Erstkontaktes
können auftretende Unsicherheiten/Verunsicherungen erkannt und beseitigt
werden.
Das Aufnahmegespräch stellt eine Möglichkeit dar, Eltern erste wichtige
Orientierungshilfen zu vermitteln:
- Kennenlernen des Krankenhauses, der Station und der Räumlichkeiten.
- Kennenlernen des „regulären“ Tagesablaufes
- Kennenlernen des behandelnden Teams
- Kennenlernen der verbindlichen stationseigenen (idealerweise
krankenhauseigener) Regelungen z.B.: Verpflegung tagsüber
anwesender Eltern, Besuche von Freunden und Geschwistern,
Mitaufnahme von Bezugspersonen.
- Austausch von Informationen
Eltern gewinnen dadurch Klarheit und erkennen ihren Agitationsrahmen.
Das System Krankenhaus verliert etwas von seiner Undurchsichtigkeit und
wird transparenter. Hieraus folgt, daß Eltern Sicherheit gewinnen und diese
ihren Kindern weitergeben können.
Erstkontakt: Wichtig ist schon im Vorfeld eine strukturierte
Vorgehensweise durch Absprachen mit anderen Berufsgruppen
(Verwaltungsfachkräfte, Ärzte,...), damit sich der Erstkontakt für die Eltern
nicht verwirrend, sondern hilfreich gestaltet.
Sobald der Patient mit seinen Eltern auf Station kommt, erfolgt die
Begrüßung durch die Bezugspflegeperson. Das zugeteilte Zimmer und das
Bett wird gezeigt, Mitpatienten namentlich vorgestellt. Erstinformationen
bezüglich des weiteren Ablaufs, z.B. Zeitpunkt, Inhalt und Ziel des
11Aufnahmegesprächs, Kontaktmöglichkeiten mit den Ärzten,... werden
mitgeteilt. Für das Aufnahmegespräch wird ein ruhiger, störungsfreier
Raum ausgewählt. Während des Gesprächs sollen Unterbrechungen mittels
Übernahme anfallender Tätigkeiten durch Kollegen vermieden werden.
Das Gespräch wird von der Bezugspflegekraft durchgeführt, die
idealerweise auch in den nachfolgenden Tagen Ansprechpartner sein sollte.
Hierbei kann eine Vertrauensbasis durch Kontinuität im Kontakt geschaffen
werden. Im Gespräch wird eine Pflegeanamnese gemeinsam erhoben. In
diesem Zusammenhang kann man den Eltern aufzeigen, daß ihre
Anwesenheit und Beteiligung, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, am
Behandlungsverlauf erwünscht ist. Die Eltern haben die Möglichkeit,
Erwartungen und Wünsche zu äußern. Rituale, religiöse Gebräuche können
in die Pflege integriert werden. Pflegemaßnahmen, Hilfestellungen durch
die Eltern können zu diesem Zeitpunkt besprochen, festgelegt und
schriftlich fixiert werden.
Anhand dieser Vorgehensweise wird der Informationsaustausch aller
Beteiligten gewährleistet. Gleichzeitig sollte den Eltern deutlich gemacht
werden, daß keine Kontrolle über die von den Eltern ausgeführten
pflegerelevanten Tätigkeiten erfolgt, Fragen der Fachkräfte jedoch für die
Krankenbeobachtung und Beurteilung von Pflegemaßnahmen unerläßlich
sind, da sie in den Verantwortungsbereich der Pflegefachkräfte fallen.
Konzeptionelle Rahmenbedingungen und Regeln des jeweiligen
Krankenhauses, wie auch die der aufnehmenden Station werden genannt
und erläutert. Da diese verbindlich sind, erhalten die Eltern davon eine
schriftliche Auflistung (siehe als Beispiel Anhang 1, welcher allerdings
nicht mehr ganz aktuell und im Sinne der Integration teilweise auch
widersprüchlich ist). Im Anschluß an das Aufnahmegespräch sollte ein
Rundgang über die Station erfolgen, um die Räumlichkeiten kennen zu
lernen. Währenddessen wird den Eltern auch Gesprächsbereitschaft für
später auftretende Fragen signalisiert.
Die oben aufgeführte Vorgehensweise steht natürlich in Abhängigkeit zur
krankheitsbedingten Verfassung des aufzunehmenden Kindes. Liegt die
Notwendigkeit zu einer akuten medizinischen Versorgung vor, wird sich der
12Verlauf der Aufnahmesituation individuell ändern. Notwendige
medizinische und pflegerische Maßnahmen haben Vorrang.
Strukturvorgaben während des Krankenhausaufenthalts /
Wochenplan
Aufwendige Diagnose- und/oder Therapiepläne erfordern zeitliche, wie
auch inhaltliche Informationen für die Eltern über alle Termine und
Untersuchungen.
Ein am Bett des Kindes bereitgelegter Tages-, bzw. Wochenplan ist
hilfreich, einen Überblick über vorgegebenen Termine und Unter-
suchungen zu erhalten.
Beispiel eines Tages- / Wochenplans:
Name: Matthias Löwenzahn
Tag der Aufnahme: Dienstag, 08.06.1999
Zeit Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Montag
08.06.99 09.06.99 10.06.99 11.06.99 12.06.99 13.06.99 14.06.99
08.00 nüchtern f.ür Schlaf-
Blutent- entzugs
nahme EEG
09.00 KG KG
10.00 10.30 Uhr
SONO
11.00 Aufnahme Schule
Ärzte
12.00
13.00 Hörtest MRT
14.00
15.00
Später ab 0 Uhr
als (14.6.) wach
15.00 bleiben
Auf Echo , Röntgen
Abruf
13Ein Tages- / Wochenplan bietet den Eltern Übersicht und ermöglicht ihnen :
- gezielt Informationen zu den einzelnen Terminen einzuholen.
- Begleitung zu den Untersuchungen des Kindes zu organisieren.
- die Zeit zwischen den Terminen/Untersuchungen gestalten zu können.
- Freiräume und Rückzugsmöglichkeiten zu erkennen.
- Besuche von außerhalb sinnvoll einzuplanen.
Die Eltern erhalten einen Überblick, wie weit Diagnostik und Therapie
vorangeschritten sind. Weitere anfallende und vereinbarte Termine werden
in dem Plan aufgenommen und können, ebenso wie der geänderte
Tagesablauf des Kindes, anhand dessen besprochen werden. Ein ständiger
Informationsfluß findet statt, wodurch Wünsche der Eltern und der Kinder
bzgl. der Terminplanung aufgenommen und aufeinander abgestimmt
werden können. Durch die Koordination von Terminen wird der spezielle
Tagesablauf des Kindes im Tages-/Wochenplan festgelegt und dadurch für
alle Beteiligten klar ersichtlich.
VII. Schwierigkeiten der Integration
Es gibt viele Faktoren, die die Umsetzung der Integration von Eltern
schwierig gestalten :
a) Schwierigkeiten durch die Einstellung des Krankenhauspersonals
- Es mangelt an Akzeptanz und Einsicht zur Notwendigkeit der
Integration.
- Pflegepersonal fühlt sich für das kranke Kind, nicht jedoch für die Eltern
zuständig
- Unerfahrenheit in der Elternarbeit, besonders im Umgang mit Eltern, die
als problematisch/schwierig angesehen werden, da sie z.B. den Ablauf
stören, die Behandlung erschweren, den Fachkräften „unangemessen
kritisch“ entgegentreten oder gar gegen die Interessen des Kindes
agieren.
14- Eltern werden als Belastung erlebt, da sie zusätzlich noch viele
Hilfestellungen benötigen.
- Die Umsetzung der Integration wird nur einer Berufsgruppe (z.B.
Pflegepersonal) abverlangt und eine berufsgruppenübergreifende Unter-
stützung, wie auch die daraus resultierende gemeinsame Auseinander-
setzung fällt weg.
- Es mangelt oft an klaren, verbindlichen Absprachen über Kompetenzen
und Entscheidungsbefugnisse der beteiligten Parteien, sowie an gegen-
seitiger Anerkennung der jeweiligen Kompetenz.
b) Schwierigkeiten, die sich aus der räumlichen Situation und der
Krankenhausstruktur ergeben:
- Es mangelt an verbindlichen und einheitlichen Absprachen zwischen
den verschiedenen Stationen, Abteilungen und anderen Kliniken im
Umgang mit der elterlichen Integration.
- Platzmangel in den Zimmern (meist reicht der Platz gerade mal für die
Patientenbetten, an Stellmöglichkeiten für Elternbetten ist nicht gedacht)
- Es fehlen oft günstige Unterkunftsmöglichkeiten in der Nähe des
Krankenhauses.
- Selten besteht die Möglichkeiten, Elternzimmer als spezielle Eltern-
aufenthaltsräume oder Elternküchen einzurichten.
- Meist fehlen ausreichend große Spiel- und Bewegungsräume, in denen
sich die Eltern mit ihren Kindern beschäftigen können.
c) Schwierigkeiten, die sich aus gesundheitspolitischen Maßnahmen
ergeben
- Es wurden Budgetkürzungen vorgenommen.
- Die Pflegepersonalregelung wurde im Frühjahr 1997 außer Kraft
gesetzt, wodurch es zu Stellenreduzierungen kam.
- Es gibt zu wenig unterstützende Berufsgruppen (Erzieher,
Psychologen,...), da das dafür notwendige Geld nicht vorhanden ist.
Ganz im Gegensatz zum Bedarf wird sogar entlassen, bzw. bei
freiwilligem Ausscheiden von Personal keine Neuanstellung angestrebt.
15d) Schwierigkeiten, die sich durch die beobachtende und beurteilende
„Instanz“ Eltern ergeben können
Eltern werden als eine Art Instanz erlebt, die nun im Gefüge des
Krankenhauses beteiligt ist, Schwachstellen anspricht und somit
„sichtbar“ macht.
Beispiele: Mangelnde Absprachen innerhalb der Station.
Unbefriedigende Kooperation
Mangelnder, fehlender und/oder verzögerter Informa-
tionsfluß.
Alle Beispiele sind Schwachstellen, welche bislang als unabwendbar,
unlösbar hingenommen wurden, somit ein Problemlösungsversuch erst
gar nicht unternommen wurde.
Die meisten der aufgezählten Schwierigkeiten und Einwände, die durch
Integration von Eltern aufkommen können, sind durch genaue Planung und
schrittweise Umsetzung von verbindlichen Regeln lösbar.
Der erste Schritt eines Teams, das eine Integration der Eltern für wichtig
und notwendig erachtet, ist die gemeinsame Auseinandersetzung mit diesem
Vorhaben / Thema. Hierbei werden die verschiedenen Handhabungen im
Umgang mit der Elternintegration sichtbar. Unterschiedliche Auffassungen
und Ideen zur Umsetzung können aufgezeigt und diskutiert werden.
Mögliche Vorgehensweise zur Problembeseitigung :
Als Gerüst für planvolles und zielgerichtetes Handeln hat AKiK 3) folgende
Schritte erarbeitet, die ich für umsetzbar und praxisbezogen halte:
1. Problembewußtsein entwickeln
2. Vorhaben benennen
3. Ist-Situation ermitteln
4. Problemfelder benennen und bearbeiten
5. Umsetzungsmöglichkeiten skizzieren, priorisieren und abarbeiten
6. Ergebnisse mit Vorhaben vergleichen und gegebenenfalls nacharbeiten.
3)
AKiK 1996
16Selbstverständlich obliegt die Erarbeitung des Ziels „Integration von Eltern
stationär versorgter Kinder“ nicht nur den Pflegekräften, sondern sollte in
aktiver Zusammenarbeit aller direkt beteiligten Krankenhausberufsgruppen,
wie auch den Eltern und Patienten entwickelt werden.
VIII. Resümee
Durch die Bearbeitung dieses Themas wurde mir noch deutlicher, daß
Integration nicht dadurch erreicht wird, daß jeder seine individuellen
Versuche unternimmt, Eltern zu integrieren. Denn so bleibt es oft nur bei
einzelnen Bemühungen, die aufgrund von fehlenden, zuvor ausgearbeiteten
und verbindlichen Regeln scheitern.
Pflegekräfte und Ärzte werden weiterhin in die Rollen „gut“ oder „böse“
eingeteilt, je nach deren Bereitschaft, Ausnahmen und Zugeständnisse
einzuräumen.
Kollegen, die sich an die noch gültigen, jedoch nicht zeitgemäßen
Regelungen halten, finden sich trotz eines strukturgebenden Verhalten in
einer eher schlechten Position.
Fazit : Es muß also eine gemeinsame Auseinandersetzung stattfinden, um
gemeinsam verbindliche Absprachen zu treffen.
Schon in der Kinderkrankenpflegeausbildung müßten Themen, wie
Gesprächsführung, Elternarbeit und Pädagogik mehr Stunden zugeteilt
werden. Dadurch könnte ein Grundstein zu einer erweiterten Qualifikation
gelegt werden, indem durch erlernte Kommunikationsstrukturen und
Interaktionsmuster schwierige Situationen im Umgang mit Eltern wahr-
genommen werden können. Dies wäre ein erster Schritt, Eltern mit ihren
Sorgen und Nöten, Fragen und Unsicherheiten,...aufzufangen und
entsprechend der jeweiligen Situation zu begleiten.
Examiniertes Pflegepersonal könnte in seiner Arbeit durch Seminare über
Kommunikationsformen und Gesprächsführung in der Elternarbeit,
Wahrnehmung von Konflikten, ... unterstützt werden.
17Ebenso wäre Supervision wünschenswert, um den täglichen Belastungen
reflektiert entgegentreten zu können.
Unerläßlich ist es, bei Um- bzw. Neubauten Aspekte der Elternintegration
(z.B. separates Elternzimmer) in die jeweilige Planung einfließen zu lassen.
Somit wären zumindest die baulichen / räumlichen Voraussetzungen
geschaffen.
Es gibt sicher noch viele weitere Möglichkeiten, Integration von Eltern zu
„be-leben“, die sich, wenn man sich mit dem Thema ernsthaft
auseinandersetzt, ergeben, aufgebracht und vielleicht auch wieder verworfen
werden (müssen).
Ich würde mir jedenfalls wünschen, daß diese Hausarbeit einen Impuls all
denen geben kann, die Integration nicht nur „halbherzig“, sondern fundiert
und strukturiert in ihrer Arbeit wiederfinden möchten.
Literaturverzeichnis
AKTIONSKOMITEE KIND IM KRANKENHAUS E.V.
BUNDESVERBAND: Referat des AKiK-Bundesverbandes anläßlich des
Jubiläums „30 Jahre Kinderchirurgie Dortmund“ am 30.11.1996
Geschäftsstelle: Kirchstraße 34, 61440 Oberursel
AKTIONSKOMITEE KIND IM KRANKENHAUS E.V.
BUNDESVERBAND: Referat des AKiK-Bundesverbandes anläßlich der
Fortbildungsveranstaltung „ 3. Bottroper Pflegegespräch“ am 18.06.1998
Geschäftsstelle: Kirchstraße 34, 61440 Oberursel
HOEHL, M; KULLICK, P: Kinderkrankenpflege und
Gesundheitsförderung.
Stuttgart: Georg Thieme Verlag
18Sie können auch lesen