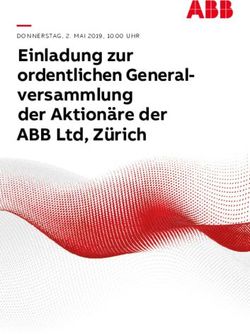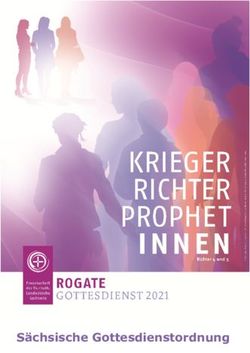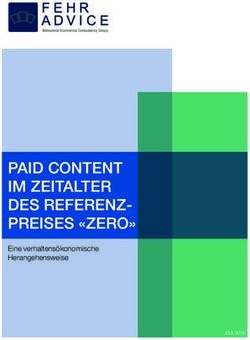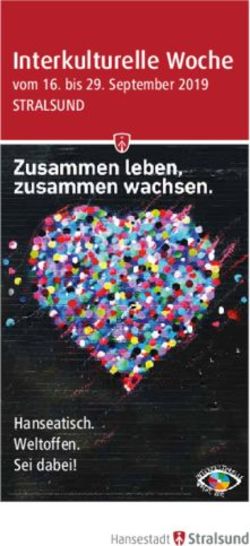Iran und die Achse des Bösen - kommt der Kampf der Kulturen?
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Iran und die Achse des Bösen –
kommt der Kampf der Kulturen?
Die Debatte um die bestehenden Probleme des iranischen Atomprogramms setzt
ein landeskundliches Vorverständnis und den zahlreichen Kulturbegegnungen
dieses Landes voraus. Dies schließt auch das Verhältnis zwischen dem Iran und
Israel ein.
Mir liegt es fern, Kulturen stufentheoretisch zu behandeln und von einer Kategorie
der ›Achse des Bösen‹ oder gar der ›Geographisierung des Denkens‹ auszugehen.
Dies wäre deskriptiv falsch, normativ irreführend und politisch unverantwortlich.
Meine These läuft darauf hinaus, mit Ihnen gemeinsam einen gangbaren Weg zu
Toleranz, interkultureller Kommunikation und Verständigung zu finden.
Es ist allgemein bekannt, dass die Geschichte der Menschheit von Kulturbegeg-
nungen geprägt ist, die geschichtlich völlig unterschiedlich verlaufen sind. Auch der
Iran ist von solchen Begegnungen nicht unberührt geblieben, die seine Kultur,
Religion und Stationen seiner Philosophie beeinflußten.
Geographisch und kulturell befindet sich dieses Land an der Nahtstelle mehrerer
Welten. Der Iran grenzt im Norden an Armenien, Aserbaidschan und Turkmenistan,
im Osten an Afghanistan und Pakistan, im Westen an die Türkei und den Irak. Im
Süden stößt er ans Meer, an den Golf von Oman, die Straße von Hormos und den
Persischen Golf.
Bis 1934 lautete die Bezeichnung des Staates ›Persien‹. Der Name ›Iran‹ taucht
erstmals als ›Eran‹ d.h. ›Land der Arier‹ 243 v.u.Z. in persischen Königsinschriften
auf. Die als Arier bezeichneten ost-indoeuropäischen Stämme der Perser, Meder,
Parther, Choresmier, Sogder, Saken, Arachosier und Drangianer waren um 1000
v.u.Z. mit anderen indo-iranischen Stämmen aus Zentralasien in das heutige Gebiet
des westlichen Iran eingewandert.
Das Dortige Denken orientiert sich am indoeuropäischen Osten: Sprache, Mythen
und teilweise die Philosophie verbindet es mit dem vedischen Indien und den
anderen Staaten der asiatisch-indoeuropäischen Welt. Hinzu kommt die Nähe zu
den alten Kulturen Mesopotamiens. Beziehungen mit dem antiken Hellas ließen dasYousefi: Iran und die Achse des Bösen
Land auch an den dortigen geistigen Entwicklungen teilnehmen. Hierzu gehören vor
allem die platonische, neuplatonische und aristotelische Tradition.
Von zentraler Bedeutung ist die Begegnung zwischen der arabisch-islamischen
Kultur mit dem zarathustrischen Persien, die das Schicksal dieses Reiches nachhaltig
beeinflußte. Noch heute nimmt der Iran innerhalb der islamischen Kulturregionen
eine besondere Stellung ein.
Die dynamische Entwicklung der iranischen Philosophie von Farabi über Ibn Sina,
Molla Sadra bis zu Abdolkarim Sorush macht deutlich, dass die Moderne in den
Grundpositionen der iranischen Geisteskultur bereits angelegt ist. Diese Dynamik
blieb nicht bloß der Theorie verhaftet, sondern beeinflußte die Realpolitik des Iran,
insbesondere seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Zu nennen ist die Aufklärungs-
bewegung der persischen engelab-e-mashrute, genannt Verfassungsrevolution von
1905 bis 1911, die eine Demokratie in Persien einführte. Diese gewährte unter
anderem die Gewaltenteilung, die Trennung zwischen Staat und Religion, Gleichheit
von Mann und Frau und einer vom Volk gewählten Parlament. Dieser
Parlamentarismus wurde allerdings durch Mohammad Ali Schah mit Hilfe der
Briten und Russen zerschlagen. Zu jener Zeit herrschten in Europa allenthalben noch
Monarchen.
Ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung Irans waren die Reformen des
Ministerpräsidenten Mohammad Mossagegh von 1951. Sein Ziel war, in Anlehnung
an die iranische Verfassungsrevolution, die Etablierung einer Demokratie. Er hielt
die Verstaatlichung des iranischen Erdöls für ein unabdingbares politisches Ziel, mit
dem er die Raubtiermentalität der imperialistischen Denkpraxis zügeln wollte.
1953 gelang es aber der CIA, in Kooperation mit dem Schah und monarchistischen
Gruppen, Mossadegh zu stürzen. Der Schah kehrte zurück und regierte das Land
25 Jahre lang zum Nutzen der US-amerikanischen und britischen Ölgesellschaften.
Mossadeghs politische und ökonomische Konzepte haben den Iran und das
Kollektivbewußtsein der Bevölkerung des 20. Jahrhunderts bis heute geprägt.
Die islamische Revolution von 1979 fühlte sich auch den Grundwerten der
Verfassungsrevolution und den Ideen von Mossadegh verpflichtet. Diese
Grundeinstellung trug dazu bei, dass vom Westen, unter der Führung der USA, der
2Yousefi: Iran und die Achse des Bösen
achtjährige irak-iranische Krieg angezettelt wurde und seitdem ein Verteufelungs-
diskurs gegen die iranischen Regierungssysteme geführt wird.
Hierzu gehört auch die Verschwörungstheorie, in der ›islamischen Welt‹ hätte es
keine Aufklärung und Demokratie gegeben. Die Geschichte jedoch belehrt uns eines
besseren.
Diese strukturelle Gewalt, die mit Parolen wie ›Die Achse des Bösen‹ einhergeht,
hat eine sachliche Debatte um den Iran erschwert.
Eine ›Achse des Bösen‹ evoziert biblische Vorstellungen und weist auf einen
unüberbrückbaren Gegensatz hin, den es zu vernichten gilt. Dieser Ausdruck hat auf
politischer Ebene eine lange Tradition.
Im Zweiten Weltkrieg nannte Winston Churchill den Zusammenschluß von
Deutschland, Italien und Japan Achsenmächte. Ronald Reagan griff diesen Begriff in
seiner Propaganda gegen die Sowjetunion auf und nannte sie Achse des Bösen.
Nach dem Ende des Kalten Krieges wurde der Begriff der ›Achse des Bösen‹ von
den USA gezielt eingesetzt, um eine neue Teilung der Welt festzulegen, deren
Staaten je nach politischem Bedarf wechseln. Präsident Bush bezeichnete 2002
Afghanistan, Nordkorea, Iran und den nun demokratischen Irak als ›Achse des
Bösen‹, da sich diese Staaten angeblich mit Terroristen liieren und den Weltfrieden
bedrohen. Mittlerweile sind Weißrußland und Simbabwe hinzugekommen, die von
der amtierenden Außenministerin Condolezza Rice als »Vorposten der Tyrannei und
Bankier des Terrorismus« tituliert wurden. Hierbei wird das ›Sündenregister‹ der
USA völlig ausgeblendet: der Abwurf der Atombomben in Hiroshima und Nagasaki
die Einsetzung von Giftgas in Vietnam und die Einrichtung von Guantanamo.
An der Irak- und Iranpolitik wurde deutlich, dass diese Länder als Freund der
USA und ihrer Verbündeten galten, wenn deren wirtschaftliche Ausrichtung den
Interessen der USA und ihre Verbündeten diente, und dass sie zur ›Achse des Bösen‹
gezählt wurden, wenn dies nicht mehr der Fall war.
Parallel zur ›Achse des Bösen‹ ist von einer ›Achse des Guten und Demokraten‹
die Rede: Hier sind die ›Christen‹, dort die ›Moslems‹; hier Kultur und Zivilisation,
dort Fanatismus und Barbarei; hier sind Demokraten und Hüter der Menschen-
würde, dort Tyrannen und Folterer; hier Gutes und Humanes, dort nur Schlechtes
3Yousefi: Iran und die Achse des Bösen
und Inhumanes. Eine dogmatische Anthropologie manifestiert eine radikale
Differenz zwischen eigentlichen und uneigentlichen Menschen. Auch wenn es nicht
laut ausgesprochen wird.
Im Streit um das Atomprogramm des iranischen Präsidenten Mahmoud
Ahmadinejad gewann die Bezeichnung ›Achse des Bösen‹ neue Bedeutung.
Ahmadinejad war vor seiner Präsidentschaft Hochschullehrer. Auf der politischen
Bühne wurde er bekannt als Bürgermeister von Teheran. Er ist ein konservativer
Politiker, der nicht dem Klerus angehört und der nach neuen Wegen sucht, um sein
Land in der Welt zu behaupten.
Im Juni 2005 wurde er im Iran zum Präsidenten gewählt, hauptsächlich von jungen
Menschen. Der Iran ist ein junges Land, mit 70% Menschen unter 35 Jahren, die eine
Alternative für die Zukunft suchen. Ahmadinejads erklärtes Ziel war und ist, die
iranische Industrie auf allen Ebenen fortzuentwickeln und die Wirtschaft
anzukurbeln. Eingeschlossen ›soziale Gerechtigkeit‹ und die ›Bekämpfung von
Korruption und Arbeitslosigkeit‹.
Wie wurde die Wahl Ahmadinejads im Westen aufgenommen?
Die USA und einige westeuropäische Staaten hatten von Beginn an mit harscher
Kritik auf die Kandidatur Ahmadinejads reagiert. Er war als »unbeschriebenes
Blatt«, als »unberechenbarer Fundamentalist«, als »Botschaftsbesetzer« oder
»Islamist« bezeichnet worden, der im Iran eine »islamistische Taliban-Herrschaft«
installieren will. Das US-Außenministerium erklärte, der Iran bewege sich mit dieser
Wahl gegen den »allgemeinen Demokratisierungstrend in der Region«. Aus der
Logik der Ereignisse heraus ist mir schleierhaft, von welchem ›Demokratisierungs-
trend‹ hier die Rede sein soll.
Der scheidende Verteidigungsminister Rumsfeld kritisierte in einem Interview den
Wahlvorgang im Iran und bezeichnete Präsident Ahmadinejad als einen »Burschen«,
den er zwar nicht kenne, aber es sei klar, dass dieser Bursche, »weder die Freiheit«
noch »die Demokratie« liebt. Michael Friedmann bezeichnete vor kurzem
Ahmadinejad als »Hitler des 21. Jahrhunderts« und Herrn Beckstein hält ihn für
einen »Schwerverbrecher«.
4Yousefi: Iran und die Achse des Bösen
Woran liegt eigentlich das Problem des iranischen Atomprogramms?
Die Garantie der friedlichen Nutzung der Kernenergie ist eine wesentliche
Komponente des Atomwaffensperrvertrages. Gerade diese Tatsache wurde und wird
in der westlichen Presse verschwiegen, dass Iran diesen Vertrag längst
unterschrieben und das iranische Parlament ihn ratifiziert hat, was Indien und
Pakistan noch nicht getan haben. Als Unterzeichner des Vertrags hat der Iran
faktisch das Recht, Uran im eigenen Land zu fördern, umzuwandeln, anzureichern
und zu Brennelementen zu verarbeiten. In seinem Wirtschaftsprogramm machte
Ahmadinejad gerade die friedliche Nutzung der Kernenergie unter Aufsicht der
IAEA zum festen Bestandteil seiner Politik. Aktivitäten zum Bau einer Bombe
schließt er aus und verweist auf die Friedfertigkeit des iranischen Volkes, von dessen
Boden in den letzten 200 Jahren kein Krieg ausgegangen ist.
Die US-amerikanische Führung, im Zusammenspiel mit einigen westeuropäischen
Staaten, die sich oft als ›Koalition der Willigen‹ oder ›Internationale Gemeinschaft‹
bezeichnen, behaupten stets, mit diesem Atomprogramm seien Aktivitäten
verbunden, die mit dem Bau einer Atombombe enden. Dieser Verdacht wurde
ununterbrochen in den Medien wiederholt und sukzessive zu Tatsachen erhoben.
Ähnlich wurde mit dem Irak verfahren, als der damalige Verteidigungsminister
Colin Powell vor dem Weltsicherheitsrat angebliche Beweise anführte, dass der Irak
Nuklearwaffen besitze und baue. Heute wissen wir, dass diese falschen
Behauptungen auf der Hausarbeit eines englischen Studenten beruhten.
Im Herbst 2004 legten Großbritannien, Frankreich und Deutschland dem Iran
einen Vorschlag nah, der den unbedingten Verzicht des Landes auf
Urananreicherung vorsah. Sollte der Iran sich diesem ›Anreizpaket‹, wie sie es
nennen nicht beugen, müsse das Land mit Sanktionen rechnen. Bundesaußen-
minister Steinmeier bezeichnete diese Methode, die mit Zuckerbrot und Peitsche
erziehen will, als ›Weg der Vernunft.‹ Auf die Verweigerung des iranischen
Präsidenten verabschiedete der Weltsicherheitsrat unter dem Druck Großbritanniens
und der USA eine Resolution. Der Iran solle die Anreicherung von Uran einstellen,
sonst drohten dem Land ›schwere Sanktionen‹. Ahmadinejad lehnte diese Forderung
mit der Begründung ab, diese ließe sich rechtlich mit dem Atomwaffensperrvertrag
nicht vereinbaren.
5Yousefi: Iran und die Achse des Bösen
Es ist der Akt einer Demokratiediktatur, wenn die ›Koalition der Willigen‹ alles
unter sich ausmacht und die Ergebnisse der Dialoge mit dem Iran a priori festlegt.
Die Reaktion auf den Brief des iranischen Präsidenten, in dem dieser ein direktes
Gespräch mit Präsident Bush anbot, belegt diese Behauptung. Bereits eine Woche vor
der Veröffentlichung hat das US-amerikanische Außenministerium den Brief als
›nutzlos‹ und ein ›Ablenkungsmanöver‹ bezeichnet. Bis heute ist eine Antwort
ausgeblieben.
Es ist unübersehbar, dass die USA und ihrer Verbündeten hier, wie seinerzeit im
Irak, eine Steuerung der Wahrnehmung in der westlichen Öffentlichkeit und darüber
hinaus beabsichtigen. Das eigentliche Ziel der Bush-Administration und seiner
Vorgänger ist, wie immer wieder betont wird, eine ›Regierungswechsel‹ im Iran
herbeizuführen, um ein Marionettenregime wie in Afghanistan und im Irak zu
installieren, die ohne wenn und aber dem Interesse der USA und ihrer Verbündeten
dienen. Diese repressive Außenpolitik, die mit struktureller Gewalt einhergeht, hat
nicht nur im Irak und in Afghanistan, sondern in der gesamten Welt zu Instabilität
geführt.
Trotz bestehender Wirtschaftsembargos seit 1979 hat der Iran es geschafft, das
Land ökonomisch weit voranzutreiben. Immer wird danach getrachtet,
nichtwestliche Gesellschaften in Abhängigkeit zu halten und als Absatzmärkte für
die eigenen Produkte und Gewinnmaximierung zu nutzen; ihnen wird, wie der
Friedensforscher Johan Galtung schon sagt, durch die Praxis von struktureller
Gewalt jeglicher Versuch selbstständig zu sein, de facto zunichte gemacht, und dies
ungeachtet ihrer Haltung zu demokratischen Werten.
Im Zusammenhang mit dem Atomkonflikt wird Ahmadinejad vorgehalten, er
wolle diese Technik unter anderem zur Vernichtung Israels einsetzen.
Auch diese Annahme ist verkürzt. Hierbei ist anzumerken, dass die Parole
Ahmadinejads: ›Israel muß von der Landkarte getilgt werden‹, genauso allgemein
und falsch ist wie der Slogan des Präsidenten Bush, der von einer ›Achse des Bösen‹
ausgeht. Nun: Wie sind die Beziehungen zwischen dem Iran und Israel tatsächlich?
Israel wurde 1948 durch organisierte Gewalt der westlichen Mächte gegen den
Willen des palästinensischen Volkes eingerichtet, was faktisch die Entrechtung der
6Yousefi: Iran und die Achse des Bösen
Palästinenser zur Folge hatte. Israels erster Präsident David Ben Gurion war der
Ansicht, das Land sollte vor allem mit dem Iran und der Türkei koalieren, um nicht
von den arabischen Nachbarn isoliert zu werden. Tatsächlich waren die Beziehungen
zur Zeit Mohammad Reza Pahlavis versöhnlich, weil der Schah als Verbündeter der
USA nicht anders dürfte, als das Existenzrecht Israels de facto anzuerkennen. Auch
Israel betrachtete den Iran seit seiner Gründung als strategischen Partner. Die
Kooperation beschränkte sich jedoch auf die gemeinsame Geheimdienstarbeit im
Nahen Osten.
Mit der Islamischen Revolution von 1979 verschlechterten sich die Beziehungen
zwischen Iran, USA und Israel. Durch die Versagung einer israelischen Botschaft
und deren Überlassung an die Palästinenser gab der Iran faktisch zu verstehen, das
Existenzrecht Israels nicht mehr anerkennen zu wollen. Diese Reaktion gründet sich
auch auf Art. 3 Abs. 16 der iranischen Verfassung, der einerseits die bedingungslose
Unterstützung islamischer Staaten festschreibt, andererseits einen Einsatz für die
Unterdrückten und Entrechteten vorsieht. Auch aufgrund dieser Vorschrift erkennt
der Iran das Existenzrecht Israels nicht an und unterstützt das palästinensische Volk,
in dessen Augen Israel ein Unrechtsregime darstellt.
Ahmadinejad hob vor kurzem in einem Interview mit dem SPIEGEL hervor, er
habe »keinerlei Vorbehalte gegen Juden, mit denen er im Iran in Frieden
zusammenlebt, wohl mit der Politik der Zionisten«. Die Shoah leugnet er nicht, wie
dies in der westlichen Presse unreflektiert berichtet wird. Ahmadinejad weist
lediglich darauf hin, dass die Weltmächte unter dem Vorwand des Holocaust im
Nahen Osten einen eigenen Vorposten namens Israel einrichteten und von dort
praktisch die gesamte Region kontrollieren.
Die Shoah habe sich in Europa ereignet, deshalb müsse die Antwort darauf
ebenfalls in Europa gefunden werden. Der Holocaust und Palästina stehen für
Ahmadinejad in direkter Verbindung zueinander. Er fragt sich, warum Palästinenser
aufgrund der Vergehen des Naziregime leiden müssen. Hier gibt es einen Sieger und
einen Verlierer: »Der Vorrang der Sieger hat die Folge, dass der Besiegte nicht nur
seinen Lebensraum, sondern auch sein Wort verliert.«
7Yousefi: Iran und die Achse des Bösen
Können diese Auseinandersetzungen als ein Kampf der Kulturen bezeichnet
werden?
Das affirmative Gerede von einem Kampf der Kulturen ist in mehrfacher Hinsicht
bedenklich. Kulturen waren und sind keine Fenster, die sich nach außen öffnen,
durch die man in die Ferne blicken kann. Kulturen sind immer von
Interdependenzen geprägt und insofern wie die Fäden eines Gewebes, die in
vielfacher Weise miteinander verbunden sind.
Deshalb ist und bleibt die These von Samuel Huntington, in der er von einem
Kampf der Kulturen ausgeht, falsch. Huntington selbst spricht aber eines der
wichtigsten Grundmotive für Konflikte an: »Der Westen eroberte die Welt nicht
durch die Überlegenheit seiner Ideen, oder der Werte oder seiner Religion, sondern
vielmehr durch seine Überlegenheit bei der Anwendung von organisierter Gewalt.
Die Westler vergessen oftmals diese Tatsache; die Nichtwestler vergessen sie
niemals«.
Die Achse des Bösen, die geradezu einen ›Kampf der Kulturen‹ heraufbeschwören
will, teilt die Welt in unvereinbare Sphären auf. Auch das Denken wird
geographisiert. Hierbei geht es um die Klassifizierung des westlichen Denkens als
vorwiegend linear bzw. analytisch. Demgegenüber wird fernöstliches Denken als
kreisförmig bzw. holistisch bezeichnet.
Die Problematik der ›Geographisierung des Denkens‹ beruht darauf, dass hier
Ergebnisse statistischer Untersuchungen zu Typen generalisiert werden. Der Typus
läßt aber keine Aussagen über das Denken eines beliebigen Individuums in einer der
beiden Kulturen zu und sagt nichts über Teilkulturen aus. Diese Haltung ist
empirisch inadäquat.
Wie können duale Denkstrukturen, denen eine feudalistische
Kommunikationsstruktur zugrunde liegt, vermieden werden?
Hier scheint das Konzept der empirischen Interkulturalität hilfreich zu sein.
Interkulturalität verwirft kulturalistische Tendenzen, die das ›tertium compara-
tionis‹ von vornherein für alle Vergleiche und für alle Kommunikationen festlegen.
Hierauf beruhen Theorien und Lehren, in deren Namen Gewalt ausgeübt wurde:
Kolonialismus, Expansionismus, Imperialismus, Zionismus und Islamismus.
8Yousefi: Iran und die Achse des Bösen
Zu den Praktiken des Interkulturellen gehört auch die Berücksichtigung der
religiös-spirituellen Dimensionen, die seit der Aufklärung vernachlässigt worden
sind. Ein Grund besteht darin, dass eine Ausklammerung des Religiösen eine
Denkart abstrakt macht, eine Vernachlässigung der Vernunft sie blind bleiben läßt.
Der Weltphilosoph Karl Jaspers verband bereits vor gut 50 Jahren diese
Dimensionen und setzte die Vernunft mit einem ›grenzenlosen Kommunikations-
willen‹ gleich und nahm an, dass ein Primat der Kommunikation vor dem Konsens
besteht.
Die offene Perspektive einer interkulturellen Denkpraxis ist besonders geeignet,
zur Lösung politischer, ethnischer und religiöser Konflikte beizutragen.
Grundlegend sind hier interkulturelle Kommunikation und angewandte Toleranz,
auf die ich noch zurückkomme. Sie sind verbunden mit mannigfaltigen
interkulturellen Kompetenzen, welche die Gleichberechtigung aller Stimmen als
unbedingte Grundlage des Dialogs gewähren sollen.
Interkulturelle Orientierung hat also eine Aufklärungsfunktion und geht dabei von
der Vermutung aus, dass es mehr als die eine technokratische Vernunft gibt, der sich
die Menschen einer globalisierten Welt immer mehr ausgeliefert fühlen. Sie zeigt die
Verkrustungen unseres Zeitalters und verfolgt das Ziel, den Weg für die Durch-
setzung einer interkulturell-kommunikativen Vernunft zu ebnen, die sich in
verschiedenen Diskursen niederschlägt.
Eine Grundsatzforderung der interkulturellen Denkpraxis ist die Entkoloniali-
sierung und Neusemantisierung geisteswissenschaftlicher Begriffe, die geschichtlich
stufentheoretisch gebildet worden sind: gemeint sind Ausdrücke wie ›Primitive oder
Naturvölker oder Unterscheidungen wie ›Barbaren‹ und ›Zivilisierte‹. Auch die
Benennungen wie Erste, Zweite und Dritte Welt‹ sind problematisch.
Eine Aufgabe der Interkulturalität besteht darin, Paradigmenwechsel und
Perspektivenerweiterung im Denken und Handeln des Menschen zu bewirken,
damit eine Kommunikation zwischen Religionen, Kulturen und unterschiedlichen
Denktraditionen auf gleicher Augenhöhe entstehen und geführt werden kann. Diese
Ambivalenz mit wachem Geist und ohne Vorbehalt zu überwinden, kann sehr
bereichern. Interkulturalität plädiert demzufolge nicht für eine Horizonten-
9Yousefi: Iran und die Achse des Bösen
verschmelzung, sondern für eine Horizontenüberlappung, ohne Differenzen aus den
Augen zu verlieren.
Wie verhält sich diese Orientierung zur Kommunikation?
Das Idealergebnis einer jeden interreligiösen bzw. interkulturellen
Kommunikation ist nicht der Sieg des Einzelnen, sondern die Lösung entstandener
Konflikte auf der Grundlage reziproken Verstehens.
Wenn aber eine Seite entschlossen ist, ihren Standpunkt unter allen Umständen
durchzusetzen, dann bleibt der anderen zwangsläufig die Wahl, entweder sich zu
unterwerfen oder Widerstand zu leisten. Der praktizierte Paternalismus der
›Koalition der Willigen‹ im Irak ist ein Beispiel für die Durchsetzung eigener
Interessen und die Folgen kennen wir.
Interkulturelle Kommunikation ist von einer dialogischen Komplementarität
geleitet, die alle Gesprächspartner als gleichberechtigt ansieht und ihnen gleichen
Freiheitsspielraum zubilligt. Sie ermöglicht mehrere aufeinander abgestimmte und
ineinander verflochtene Kommunikationsmöglichkeiten. Ein integraler Bestandteil
des Dialogs ist interkulturelle bzw. interreligiöse Kompetenz. Sie erweitern die
Register des Wissens und die Bandbereite der Sensibilität.
Ein grundsätzliches Problem der Kommunikation ist der Absolutheitsanspruch.
Hier geht es darum, die eigene Idee, die eigene Philosophie, die eigene politische
Meinung, die eigenen kulturellen Werte oder die eigene Religion für die
ausschließliche Wahrheit zu halten. Liegt dieser Tatbestand vor, so wird nicht mehr
gesagt: das ist meine Idee, meine Philosophie, meine politische Meinung, meine
kulturellen Werte oder meine Religion, sondern: das ist die Idee, die Philosophie, die
politische Meinung, die kulturellen Werte und die Religion. Dass derartige
Einstellungen zur strukturellen Gewalt neigen, liegt in der Natur der Sache.
Hier möchte ich für eine einschließende Differenz plädieren und auf die analoge
Hermeneutik und Angewandte Toleranz eingehen, die für interkulturelle
Verständigung unerlässlich sind:
Bei der ausschließenden Differenz nimmt sich eine bestimmte Gruppe oder ein
bestimmtes Mitglied das Recht, durch totalitäre oder oft vorgefaßte ideologische
Forderungen den Freiheitsspielraum einer Gruppe oder eines bestimmten Mitglieds
10Yousefi: Iran und die Achse des Bösen
festzulegen oder zu begrenzen. Macht wird hier zum Argument, zu einer Instanz, die
bestimmt, was legitim bzw. illegitim ist. Sie diktiert im Grunde genommen die
Spielregeln und bestimmt die Rahmenbedingungen auf allen Ebenen.
Die einschließende Differenz ist das Gegenstück dieser Orientierung. In einer
derartigen Interaktionsform ist nicht mehr zugelassen, dass eine bestimmte Gruppe
das Gleichheitsprinzip verletzt. Sie geht von der ›Einheit aus der Vielfalt‹ aus.
Einheitlichkeit, welche die ausschließende Differenz anstrebt, ist hingegen stets
gewaltgeladen. Dieses Spannungsfeld macht deutlich, dass es eine konfliktfreie
Interaktionsform nicht gibt und auch nicht geben kann, weil der Mensch oft bewußt
oder unbewußt konfliktiv denkt und handelt.
Wer kann in concreto sagen, obwohl es oft behauptet wird, andere Nationen nicht
nur besser zu verstehen, als diese sich selbst verstehen oder faktisch zu wissen, was
für sie gut, besser oder am besten ist? Eine solche Orientierung zieht einen
›erzwungenen Konsens‹ nach sich, den es zurückzuweisen gilt. Gerade hier liegt der
Hase im Pfeffer, weil die ›Koalition der Willigen‹ alles diktieren will. Verstehen ist
keine Einbahnstraße. Stellen wir uns das folgende ›Eselskopf-Seehund-Bild‹ vor.
Dieses Kippbild läßt sich bei der Betrachtung von der linken Seite her als Seehund
erkennen, von der rechten Seite her nimmt man einen Eselskopf wahr.
Angenommen, es gäbe eine Kultur, in der Seehunde alltäglich sind, Esel jedoch
nicht vorkommen. In einer zweiten Kultur sind Esel verbreitet, Seehunde gibt es
jedoch in dieser Form nicht. Jede Kultur wird nur das Tierbild sehen, das ihr bekannt
ist. Jede Kultur bzw. Gruppe hat mit ihrer Deutung recht, aber die Richtigkeit der
eigenen Sehenslogik bedeutet nicht die Falschheit der Sehensweise des Anderen. Die
Abbildung wird jedoch immer nur auf die Art und Weise gesehen, in der der
Betrachter vorgeprägt ist. Das ›Eigene‹ und das ›Fremde‹ sind keine
unüberbrückbare Gegensätze, sondern Abstraktionen bzw. Projektionen. Der aus
unserer Sicht gesehene ›Fremde‹ ist für sich betrachtet ein ›Eigener‹ und jeder, der
sich als ›Eigener‹ betrachtet, ist auch ein ›Anderer‹.
Eine interkulturelle Kommunikation geht deshalb von einer ›analogischen
Hermeneutik‹ aus, die vier Dimensionen kennt:
11Yousefi: Iran und die Achse des Bösen
wie ich mich selbst verstehe,
wie ich das Fremde verstehe,
wie das Fremde sich selbst versteht
und wie das Fremde mich versteht.
Nach diesem Konzept gehen ›Verstehen-Wollen‹ und ›Verstanden-Werden-
Wollen‹ zusammen.
Dass wir häufig nicht wissen wollen, wie das Fremde sich selbst versteht, zeigt das
folgende Beispiel von Heideggers Reise nach Korfu: »An einem Frühlingsmorgen des
Jahres 1962 steht der Tourist Martin Heidegger an der Reling des Kreuzfahrtschiffes
›Jugoslavija‹ und blickt auf die Küste der Insel Korfu [...] Der Philosoph ist jedoch
vom Anblick der Insel enttäuscht: was er sieht, stimmt so gar nicht mit dem überein,
was er im 6. Buch der Odyssee bei Homer gelesen hatte [...] Kurz zweifelt er daran,
ob seine Eindrücke wirklich authentisch sind [...] Doch dann entschließt er sich, nicht
an Land zu gehen. «
»Heideggers Weigerung, sich auf das Fremde [...] einzulassen, läßt sich wohl mit
seiner Angst erklären, sein von der klassischen Literatur geprägtes und ›stimmiges‹
Bild in Frage stellen zu müssen. Es ist die Angst, sich eingestehen zu müssen, dass
der Enttäuschung die Täuschung vorausging, – die Angst, dass sich unsere Bilder
der Realität als Konstruktionen erweisen könnten, mit denen die Realität nicht mehr
begreifbar erscheint. «
Durch die analogische Hermeneutik werden also zwei Extreme zurückgewiesen:
totale Identität, die dem Dialog feindlich gegenüber steht und ausschließende
Differenz, die den Dialog im Ansatz gefährdet.
Die analogische Hermeneutik soll unter anderem auch dazu dienen, die
Zirkularität des Verstehens zu überwinden. Sie weist eine Geographisierung des
Denkens zurück und verbindet die unvermeidbare Partikularität der Hermeneutik
mit ihrer Universalität. In diesem Prozeß liegt für den einzelnen die Chance, sich
nicht nur aus der Gefahr möglicher dogmatischer Verengung zu lösen, sondern auch
fixierte Glaubensformen zu durchbrechen, ohne deshalb zugleich die Kraft und
Berechtigung einzelner Gehalte zu zerstören.
12Yousefi: Iran und die Achse des Bösen
Hier kommen der Angewandten Toleranz wichtige Aufgaben zu:
Um die traditionelle Toleranzvorstellung zu modifizieren, habe ich das Konzept
der Angewandten Toleranz entwickelt. Die Angewandte Toleranz bedeutet nicht wie
bisher bloßes Unangetastetlassen fremder Religionen und Kulturen. Sie bedeutet
geradezu ihre positive Begegnung und aktive Akzeptanz als echter und berechtigter
Möglichkeit eines anderen Denk- und Lebensweges. Dies heißt nicht die Preisgabe
eigener christlicher, islamischer, jüdischer, buddhistischer oder hinduistischer
Überzeugungen und Lebensentwürfe, sondern prinzipielle Offenheit gegenüber dem
Anderen.
Angewandte Toleranz weist jede Form von Indifferentismus und Synkretismus
zurück und plädiert für Traditionsanerkennung ohne Preisgabe eigener Tradition.
Toleranz ist hier kein Wert- oder Tugendbegriff, sondern der Sache nach, ein
instrumenteller Begriff.
Toleranz ohne Grenzen gibt es aber nicht:
Die Grenzen der Toleranz sind stets unter soziokulturellen und ethnologischen
Gesichtpunkten zu analysieren. Dies bedeutet praktisch, dass wir das Welt- und
Menschenbild, die historische Bedingtheit vieler Gepflogenheiten und die religiösen
Praktiken der Völker genau kennen müssen. Dies hat wiederum eine Theorie und
Praxis der Toleranz zur Folge, die ihre Grenzen weder zu eng noch zu weit zieht.
Gerade die Machtfrage ist ein Grund, warum Kulturen und Religionen ein
grundsätzlich ambivalentes Verhältnis zu Gewalt und Gewaltlosigkeit haben und
warum sie nicht nur durch Heilige Schriften, sondern auch durch ihre Traditionen
geprägt sind, die häufig zu den Texten in Widerspruch stehen.
Eine apriorische Grenzbestimmung der Toleranz, die für alle Zeiten und Zonen
absolute Gültigkeit besitzen soll, ist zurückzuweisen. Sie würde die Einheitlichkeit
menschlicher Handlungen, ein einheitliches Menschenbild, eine einheitliche Ethik,
sowie eine Gleichheit der natürlichen, sozial-strukturellen, politischen und
ökonomischen Bedingungen voraussetzen. Deshalb sind die Toleranzgrenzen selbst
verschiebbar. Wir können nicht von einem bestimmten Definitionsmodell aus
Grenzen bestimmen oder aufheben.
13Yousefi: Iran und die Achse des Bösen
Die Bestimmung von Toleranzgrenzen ist ein Prozeß mit vielen Dimensionen. Es
ist eine berechtigte Frage, ob hinter plötzlich auftauchenden Toleranzfragen
Verteilungskonflikte stehen.
Die Festlegung von verschiebbaren Grenzen der Toleranz zeigt sich in der Arbeit
der Vereinten Nationen und des Weltsicherheitsrats. Diese Gremien bestimmen,
wann ein Staat die Interessen anderer Staaten zu verletzen droht und dieses
Verhalten nicht gebilligt werden kann. Der Umsetzung eines solchen Diskurses steht
allerdings noch immer entgegen, dass die ständigen Mitglieder des
Weltsicherheitsrats aufgrund ihrer Vetorechte stets strategisch handeln. Schon
Jaspers hatte gegen das Vetorecht protestiert und die Zusammensetzung des
Weltsicherheitsrats als ein absurdes Theater zurückgewiesen.
»Die UNO ist wie eine Bühne«, sagt Jaspers, »auf der ein unverbindliches Spiel
eingeschaltet ist zwischen die realen Aktionen der Großmächte. Sie stellt die
Scheinkommunikation dar. [...] Die Großmächte benutzen diese Bühne, um sich ein
Gesicht für die Weltöffentlichkeit zu geben und den Gegner durch dieses Spiel zu
überlisten. Das Ganze ist ein Schleier, hinter dem jeder tut, was er will, wenn seine
Gewalt und die Chance der Situation es ihm gestatten. «
Die Stellung nicht-westlicher Staaten, der Umgang mit Israels Politik in diesen
Gremien und der Atomstreit mit dem Iran sind Beispiele dieses strategischen
Handelns.
Ich fasse zusammen:
Dialoge scheitern, wenn Macht zum Argument wird und alles ex cathedra
diktieren will: Von der Bestimmung der Wirtschaft bis hin zur Rahmenbedingung
der Politik. Hier zeigt sich ein Macht-Zentrum, das zwangsläufig eine Ohnmacht-
Peripherie bedingt.
Der Weg zum Frieden führt also über multilaterale Konfliktlösungen, was soviel
bedeutet wie Transformation von Strukturen: Die Ersetzung der Gewalt und
Einschüchterungskultur durch eine Friedenskultur, die einen Dialog auf gleicher
Augenhöhe ermöglicht. Der Ausdruck ›Achse des Bösen‹ ist schillernd. Es ist ein
gefährlicher Irrtum, die Achse des Bösen fast essentialistisch, kulturell, religiös oder
geographisch dingfest machen zu wollen.
14Yousefi: Iran und die Achse des Bösen
Dr. Hamid Reza Yousefi
Universität Trier
Universitätsring 15
D-54296 Trier
Fachbereich I – Philosophie
yous1201@uni-trier.de
http://www.yousefi-interkulturell.de
http://www.bautz.de/interkulturell.shtml
http://www.bautz.de/bausteine.html
15Sie können auch lesen