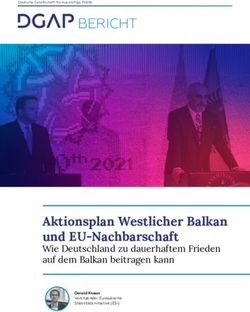Kompakt Hörstörungen - Österreichische Ärztezeitung
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Inhalt
Einleitung und Definition _ Seite 3
Einteilung der Schwerhörigkeit_ Seite 4
Ursachen der Schallempfindungs-
schwerhörigkeit _ Seite 6
Risikofaktoren für
Hörstörungen bei Kindern _ Seite 6
Einteilung der Schwerhörigkeit
nach dem Schweregrad_ Seite 7
Audiologische Diagnostik_ Seite 8
Therapie _ Seite 9
Indikation für ein Hörgerät _ Seite 10
Indikation für ein implantierbares Hörgerät _ Seite 10
Prinzip von implantierbaren Hörsystemen _ Seite 11
Beispiel Cochlea-Implantat _ Seite 12
Wissen kompakt _ Seite 15
2kompakt
EINLEITUNG
Weltweit sind rund 500 Millionen Men- men, viral oder genetisch bedingt sind
schen von Schwerhörigkeit betroffen; bei sowie stoffwechselinduzierte Hörschä-
den über 65-Jährigen ist es jeder zweite. den im Vordergrund. Bei Erwachsenen
Mehr als 32 Millionen davon sind Kinder. steht die Wiederherstellung des Gehörs
In Österreich werden ein bis zwei von 1.000 im Mittelpunkt.
Kindern mit einer relevanten Hörschädi-
gung geboren; bei Frühgeborenen ist die
DEFINITION
Rate deutlich höher.
Je nach der betroffenen Region unterschei-
Im Kindesalter liegt laut WHO eine Hör- det man zwischen Schallleitungsschwer-
störung dann vor, wenn der Hörverlust hörigkeit (äußeres Ohr und Mittelohr)
auf dem besser hörenden Ohr mehr als und Schallempfindungsschwerhörigkeit
30 Dezibel beträgt. Bei Kindern mit per- (Innenohr und/oder Hörnervenschädi-
manenten Hörschäden geht es darum, die gung) unterschiedlichen Schweregrades
Hörentwicklung zu gewährleisten, damit (= periphere Hörstörungen). Bei der Schall-
der Spracherwerb möglich ist. Bei Erwach- verarbeitungsstörung (neurale oder zent-
senen stehen die Schwerhörigkeit im Alter, rale Störung) sind Hörnerv oder Hörbahn
die lärmbedingten Hörschäden und die beziehungsweise Hörrinde betroffen.
Hörschäden, die durch Schädel-Hirn-Trau-
3HÖRSTÖRUNGEN
Schallleitungsschwerhörigkeit Schallempfindungsstörungen sind mit
Ausnahme der im Kindesalter seltenen
Eine Schallleitungsschwerhörigkeit ent- Hörstürze permanente Hörstörungen, die
steht in Folge einer Störung der Schall- progredient verlaufen können. Bei klei-
übertragung zwischen äußerem Gehör- neren Kindern sind Schallempfindungs-
gang und/oder dem Mittelohr. Diese schwerhörigkeiten meist beidseits und
passagere ein- oder beidseitige Schwer- genetisch bedingt – besonders bei Früh-
hörigkeit stellt die größte Gruppe der geborenen.
kindlichen Schwerhörigkeit dar. Zwischen
dem ersten und dem dritten Lebensjahr Von einer kombinierten Schwerhörigkeit
entwickeln zehn bis 30 Prozent der Kin- spricht man, wenn eine Kombination von
der einen Paukenerguss mit einer daraus Schallleitungsschwerhörigkeit und Schall-
resultierenden passageren Schallleitungs- empfindungsschwerhörigkeit vorliegt.
störung.
Schallverarbeitungsschwerhörigkeit
Permanente Schallleitungsstörungen – als
Folge von angeborenen oder erworbenen Zur Schallverarbeitungsschwerhörigkeit
Defekten der schallübertragenden Struk- zählen die neurale Schwerhörigkeit, die
turen im Gehörgang oder Mittelohr und durch eine Störung der Hörnervenfunk-
die Tympanosklerose – sind bei Kindern tion hervorgerufen wird sowie die zentrale
seltener. Schwerhörigkeit durch eine Störung der
Funktion der Hörbahn beziehungsweise
Schallempfindungsschwerhörigkeit der Hörrinde.
Bei der Schallempfindungsschwerhörig- Die auditive Verarbeitungs- und Wahr-
keit ist die Schallaufnahme oder die Schall- nehmungsstörung, eine Form der Schall-
verarbeitung im Innenohr vermindert verarbeitungsschwerhörigkeit, ist vor
– bedingt durch eine Schädigung oder allem im Schulalter relevant. Sie liegt
unzureichende Funktion der Cochlea. Die vor bei einem unauffälligen Tonschwel-
Funktion des Corti-Organs, Träger der lenaudiogramm, aber dennoch zent-
Sinneszellen im Innenohr, ist bei allen For- rale Prozesse des Hörens gestört sind
men der Schallempfindungsschwerhörig- (= Informationsverarbeitugsstörung). Die
keit gestört; am häufigsten sind die äuße- betroffenen Kinder haben Schwierigkei-
ren Haarzellen betroffen. ten bei der Lautdiskrimination, dem Ver-
4kompakt
Tab. 1: Schallleitungsschwerhörigkeit
Ursache Mögliche Diagnosen u.a. Audiologische Diagnostik
Störung der Schallübertragung akut • Stimmgabeltest
im äußeren Gehörgang und/ • Cerumen obturans • Flüstertest
oder Mittelohr • Tubenkatarrh • Hörweitenbestimmung
• Paukenerguss • Reintonaudiogramm
• Traumatische • Impedanzaudiometrie
Trommelfellperforation
• Akute Otitis media/Otitis
externa
permanent
• Gehörgangsstenose/
-Atresie
• Trommelfell- oder Ketten-
defekt
• Cholesteatom
• Missbildung
• Otosklerose
• Tympanosklerose
Tab. 2: Schallempfindungsschwerhörigkeit
Ursache Mögliche Diagnosen u.a. Audiologische Diagnostik
Verminderte Schallaufnahme akut • Stimmgabeltest
oder Schallverarbeitung im • Idiopathischer Hörsturz • Flüstertest
Innenohr - bedingt durch • Akutes Lärmtrauma • Hörweitenbestimmung
Schädigung oder unzurei- • Bakterielle/virale Labyrinthitis • Reintonaudiogramm
chende Funktion der Cochlea; • Sprachaudiogramm
häufig sind die äußeren hereditär/permanent • Otoakustische Emissionen
Haarzellen betroffen (Abfall
• Heriditäre Schwerhörigkeit
der Knochenleitungsschwelle,
• Presbyakusis
Verlust der nichtlinearen
• Lärmschwerhörigkeit
Verstärkung (Recruitment-
• Medikamentös-toxische
phänomen) und der einge-
Schwerhörigkeit
schränkten Frequenzselektivi-
• Idiopathisch-chronisch
tät (Verzerrungen)
progrediente Schwerhörigkeit
5HÖRSTÖRUNGEN
Tab. 3: Ursachen der Schallempfindungsschwerhörigkeit
Erworben -infektiös: perinatal oder postnatal: Meningitis, Masern, Mumps …
-geburtstraumatisch: Schädeltrauma, intrakranielle Blutung …
-ototoxisch: Sucht- und Genussmittel wie Alkohol, Medikamente(Aminoglykoside,
Zytostatika, Diuretika …), gewerbliche Stoffe (Schwermetalle, Lösungsmittel …) etc.
-metabolisch: Asphyxie …
Genetisch bedingt
Häufigkeit
• genetisch bedingt: bis 70 Prozent*
• pränatal erworben: bis 10 Prozent*
• perinatal erworben: bis 20 Prozent*
• postnatal erworben: bis 15 Prozent*
• Ursache unbekannt: bis zu 30 Prozent*
*je nach Studie
Tab. 4: Risikofaktoren für Hörstörungen bei Kindern*
• Familiäre Hörstörungen
• Intensivstation >48h Beatmung
• Frühgeborenekompakt
stehen von akustischen Signalen sowie und bei 61 bis 80 Dezibel um eine hoch-
der Schalllokalisation und Schalllaterali- gradige Schwerhörigkeit (Grad 3). Bei
sation von auditiven Stimuli. einem Verlust von 81 Dezibel spricht man
von Restgehör – etwa wenn die Hörwahr-
nehmung für sehr tief frequente Signale
EINTEILUNG NACH
nach wie vor besteht.
SCHWEREGRAD
Klinisch erfolgt die Einteilung von Hörstö-
HÖR-SCREENING
rungen bei Erwachsenen anhand des Rein-
ton-Audiogramms und bezieht sich auf In Österreich ist seit 2003 im Mutter-Kind-
den mittleren Hörverlust im Hauptsprach- Pass ein generelles Neugeborenen-Scree-
bereich. Bei einem mittleren Hörverlust ning vorgesehen. Dieses nicht invasive und
von 26 bis 40 Dezibel handelt es sich laut schmerzlose Screening soll in der ersten
WHO um eine geringgradige Schwerhörig- Lebenswoche erfolgen. Dabei werden die
keit (Grad 1), bei 41 bis 60 Dezibel um eine otoakustischen Emissionen und die Hirn-
mittelgradige Schwerhörigkeit (Grad 2) stammpotentiale gemessen.
Tab. 5: Schwerhörigkeit: Einteilung nach Schweregrad (Erwachsene)
Mittlerer Hörverlust
Grad der
im Reintonaudio- Empfehlung
Schwerhörigkeit
gramm
Beratung, Verlaufskontrolle bei Schallleitungs-
0 – normalhörig 25 dB oder besser
schwerhörigkeit: OP-Indikation prüfen
Beratung, Hörgerät gegebenenfalls empfehlens-
1 – geringgradige wert bei Schallleitungsschwerhörigkeit oder
26 bis 40 dB
Schwerhörigkeit kombinierter Schwerhörigkeit; gegebenenfalls
operative Versorgung
Hörgerät empfohlen bei Schallleitungsschwer-
2 – mittelgradige
41 bis 60 dB hörigkeit oder kombinierter Schwerhörigkeit;
Schwerhörigkeit
gegebenenfalls operative Versorgung
Hörgerät nötig, falls keine Hörgerät-Versorgung
3 – hochgradige möglich: Prüfung, ob andere Hörsysteme (implan-
61 bis 80 dB
Schwerhörigkeit tierbares Hörgerät, Cochlea-Implantat) möglich
sind.
Hörgeräte-Trageversuch; bei Scheitern in der Regel
4 – Hörreste oder
81 dB oder mehr Indikation für Cochlea-Implantat, gegebenenfalls
Taubheit
auch Hirnstammimplantat-Versorgung
7HÖRSTÖRUNGEN
Ist die Diagnose „Hörstörung“ gesichert,
sollten so rasch wie möglich und alters-
angepasst hörverbessernde und entwick-
lungsfördernde Maßnahmen ergriffen
werden. Ziel ist eine erfolgreiche Kom-
munikationsfähigkeit mithilfe von Laut-
sprache und ein offenes Sprachverstehen
bis hin zu altersgerechten Sprachleistun-
gen.
DIAGNOSTIK
Die audiologische Diagnostik hängt von
der klinischen Fragestellung sowie vom
Entwicklungsalter des Kindes ab. Subjek-
tive Methoden untersuchen die Gesamt-
funktion des Gehörs (Reflexaudiometrie,
Reaktionsaudiometrie etc.); dabei ist die
aktive Kooperation des Kindes erforder-
lich. Bei objektiven Methoden werden
Teilfunktionen des Gehörs untersucht;
die passive Kooperation des Kindes ist er-
forderlich. Damit sollen Art und Ausmaß
Tab. 6: Audiologische Diagnostik
Schallleitungs- Schallempfindungs- Neurale Zentrale
schwerhörigkeit schwerhörigkeit Schwerhörigkeit Schwerhörigkeit
• Stimmgabeltest • Stimmgabeltest • Reintonaudiogramm • Hörweiten-
• Flüstertest • Flüstertest • Sprachaudiogramm bestimmung
• Hörweiten- • Hörweiten- • Überschwellige • Reintonaudiogramm
bestimmung bestimmung Testverfahren • Sprachaudiogramm
• Reintonaudiogramm • Reintonaudiogramm • Hörermüdungstests • Überschwellige
• Impedanzaudio- • Sprachaudiogramm • Elektrische Response- Testverfahren
metrie • Otoakustische Emis- Audiometrie • Hörermüdungstest
sionen • Elektrische Response-
Audiometrie
8kompakt
der Hörstörung festgestellt werden – be- Man unterscheidet
sonders dann, wenn subjektive Hörprüf- • konservative Therapieverfahren: Gehör-
verfahren aufgrund des Entwicklungsalter gangsreinigung/Fremdkörperentfer-
des Kindes keine ausreichende diagnos- nung, Ventilationssysteme mit Nasen-
tische Sicherheit bieten. Zum Einsatz kom- ballon
men Impedanzaudiometrie, die Messung • operative Therapieverfahren: Paracen-
von otoakustischen Emissionen sowie die tese, Paukenröhrchen (plus Adenotomie
Hirnstammaudiometrie. und Tonsillektomie), Tympanoplastik,
Stapesplastik, Gehörgangsplastik, Kno-
chenverankerte Hörgeräte
THERAPIE
• apparative Therapieverfahren: Kno-
Je nach vorliegender Hörstörung und de- chenleitungshörgeräte, Luftleitungs-
ren Schweregrad stehen zunächst medi- hörgeräte
zinische Behandlungen oder chirurgi-
sche Interventionen im Vordergrund. So Therapie der Schall-
können etwa zahlreiche Ursachen einer empfindungsschwerhörigkeit
Schallleitungsschwerhörigkeit operativ
korrigiert werden. Hingegen ist bei der Bei einer akut aufgetretenen Schallempfin-
Schallempfindungsschwerhörigkeit ledig- dungsschwerhörigkeit und bei akuter Ver-
lich eine apparative Versorgung möglich. schlechterung der Hörleistung bei einem
Kann bei einer permanenten Hörstörung schon zuvor bestehenden Hörverlust geht
die Ursache nicht behoben werden, stellt es zunächst darum, mögliche spezifische
die Anpassung von Hörgeräten oder die Ursachen zu ermitteln – wie zum Beispiel
Versorgung mit einem Cochlea-Implantat CMV-Infektionen, ototoxische Substanzen,
die wichtigste therapeutische Maßnahme
dar.
Therapie der
Schalleitungsschwerhörigkeit
Die Auswahl der Therapie hängt von der
der Ursache, der Dauer, dem Ausmaß der
Störung und allfälligen Komorbiditäten
wie etwa Lippen-, Kiefer-, Gaumenspalten,
Trisomie 21, Operationsfähigkeit, Otitis ex-
terna, chronische Otitis media, Sprachent-
wicklungsverzögerung ab.
9HÖRSTÖRUNGEN
Perlymph-Fistel, erweiterter Aquäductus und 4.000 Hertz. Sprachaudiometrisch
endolymphaticus, Borreliose. Falls mög- muss die Verstehensquote bei Verwen-
lich soll eine gezielte Therapie erfolgen. dung des Freiburger Einsilbentests auf
dem schlechteren Ohr mit Kopfhörern bei
Liegt eine beidseitige persistierende 65 Dezibel nicht mehr als 80 Prozent be-
Schallempfindungsschwerhörigkeit vor, tragen.
soll unverzüglich die Versorgung mit Hör-
geräten – in der Regel mit zwei Hinter- Voraussetzung für eine beidseitige Hör-
dem-Ohr-Geräten – erfolgen, um die Hör- geräteversorgung ist ein Hörverlust von
bahnreifung in den kritischen Phasen der mindestens 30 Dezibel auf dem besseren
Hör-Sprach-Entwicklung zu stimulieren. Ohr im Tonschwellenaudiogramm in min-
destens einer Frequenz zwischen 500 und
Indikation für ein Hörgerät 4.000 Hertz. Sprachaudiometrisch beträgt
die Verstehensquote bei Verwendung des
Voraussetzung für die Hörgeräteversor- Freiburger Einsilbentests auf dem bes-
gung eines Ohres ist ein tonaudiome- seren Ohr mit Kopfhörern bei 65 Dezibel
trischer Hörverlust von mindestens 30 nicht mehr als 80 Prozent.
Dezibel auf dem schlechteren Ohr im
Tonschwellenaudiogramm in mindestens Indikation für ein
einer der Prüffrequenzen zwischen 500 implantierbares Hörgerät
Eine Indikation für ein implantierbares Hör-
gerät besteht in der Regel dann, wenn aus
medizinischen oder audiologischen Gründen
eine Versorgung mit einem konventionellen
Hörgerät nicht möglich ist. Jeder Implantation
geht ein dokumentierter Trageversuch eines
konventionellen Hörgeräts voraus.
Für die Implantation gelten – im Vergleich
zu konventionellen Hörgeräten bei der
Schallempfindungsschwerhörigkeit – u.a.
Kriterien, die das dauerhafte Tragen eines
Hörgeräts verhindern wie zum Beispiel eine
chronische Otitis externa, Juckreiz und Ge-
hörgangsekzeme oder wenn mit konven-
tionellen Hörgeräten eine Hörminderung
nicht ausreichend versorgt werden kann.
10kompakt
Die Wahl des geeigneten Implantatsystems Signalabgabe erfolgt durch mechanische
hängt ab vom Alter des Patienten sowie Schwingungen. Implantierbare Hörsyste-
von audiologischen und anatomischen me bestehen aus folgenden fünf Kompo-
Kriterien. nenten: Signalaufnahme, Signalverarbei-
tung, Signalübertragung, Signalabgabe und
Bei Schallleitungsschwerhörigkeit und Energieversorgung. Die Systeme unter-
kombinierter Schwerhörigkeit (Malforma- scheiden sich in der Anordnung dieser
tionen, St. p. Mittelohr- und Schläfenbein- Komponenten, ihrer Implantierbarkeit und
chirurgie, sklerosierende Mittelohrerkran- der technologischen Umsetzung.
kungen) kann durch ein implantierbares
Hörsystem eine verbesserte Sprachdis- Nach der Lokalisation unterscheidet man
krimination erwartet werden. Bei einer er- aktive Mittelohrimplantate (Signalabgabe
worbenen Schallleitungsschwerhörigkeit erfolgt im Mittelohr, wo der Signalwandler
sollten die konventionell-chirurgischen an die intakte Gehörknöchelchenkette ge-
Möglichkeiten der Mittelohr-Rekonstruk- koppelt wird), Knochenleitungsimplantate
tion ausschöpft sein. (Signal geht an den Schädelknochen, der
die mechanischen Schwingungen auf das
Prinzip von Innenohr überträgt), Cochlea-Implantat
implantierbaren Hörsystemen (elektrische Reizung des Hörnervs) und
das auditorische Hirnstammimplantat
Alle implantierbaren Hörsysteme sind (stimuliert akustisch relevante Areale des
akustisch-mechanische Wandler: Die Hirnstamms).
11HÖRSTÖRUNGEN
BEISPIEL
COCHLEA-IMPLANTAT
Cochlea-Implantate umgehen
die normalen Transduktions-
mechanismen des peripheren
Hörsystems und stimulieren den
Hörnerv direkt. Ein Mikrophon
empfängt die Signale, die im Pro-
zessor verarbeitet und in elek-
trische Impulse übersetzt und
drahtlos transkutan zum Implantat
gesendet werden. Das Cochlea-Im-
plantat selbst wird hinter dem Ohr in
einem Knochenbett verankert, die Elek-
troden in die Cochlea vorgeschoben.
Das Implantat decodiert die Signale, die
Elektroden in der Hörschnecke stimulie- Fälle – zu einem Verlust des Hörvermö-
ren dort den Hörnerv. Diese Reize werden gens kommen; häufig in Kombination mit
– wie beim gesunden Hören – zur weite- einer cochleären Ossifikation. Hier sollte
ren Verarbeitung an das Gehirn weiter- die Indikation rasch geprüft sowie eine
geleitet. audiologische und neuroradiologische
Diagnostik erfolgen.
Cochlea-Implantat bei Kindern
Bei angeborener hochgradiger, an Taub- Cochlea-Implantat bei Erwachsenen
heit grenzender Schwerhörigkeit oder Ge- Bei Erwachsenen ist es therapeutisches
hörlosigkeit ist es therapeutisches Ziel, mit Ziel, das Gehör wiederherzustellen, wenn
einem Cochlea-Implantat die Hörentwick- mit konventionellen Hörgeräten, Kno-
lung zu ermöglichen und die Vorausset- chenleitungshörgeräten oder implantier-
zung für einen hörgerichteten Lautsprach- baren Hörgeräten kein für die lautsprach-
erwerb zu schaffen. Der Eingriff kann ab liche Kommunikation ausreichendes
dem sechsten Lebensmonat erfolgen. Bei Hören erzielt werden kann.
einer erworbenen hochgradigen Schwer-
hörigkeit oder Gehörlosigkeit sollte die Indikationen
Implantation so früh wie möglich erfolgen. Bei einer Hörstörung wird die Indikation für
ein Cochlea-Implantat für jedes Ohr getrennt
Nach einer bakteriellen Meningitis kann ermittelt. Bei seitengleichem Gehör sollte,
es – je nach Studie in bis zu 50 Prozent der wenn auf beiden Seiten die Kriterien für eine
12kompakt
Versorgung mit einem Cochlea-Implantat er- sorge. Diese umfasst die medizinische und
füllt werden, bei Kindern eine simultane bila- technische Kontrolle und Beratung sowie
terale Implantation angestrebt werden. die Überprüfung der Hör-, Sprech- und
Sprachleistung.
Kontraindikationen
Absolute Kontraindikationen für die Ver- Zwischen dem ersten Tag postoperativ bis
sorgung mit einem Cochlea-Implantat zu sechs Wochen postoperativ beginnt die
sind eine Aplasie der Cochlea oder des Basistherapie. Die anschließende Cochlea-
Hörnervs, zentrale Taubheit mit Funk- Implantat-Rehabilitation benötigt bei
tionsstörungen im Bereich der zentralen Erwachsenen in der Regel 40 Behand-
Hörbahnen. Weiters zählen dazu auch lungstage und ist über einen Zeitraum von
strukturelle Hindernisse (kein Zugang zur sechs bis 24 Monaten notwendig.
Erstanpassung, Rehabilitation oder Nach-
sorge) oder Hindernisse von Seiten des Bei Kindern kann die Folgetherapie bis
Patienten (nicht fähig, an Basistherapie, zum 18. Lebensjahr andauern und um-
Rehabilitation etc. teilzunehmen). fasst rund 60 Behandlungstage. Die Hör-
Relative Kontraindikationen sind zum Bei- und Sprachrehabilitation erfolgt unter
spiel Mittelohrinfektionen, eine nur einge- Mitarbeit der Eltern und muss an die
schränkte Rehabilitationsfähigkeit, schwere individuellen Voraussetzungen des Kindes
Begleiterkrankungen oder der fehlende angepasst sein.
Nachweis des Hörnervs in der Bildgebung.
Operation
Die Implantation eines Cochlea-Implan-
tats erfolgt in Vollnarkose und dauert ein
bis zwei Stunden. Der Eingriff ist im Hin-
blick auf die Risken mit denen einer Mittel-
ohroperation vergleichbar. Perioperativ
sollte eine liquorgängige Antibiotikapro-
phylaxe erfolgen. Postoperativ beträgt der
stationäre Aufenthalt fünf bis sieben Tage.
Nach der Einheilung erfolgt noch stationär
die Erstanpassung des Sprachprozessors.
Rehabilitation
Die Versorgung mit einem Cochlea-Im-
plantat erfordert eine lebenslange Nach-
13HÖRSTÖRUNGEN
haben die einzelnen Hemisphären
DIE ENTSTEHUNG
unterschiedliche Aufgaben: Die linke
DES HÖRENS
Seite ist für die Unterscheidung der
Bei der Geburt ist das Hören im Gegen- Silben zuständig, die rechte Seite für
satz zum Sehen sehr gut ausgebildet. die Erkennung der Sprachmelodie.
Schon in den ersten Lebensmonaten Wesentliche Voraussetzung für die opti-
nimmt das Neugeborene Geräusche male Hörverarbeitung ist die Zusam-
ganz besonders gut differenziert wahr. menarbeit der beiden Gehirnhälften. Ist
Dabei gibt es eine Wahrnehmungsvor- diese nur ungenügend, kein dominan-
liebe für melodiös gesprochene Sprache tes Ohr ausgeprägt oder wechselt die
im Frequenzbereich von Frauenstim- Lateralität hin und her, wird Gehörtes
men. Schon ab dem fünften Schwanger- verzögert oder nicht in der richtigen
schaftsmonat hört der Fetus recht gut. Reihenfolge wahrgenommen.
So erinnern sich Neugeborene an das
Lautmuster einer Geschichte, die ihnen
DER HÖRVERLUST
während der Schwangerschaft vorge-
UND DIE KOGNITION
lesen wurde.
Ein Hörverlust verändert auch andere
kognitive Leistungen. Schon rund drei
DAS HÖREN
Monate nach dem Beginn einer leichten
VERSTEHEN
Schwerhörigkeit organisiert sich das Ge-
Linkes und rechtes Ohr nehmen nor- hirn neu: Andere Sinne wie der Sehsinn
malerweise Geräusche, Töne oder ge- oder der Tastsinn treten in den Vorder-
sprochene Sprache unterschiedlich grund. Während bei einem hörenden
wahr; sie erreichen das Trommelfell Menschen die Hörrinde ausschließlich
üblicherweise auch zeitlich versetzt. für die Verarbeitung von Höreindrücken
Das trägt unter anderem dazu bei, zuständig ist, kommt es aufgrund der
die Schallquelle zu bestimmen. In der fehlenden akustischen Signale zu einer
Folge muss das Gehirn die Informa- Neuverteilung der Aufgaben im Gehirn.
tionen, die aus beiden Ohren kommen, Dabei werden die frontalen und prä-
zusammenführen. Dabei gelangt der frontalen Bereiche des Gehirns aktiver;
Input vom rechten Ohr zunächst in es sind mehr Anstrengungen für das
die linke Gehirnhälfte, der Input vom Zuhören notwendig, was offensichtlich
linken Ohr in die rechte Gehirnhälf- eine kortikale Ressourcenallokation im
te. Bei der Sprachverarbeitung selbst Gehirn bewirkt.
14kompakt
WISSEN kompakt
• In Österreich werden jährlich ein bis zwei Kinder mit
einer relevanten Hörschädigung geboren.
• Seit 2003 ist im Mutter-Kind-Pass ein generelles Neu-
geborenen-Hörscreening vorgesehen.
• Ist die Diagnose „Hörstörung“ gesichert, sollten so
rasch wie möglich altersangepasst hörverbessernde
Maßnahmen ergriffen werden.
• Bei Kindern mit einer permanenten Hörschädigung soll
die Hörentwicklung den Spracherwerb ermöglichen.
• Bei Erwachsenen steht die Wiederherstellung des Ge-
hörs im Mittelpunkt.
• Je nach Art der vorliegenden Hörstörung und deren
Schweregrad stehen medizinische Behandlungen oder
chirurgische Interventionen im Vordergrund.
• Kann die Ursache einer permanenten Hörstörung nicht
behoben werden, erfolgt die Anpassung eines Hörge-
räts oder die Versorgung mit einem Cochlea-Implantat.
Quelle: State of the Art „Hörstörungen bei Kindern“ - Österreichische Ärztezeitung Nr. 17 vom 10. Sep-
tember 2017; State of the Art „Hörstörungen Update“ – Österreichische Ärztezeitung Nr. 10 vom 25. Mai
2021, Stangl, W. (2022), Stichwort: ‚Hörsinn – Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik‘
IMPRESSUM: Medieninhaber und Verleger: Verlagshaus der Ärzte GmbH, Nibelungengasse 13, A-1010 Wien, www.aerztezeitung.at,
Tel.: +43 (0)1 512 44 86-0 // Chefredaktion: Dr. Agnes M. Mühlgassner, MBA; Redaktionelle Betreuung: Dr. Sophie Fessl// Grafik & Layout: Irene
Danter // Druck: Ferdinand Berger & Söhne GmbH, A-3580 Horn // Allgemeine Hinweise: Die ÖÄZ-Sonderpublikation erhebt inhaltlich keinen
Anspruch auf Vollständigkeit. Der besseren Lesbarkeit halber werden die Personen- und Berufsbezeichnungen nur in einer Form verwendet; sie
sind natürlich gleichwertig auf beide Geschlechter bezogen. // Nachdruck und Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmi-
gung der Verlagshaus der Ärzte GmbH © Cover: SPL, picturedesk.com; Bilder Innenteil: SPL, picturedesk.com
15kompakt
Sie können auch lesen