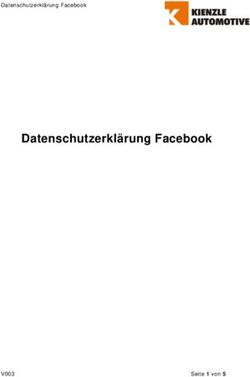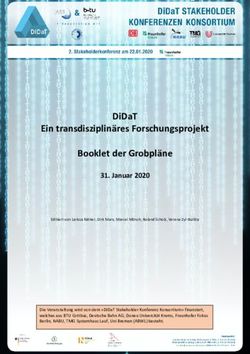KURSBUCH Erziehungswissenschaft Zentralabitur NRW ab 2017 - Goethe-Gymnasium Ibbenbüren
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Kursbuch Erziehungswissenschaft Zentralabitur NRW ab 2017 Georg Bubolz (Hrsg.) Redaktion: Berthold Frinken Umschlaggestaltung: Ulrike Kuhr Umschlagfoto: Georg Bubolz, Erkelenz Layoutkonzept: Wladimir Perlin, Berlin Technische Umsetzung: Rainer Moers, Viersen www.cornelsen.de Die Links zu externen Webseiten Dritter, die in diesem Lehrwerk angegeben sind, wurden vor Drucklegung sorgfältig auf ihre Aktualität geprüft. Der Verlag übernimmt keine Gewähr für die Aktualität und den Inhalt dieser Seiten oder solcher, die mit ihnen verlinkt sind. 1. Auflage, 1. Druck 2015 Alle Drucke dieser Auflage sind inhaltlich unverändert und können im Unterricht nebeneinander verwendet werden. © 2015 Cornelsen Schulverlage GmbH, Berlin Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Nutzung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages. Hinweis zu den §§ 46, 52 a UrhG: Weder das Werk noch seine Teile dürfen ohne eine solche Einwilligung eingescannt und in ein Netzwerk eingestellt oder sonst öffentlich zugänglich gemacht werden. Dies gilt auch für Intranets von Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen. Druck: PHOENIX PRINT GmbH ISBN 978-3-06-065116-0
Übersicht zu inhaltlichen Schwerpunkten im Fach
Erziehungswissenschaft im Zentralabitur NRW ab 2017
Inhaltsfelder mit Konkretisierte Kursbuch Kursbuch
inhaltlichen inhaltliche Schwerpunkte Erziehungs Erziehungs
Schwerpunkten (GK/LK) wissenschaft wissenschaft
(Neuausgabe Zentralabitur NRW
2014) ab 2017
Inhaltsfeld 3: Moralische Entwicklung S. 265–288
Entwicklung, Sozialisation am Beispiel des Just-
und Erziehung: Community-Konzeptes
Interdependenz von im Anschluss an
Entwicklung, Sozialisation L. Kohlberg
und Erziehung
Sozialisation als Rollen S. 290–309
lernen (symbolischer
Interaktionismus)
Entwicklungsaufgaben S. 380–390
des Jugendalters nach
K. Hurrelmann
Bedeutung des Spiels nach S. 342–362 Neu
G. H. Mead und Bedeutung des
G. E. Schäfer (nur LK) Spiels nach George
Herbert Mead
(nur LK)
Inhaltsfeld 3: S. 190–206
Entwicklung, Sozialisation
und Erziehung:
Erziehung in der Familie
Inhaltsfeld 3: S. 363–371
Entwicklung, Sozialisation
und Erziehung:
Erziehung durch Medien
und Medienerziehung
Inhaltsfeld 3: S. 184–189
Entwicklung, Sozialisation
und Erziehung:
Unterschiedliche Verläufe
von Entwicklung und
Sozialisation
3Inhaltsfeld 3: S. 372–379
Entwicklung, Sozialisation S. 432–460
und Erziehung:
Pädagogische
Praxisbezüge unter dem
Aspekt von Entwicklung,
Sozialisation und
Erziehung in Kindheit,
Jugend und Erwachsenen-
alter
Inhaltsfeld 4: Interdependenz von Neu
Identität: Streben nach Interdependenz
Besonderheiten der Autonomie und sozialer von Streben nach
Identitätsentwicklung in Verantwortlichkeit im Autonomie und
Kindheit, Jugend und Modell der produktiven sozialer Verant-
Erwachsenenalter sowie Realitätsverarbeitung wortlichkeit im
deren pädagogische Modell der pro-
Förderung duktiven Realitäts-
verarbeitung
Inhaltsfeld 4: Unzureichende Identitäts- S. 225–244 Neu
Identität: entwicklung am Beispiel S. 416–431 Identitätsdiffusion
Anthropologische Grund- von deviantem Verhalten in sozialen Netz-
annahmen zur Identität und der Gefahr von werken (Web 2.0;
und ihre Auswirkungen Identitätsdiffusion auch in Web 3.0; …)?
auf pädagogisches Denken sozialen Netzwerken
und Handeln (Web 2.0; Web 3.0; …)
Inhaltsfeld 4: Möglichkeiten und Gren- S. 310–323 Neu
Identität: zen persönlicher Lebens- Möglichkeiten
Identität und Bildung gestaltung mit Blick auf und Grenzen
Bildung und Beruf (nur persönlicher
LK) Lebensgestaltung
mit Blick auf
Bildung und Beruf
(nur LK)
Inhaltsfeld 5: S. 463–499
Werte, Normen und Ziele
in Erziehung
und Bildung:
Historische und kulturelle
Bedingtheit von Erzie-
hungs- und Bildungspro-
zessen
4Inhaltsfeld 5: Erziehungsziele und S. 569–571 Neu
Werte, Normen und Ziele -praxis in beiden Erziehungsziele
in Erziehung und Bildung: deutschen Staaten von und -praxis in
Erziehung in verschiede- 1949–1989 beiden deutschen
nen historischen und Staaten von
gesellschaftlichen 1949–1989
Kontexten
Montessoripädagogik als S. 327–341
ein reformpädagogisches
Konzept
Inhaltsfeld 5: S. 580–607
Werte, Normen und Ziele
in Erziehung und Bildung:
Interkulturelle Bildung
Inhaltsfeld 6: Funktionen von Schule S. 609–617 Neu
Pädagogische Professiona- nach H. Fend Funktionen von
lisierung in verschiedenen Schule nach
Institutionen: Helmut Fend
Institutionalisierung von
Erziehung
Einbindung in Institutio- S. 618–620
nen am Beispiel von
Vorschuleinrichtungen
Inhaltsfeld 6: S. 621–622
Pädagogische Professiona-
lisierung in verschiedenen
Institutionen:
Vielfalt und Wandelbar-
keit pädagogischer
Berufsfelder
Erklärung:
Rot gekennzeichnete Schwerpunkte gelten für GK und LK,
blau gekennzeichnete Schwerpunkte gelten nur für LK.
Zur weiteren methodischen und inhaltlichen Vorbereitung der Abiturprüfung wird auf das
KURSBUCH Erziehungswissenschaft (Neuausgabe 2014), S. 630–687 und S. 688–715 verwiesen.
5Inhaltsverzeichnis
1. Bedeutung des Spiels nach George Herbert Mead (nur LK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.1 Hinführung: Erich Kästner, Pädagogik spaßeshalber
(Ein altes Kinderspiel, renoviert) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2 Grundzüge der Theorie George Herbert Meads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.3 Der Mensch und seine Rollen im Alltag – Spiel als Paradigma in den
Geistes- und Sozialwissenschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2. Interdependenz von Streben nach Autonomie und sozialer Verantwortlichkeit im
Modell der produktiven Realitätsverarbeitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.1 Hinführung: Jorge Bucay, Der angekettete Elefant – Eine pädagogische Parabel . . . . . . . . . 19
2.2 Das Modell der produktiven Realitätsverarbeitung nach Klaus Hurrelmann . . . . . . . . . . . . . 20
2.3 Die Interdependenz von Streben nach Autonomie und sozialer Verantwortlichkeit . . . . . . 21
2.3.1 Die Ablösung von den Eltern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.3.2 Zwischen Freisetzung und Selbstverantwortung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3. Identitätsdiffusion in sozialen Netzwerken (Web 2.0; Web 3.0; …)? . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.1 Hinführung: Die „Ware Freund“ und „wahre Freunde “ im Social Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.2 Konkurrierende Positionen zu möglicher Identitätsdiffusion in sozialen Netzwerken
(Web 2.0; Web 3.0; …)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.2.1 Chancen der Identitätsbildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.2.2 Risiken von Identitätsdiffusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.2.3 Zur pädagogischen Relevanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.2.4 Faszination Social Web: (Un)sichtbare Gefahr oder Gewinn für die soziale Interaktion
zwischen Jugendlichen? – Interdisziplinäre Überlegungen. Thesen zur Diskussion und
Auseinandersetzung (Verena Herber) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4. Möglichkeiten und Grenzen persönlicher Lebensgestaltung mit
Blick auf Bildung und Beruf (nur LK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4.1 Hinführung: Jorge Bucay, In Kürze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.2 Identität im Hinblick auf Bildung, Arbeit und Beruf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.3 Identität und Bildung – Perspektiven aus der Geschichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
65. Erziehungsziele und -praxis in beiden deutschen Staaten von 1949–1989 . . . . . . . . . . 46
5.1 Hinführung: Christa Wolf, Der geteilte Himmel – Aus einer Erzählung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
5.2 Erziehungsziele und Erziehungspraxis in der
Bundesrepublik Deutschland (1949–1989) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
5.2.1 Politische Vorgaben: Grundgesetz und Verfassung für NRW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
5.2.2 Die politischen Parteien zu Fragen der Erziehung in der Familie um 1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
5.2.3 Entwicklungslinien: Erziehung und Bildung in der BRD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
5.3 Erziehungsziele und Erziehungspraxis in der DDR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
5.3.1 Politische Vorgaben: Das Familiengesetzbuch der
Deutschen Demokratischen Republik – ein Beispiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
5.3.2 Statt Parteienpluralität: Vorrang der Sozialistischen Einheitspartei
Deutschlands (SED) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
5.3.3 Entwicklungslinien: Erziehung und Bildung in der DDR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
5.4 Zum Systemvergleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
5.4.1 Ludwig Liegle, Erziehung zur Anpassung? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
5.4.2 Bildungssysteme im Kontext unterschiedlicher politischer Rahmenbedingungen . . . . . . . . . . 66
6. Funktionen von Schule nach Helmut Fend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
6.1 Hinführung: Daniel Pennac, Schulkummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
6.2 Gesellschaftliche und individuelle Funktionen des Bildungswesens in der Moderne . . . . . 70
6.3 Leitideen zur Gestaltung funktionaler Beziehungen zwischen
Schulsystem und Gesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
7. Glossar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
71. Bedeutung des Spiels nach
George Herbert Mead (nur LK)
(Foto: Georg Bubolz, Erkelenz)
„Spiel ist nicht Spielerei, es hat hohen Ernst
und tiefe Bedeutung.“
Friedrich Fröbel
81.1 Hinführung: Erich Kästner, Pädagogik spaßeshalber
(Ein altes Kinderspiel, renoviert)
Erich Kästner, 1899 in Dresden geboren, hat seine Schriftsteller. Von 1933 an wurden verschiedene
ersten Gedichte bereits in der Schülerzeitung des seiner Arbeiten durch die Nationalsozialisten
Gymnasiums veröffentlicht. 1918 absolvierte er verboten. Er wurde wiederholt verhaftet, aber
das Strehlener Lehrerseminar. Er studierte weiter immer wieder freigelassen. Trotz späterem
in Leipzig – später auch in Rostock und Berlin – völligem Schreibverbot emigrierte er nicht. 1974
die Fächer Germanistik, Geschichte, Philosophie starb Erich Kästner im Alter von 75 Jahren in
und Theatergeschichte und arbeitete als freier München.
Das größte Kind muss an die Tafel schreiben.
Und dauernd ernst sein. Und den Lehrer machen.
Die andern Kinder dürfen Kinder bleiben.
Und sollen nur, wenn er’s verbietet, lachen.
5 Dann gibt das große Kind zunächst den Kleinen
ein schwieriges Diktat. Mit Das und Dass.
Die Mädchen müssen, wenn sie können, weinen.
Sonst machen sie die Hefte anders nass.
Dann folgt ein Ausflug. Über Perserbrücken.
10 Rund um den Tisch. Mit Rucksack und Gesang.
Und in den Vasen kann man Blumen pflücken.
Und wandert dreißigmal die Wand entlang.
Die Teppiche sind selbstverständlich Wiesen.
Hier wird gefrühstückt; und hier ruht man aus,
15 indes im Bad die Wasserfälle fließen.
Dann wandert man, rund um den Tisch, nach Haus.
Am schönsten ist natürlich das Examen.
Da hat der Lehrer einen Gehrock an
und fragt nach Wilhelm Tell und Städtenamen.
20 Und ob der Artur wohl den Handstand kann.
Dann gibt’s Zensuren. Karl und Gustav schwitzen.
Doch Gustav blieb in diesem Jahr verschont.
Nur Karl der Faule bleibt schon wieder sitzen.
Und sagt ganz laut: „Das bin ich nun gewohnt.“
25 Und dann sind Ferien. Und alle lachen. 1 Interpretieren Sie das Gedicht u. a.
Das große Kind zieht flugs den Gehrock aus unter der Fragestellung, wie bestimm-
und hängt ihn in den Schrank, zu Vaters Sachen. te Rollen gelernt und Positionen,
Denn: Vater kommt um diese Zeit nach Haus. Einstellungen und Verhaltenserwar-
(Erich Kästner, Gesammelte Schriften für Erwachsene, Band tungen erworben werden.
1: Gedichte, Droemer Knauer, München/Zürich 1969, S. 2 Erörtern Sie, welche Bedeutung dem
140; © Atrium Verlag, Zürich 1969) Spiel dabei zukommt.
9 1. Bedeutung des Spiels nach
George Herbert Mead (nur LK)1.2 Grundzüge der Theorie George Herbert Meads
Hein Retter, geboren 1937 in Berlin, war bis zu gen, um innerhalb eines gemeinsamen Sinnho-
seiner Emeritierung Professor am „Institut für rizontes der Interaktionspartner dem Gesche-
allgemeine Pädagogik und technische Bildung“ 40 hen neue, überraschende Wendungen zu
der technischen Universität Braunschweig – Ab- verleihen.
teilung Historisch-Systematische Pädagogik. Er Die Ungewissheit des Ausgangs unseres Han-
referiert zur Bedeutung des Spiels aus der Sicht delns und die Einsicht, dass unser Tun auch von
des symbolischen Interaktionismus nach George anderen, von uns nicht steuerbaren Einflussgrö-
Herbert Mead. 45 ßen abhängt, verleihen Begriffen wie „Erwar-
tung“ und „Hoffnung“ überhaupt erst ihren
Unter sozialem Aspekt ist Spiel ein Vorgang der besonderen Sinn. So lassen sich Zusammen-
Interaktion. Das Spiel mit anderen Personen hang und Differenz zwischen Spiel und Alltags-
(Spielpartnern) hängt eng mit der Entwicklung kommunikation auf folgenden Nenner bringen:
sozialer Grundfertigkeiten zusammen. Was 50 Im Alltag leben wir unser Leben gleichsam
5 sind solche sozialen Grundfertigkeiten? Im scheibchenweise in „Fortsetzungen“, d. h. in
Spiel, insbesondere im Rollenspiel, nehmen die aneinandergereihten Sinn- bzw. Zeitsegmenten.
Kinder verschiedene Rollen ein, die nicht streng Im Spiel setzen wir demgegenüber immer
festgelegt sind, aber auch nicht völlig frei sind: wieder neu an. Der Satz „Neues Spiel – neues
d. h. sie bieten Balancen zwischen Rollenfixie- 55 Glück“, reicht in seiner Bedeutung weit über das
10 rung und Rollengestaltung. Im Spiel lernen Glücksspiel hinaus und meint: Neue Erwar-
Kinder, tung – neuer Konflikt – neue Spannung bis zum
• Wünsche zu artikulieren (Bedürfnisreprä- Ende.
sentation); Das Spiel bietet mannigfache Erfahrungen
• unterschiedlich-diskrepante Rollenvorstel- 60 sozialen Lernens. In diesem Prozess bildet sich
15 lungen miteinander zu integrieren (Ambi- allmählich die Identität des Kindes aus, die man
guitätstoleranz); auch als den Kern der Persönlichkeit bezeich-
• die Erwartungen anderer mit den eigenen nen kann. Von der Theorie des Symbolischen
Interessen abzuwägen (Empathie, gleichzei- Interaktionismus (G.H. Mead) wissen wir, dass
tiger Erwerb von sozialer und personaler 65 die Identität als ein Balanceverhältnis zwischen
20 Identität; erst durch das Kennenlernen des zwei Momenten zu deuten ist: Das eine Mo-
anderen gelingt die eigene personale Identi- ment rekrutiert sich aus den Erwartungen der
tät); sozialen Umwelt, die als Verhaltensnormen an
• Situationen mit anderen gemeinsam zu mich herangetragen werden (Verhaltensregeln,
definieren, d. h. der Situation dieselbe Sinn- 70 „Spielregeln“) und an denen ich, mehr unbe-
25 perspektive zu unterlegen. wusst als bewusst, mein Verhalten ausrichte.
Um im Spiel mitreden zu können bzw. um als Diese Verhaltenserwartungen sind im Laufe der
Außenstehender eine Spielhandlung zu verste- Entwicklung ein Teil meiner selbst geworden.
hen, muss man die dem Spiel zugrundeliegende Mead nennt diesen Aspekt der Identität „me“.
Sprache, die Bedeutung des Geschehens erken- 75 Das zweite Moment, das mit dem „me“ in
30 nen. Der Sinn des Handelns wird durch Regeln ständiger Wechselwirkung steht, nennt Mead
konstituiert – aber er ergibt sich nicht aus- „I“. Es repräsentiert jene Vorstellungen, Bedürf-
schließlich als das Ergebnis einer deterministi- nisse, Interessenlagen, die aus dem „Innern“
schen Regelbefolgung; in der Alltagskommuni- meiner selbst in mein Bewusstsein gelangen.
kation würde dies einer extrem starren 80 Das „I“ ist nach Mead sehr viel unbestimmter,
35 Rollenfixierung gleichkommen. Tatsächlich weniger festgelegt, als das „me“. Es sichert
sind Spiel und Alltagskommunikation flexible Freiheit, Spontaneität, Handlungsinitiative.
Systeme, die über genügend Kontingenz verfü- Merke:
10– Ein extremes Übergewicht des „me“ führt den. Was von Eltern und Kindern selbstver-
85 langfristig zu sozialer Abhängigkeit und Erwar- ständlich als „Spiel“ begriffen wird, ist für den
tungsängsten: 135 Kommunikationsforscher ein hochkomplexer
Ich richte mich ständig nach den vermeintli- Vorgang metasprachlicher Verständigung.
chen Erwartungen anderer und wage nicht, Rollenspiele sind Systeme mit metakommuni-
gegenüber anderen meine eigenen Interessen zu kativer Regelstruktur. Das heißt, ich kann mich
90 formulieren und zu vertreten. in der Entschlüsselung dieser Umdeutungsvor-
– Ein extremes Übergewicht des „I“ bedeutet 140 gänge nur zurechtfinden, wenn ich die Bezie-
die Missachtung der Erwartung anderer zu- hung zwischen den Objekten und den zugeord-
gunsten der eigenen Bedürfnisse, es führt neten Bedeutungen kenne. Wir sind bei
langfristig zu Egoismus, Selbstüberschätzung, Kindern sofort geneigt, eine Handlung wie das
95 Überheblichkeit. Hintersichherziehen eines Gürtels als Spiel zu
– Im sozialen Spiel lernt das Kind die richtige 145 identifizieren. Wenn wir aber einen Erwachse-
Balance zwischen beiden Aspekten: einerseits nen so sehen (den Gürtel hinter sich herziehend
sich an Regeln zu halten, andererseits – z. B. und ihm gut zuredend), dann werden wir ihn
beim Mogeln des Spielpartners – die eigenen für verrückt halten, weil in unserer Erwartung
100 Interessen wahrzunehmen; weil das Spiel ein dieses Tun nicht mit einem rationalen, dem
System interaktiven Gleichgewichts ist, fördert 150 Erwachsenenstatus angemessenen Verhalten
es sozial erwünschte Verhaltensweisen wie übereinstimmt. Wenn wir aber den Mann auf
Gerechtigkeit, Metakommunikation, Empathie einer Bühne in derselben Situation sehen,
(= die Fähigkeit, sich in andere einzufühlen und haben wir wiederum eine Erklärung parat:
105 im eigenen Handeln die Interessen anderer zu „Aha, er spielt jetzt was, verrückt vielleicht, aber
berücksichtigen). 155 der Sinn ergibt sich vielleicht noch aus dem
Kinder lernen, wie Mead deutlich machte, Stück, der Unsinn ist sicher gewollt!“ Dem
insbesondere durch die Sprache (sprachliche Handlungsort Theater trauen wir jedenfalls zu,
Interaktion) und durch Spiel (insbesondere dass das gezeigte „Verrücktsein“ nur „gespielt“
110 Rollenspiel) ein Verhaltensrepertoire aufzubau- ist; erst dann halten wir die Person nicht für
en, das „me“ und „I“ im Zuge der Entwicklung 160 geistesgestört, sondern für normal.
in ein ausgewogenes Balanceverhältnis bringt. Dieselbe Handlung kann also in unserem
Darum ist aber auch für Eltern wichtig, mit geistigen Entschlüsselungssystem etwas völlig
ihrem Kind (ihren Kindern) zu spielen. Im Spiel Unterschiedliches bedeuten – die richtige
115 wird zwischen den Spielpartnern immer ein Bedeutung zu treffen, setzt voraus, übergreifen-
„mittlerer Abstand“ (Sutton-Smith) hergestellt, 165 de Sinn- und Kommunikationsstrukturen zu
der das Kind weder der elterlichen Überbe- kennen. Genau dies aber ist Metakommunikati-
schützung, noch der sozialen Kälte und Ver- on, nämlich Kommunikation über die Kommu-
nachlässigung aussetzt. nikation. Ich muss als außenstehender Beob-
120 Übergang zu einer allgemeinen rollentheoreti- achter wissen, ob die dem Gürtel gegenüber
schen Betrachtung des Spiels: Spielsituationen 170 geäußerte Mitteilung, wie etwa „braves Hünd-
können mit Goffman bestimmt werden „als chen!“ so gemeint ist, als ob sie wirklich zu
soziale Situationen, in denen durch eine ge- einem Hund gesprochen wird – oder nicht. Für
meinsame Situationsdefinition ein gegebener verrückt würde man nur dann jemanden hal-
125 gesellschaftlicher Kontext in eine fiktive Situati- ten, wenn er wirklich meint, dies sei ein Hund;
on verwandelt wird“. (Goffman, S. 31) 175 da wir uns von unseren vorgeprägten Rollen
Rollenspiel setzt voraus, dass ich die Bedeutung einfach nicht vorstellen können, dass ein Er-
eines Objektes oder Zeichens durch eine andere wachsener wenn er so etwas tut, einfach nur
Bedeutung ersetzen kann: Für das Kind wird (für sich selbst) spielt wie ein Kind, bleibt uns
130 der hinterhergezogene Gürtel zum Hund an der kaum etwas übrig, als ihn für verrückt zu hal-
Leine, die Papierkrone macht es zur Königin, 180 ten.
aus der Stuhlreihe ist ein Personenzug gewor-
11 1. Bedeutung des Spiels nach
George Herbert Mead (nur LK)Beim Spielen bestimmte symbolische Interaktionen vollziehen …
(Foto: Georg Bubolz, Erkelenz)
Es ist kein Zufall, dass die Kommunikationsstö- 205 (dummerweise!), weil er den aggressiv erschei-
rungen, die bei Schizophrenen auftreten, Thera- nenden Handlungen Ernstcharakter zuspricht
peuten und Kommunikationsforscher dazu und die Botschaft „dies ist Spiel!“ nicht wahrge-
veranlassten, das Spiel als Erklärungsmodell nommen hat. Tendenzen eines möglichen
185 heranzuziehen, um in die Kommunikations- Überganges vom „Spiel“ zum „Ernst“ sind für
struktur schizophrener Patienten einzudringen. 210 Dritte nicht immer sogleich auszumachen, weil
Einer der führenden Forscher auf diesem dies von der momentanen Selbstdefinition der
Gebiet in den 50er und 60er Jahren war Gregory Situation durch die Beteiligten abhängen.
Bateson. Er meinte, dass wir im Spiel gegenüber (Aus: Hein Retter, Einführung in die Pädagogik des
190 der Alltagsrealität vor allem die Besonderheit Spiels. Basistext zur Lehrveranstaltung, Braunschweig,
vorfinden: Erstdruck 1998/Neuauflage 2003, S. 72–74, erschienen
(a) dass die im Spiel ausgetauschten Mitteilun- in: Spielmittel, 9. Jg. 1990, Heft 4, S. 97–103. (leicht
gen oder Signale im gewissen Sinne unwahr verändert) © Hein Retter, Institut für Allgemeine
Pädagogik und Technische Bildung, Abteilung Histo-
oder nicht [so] gemeint sind; und (b) dass das,
risch-Systematische Pädagogik, TU BS; in: https://
195 was mit diesen Signalen bezeichnet wird, nicht
www.tu-braunschweig.de/Medien-DB/hispaed/
existiert. (Bateson, S. 248). spiel98-03.pdf - 1.12.2014)
Alles was im Spiel getan wird, ordnet sich
gewissermaßen der Botschaft unter, die da
1 Arbeiten Sie aus dem Textauszug von Hein
heißt: „Dies ist Spiel!“ Nur die wechselseitige
Retter die Grundgedanken Meads zur Be-
200 Akzeptanz dieser Botschaft führt dazu, dass die
deutung des Spiels für menschliches Zusam-
jugendlichen Akteure einer Rangelei sich mit
menleben heraus.
zusammengebissenen Zähnen knuffen und
2 Erörtern Sie die pädagogische Relevanz der
puffen – in einer Art, die den außenstehenden
Überlegungen.
Erwachsenen meist sofort eingreifen lassen
121.3 Der Mensch und seine Rollen im Alltag – Spiel als Paradigma in den
Geistes- und Sozialwissenschaften
Hein Retter führt weiter aus: Der Mensch als Spieler – das lässt sich schließ-
45 lich im Shakespeareschen Sinne verstehen,
Bei Shakespeare heißt es bekanntlich: insofern er im Alltag verschiedene Rollen zu
„Die ganze Welt ist eine Bühne, spielen hat. Ein Problem besteht darin, dass der
und alle Männer und Frauen sind nichts als rollenspielende Mensch sich in Analogie zu
Spieler. einem Schauspieler verstehen könnte, der zwar
5 Sie haben ihre Abgänge und Auftritte 50 ein ständig ein Repertoire von Rollen ausspielt,
Und ein Mensch spielt in seinem Leben viele dessen eigentliche Identität aber letztlich im
Rollen.“ Verborgenen bleibt – womit wir noch einmal
Mit einer „Rolle“ kann man in der Tat kaum auf Shakespeare zurückkommen, denn die
etwas Besseres tun, als sie zu „spielen“ – was gerade zitierte Stelle aus „Wie es Euch gefällt“
10 immer damit gemeint sein mag. Als Konse- 55 gehört zu einer Passage, mit der der englische
quenz bietet sich jedenfalls die Erkenntnis an: Dramatiker das menschliche Leben in 7 Akten,
„Wir alle sind Spieler!“ – so könnte man Shakes- sprich: 7 Lebensaltern beschreibt; am Ende
peare interpretieren. heißt es nicht ohne Ironie:
Sind wir wirklich alle Spieler? Zumindest die „Die letzte Szene, die diese sonderbare und
15 Vielschichtigkeit des Wortes „Spieler“ lässt uns 60 ereignisreiche Geschichte [des menschlichen
nachfragen. Ein Spieler – damit kann ein Akti- Lebens] beendet, ist Rückkehr zum Kindisch-
ver eines Tennis- oder Fußballspiels gemeint sein und purem Vergessen:
sein, also jemand, der eine bestimmte Funktion [der Mensch –] ohne Zähne, ohne Augen, ohne
in einer realen Spielsituation ausfüllt, die aller- Geschmack – ohne überhaupt etwas!“
20 dings nur von begrenzter und überschaubarer 65 Auch diese Rolle spielt der Mensch also, er ist in
Zeitdauer ist. Wahrheit nicht einer der spielt, sondern einer,
Ein Spieler par excellence kann zweitens ein der sozusagen „gespielt“ wird, ins Dasein
Meister seines Faches sein, der sein Handwerk geworfen, vergänglich in seiner Existenz, in
in höchster Vollendung ausübt und sein Spiel seinem Schicksal bestimmt durch Werden und
25 zum ästhetischen Genuss, ja zum Kunstwerk 70 Vergehen – womit wir bei Shakespeare (der ja
werden lässt. Es gibt „unsterbliche“ Partien – in für alles gut sein kann!) einen Anklang von
der Geschichte des Schachs oder des Ten- existenzphilosophischer Spielbetrachtung
nissportes etwa, die das Spiel in seinem Ideal- vorfinden, wie sie im 20. Jahrhundert von
bild verkörpern. Martin Heidegger bis Eugen Fink vorfindbar ist.
30 Daraus ersehen wir, dass auch im konkreten 75 „Rolle“ ist bekanntlich ein zentraler Begriff der
Spiel, im Sportspiel etwa, eine Bedeutungs- Soziologie und der Sozialpsychologie. Der
schicht des Allgemeinen steckt, ein überzeitli- Mensch übernimmt aus der Sichtweise der
ches Ideal, dem sich das konkreter Geschehen Sozialwissenschaft Rollen. In dem Bezugsver-
immer nur nähern, es aber nie voll erreichen hältnis von Mensch und Rolle müssen wir uns
35 kann – einfach deshalb, weil konkretes Spiel 80 allerdings über eines im Klaren sein: Nur
immer eine besondere Art von Zeitstrukturie- Menschen besitzen Realität, d. h. ein Ansichsein
rung darstellt, die sich erst im überzeitlichen und ein Fürsichsein, Rollen dagegen sind
Ideal aufhebt. gedankliche Konstruktionen (hypothetische
Ein Spieler kann aber ebenso derjenige sein, der Konstrukte, wie der wissenschaftliche Terminus
40 nur noch spielt, dessen Lebensinhalt gleichsam 85 heißt), mit denen man versucht, eine bestimmte
zeitüberdauernd ausschließlich das Spiel ist, Seite des menschlichen Verhaltens zu erklären.
zumeist das Glücksspiel – wie Dostojewski es in Soziale Rollen kann man allgemein als „Verhal-
seinem berühmten Roman geschildert hat. tenserwartungen“ definieren. Eine Theorie, die
13 1. Bedeutung des Spiels nach
George Herbert Mead (nur LK)menschliches Verhalten als ein Bündel von zum wohnheit des täglichen Umganges schon immer
90 Teil übereinstimmenden, zum Teil wider- an mir erfahren habe. […]
sprüchlichen Rollen zu erklären versucht, geht 140 Im Prozess der Interaktion von Menschen sind
davon aus, dass der Mensch in seinem Alltag die Verhaltenserwartungen der sozialen Mit-
nichts anderes tut, als jene Rollen wahrzuneh- welt nicht so genau mit dem Zentimetermaß
men (zu spielen), die ihm seine Umwelt vorgibt, abzumessen, wie man beispielsweise die eigene
95 d. h. sich in einem Rahmen sozialen Handelns Bauchweite bestimmen kann; es ist – unter
zu bewegen, der von den Erwartungen, von den 145 normalen Lebensbedingungen – ein gewisser
bestehenden Normen und Wertvorstellungen Verhaltensspielraum für mich vorhanden, den
der jeweiligen Bezugsgruppe bestimmt ist. ich allerdings auszuloten habe. Ich bin genötigt,
Wenn wir an das Erlernen solcher Rollen im durch meine eigenen Handlungen an den
100 Entwicklungsprozess des jungen Menschen Reaktionen meiner sozialen Umwelt festzustel-
denken, so hat sich dafür ein Begriff eingebür- 150 len, bis zu welchen Grenzen ich die Rolle, die
gert, der den traditionellen Erziehungsbegriff ich zu spielen habe, selbst ausgestalten kann.
schon fast verdrängt hat, ihm aber zumindest Tatsächlich findet sich das, was wir „Selbstbe-
starke Konkurrenz macht. Das ist der Begriff stimmung“ oder „Identität“ nennen, weder in
105 Sozialisation, der nichts anderes meint, als den der bloßen Anpassung an die Rollen, die uns
lebenslangen Prozess des Erlernens von sozia- 155 zugewiesen werden, noch durch eine Haltung,
len Rollen. die glaubt, die Erwartung anderer völlig negie-
Im Erziehungsbegriff von Rousseau und Pesta- ren zu können. Es handelt sich vielmehr um ein
lozzi bis zur geisteswissenschaftlichen Pädago- Balance-Verhältnis zwischen jenem Bewusst-
110 gik im 20. Jahrhundert kommt der Begriff Rolle seinsanteil, der das Verhalten über gelernte
sinngemäß überhaupt nicht vor. Erziehung 160 Normen und Erwartungen steuert, und jener
kann in diesem traditionellen Verständnis Art von Selbstbewusstsein, das sich relativ
entweder ein Ergebnis pädagogischer Einwir- wenig um solche Überlegungen schert und sich
kungen „von außen“ sein, es kann auch das einfach durchsetzen will, sei es zur Wahrung
115 Sichselbstentfalten unter Vermeidung direkter subjektiver Interessen, als Ausdruck trotzigen
fremdbestimmter Einflüsse bedeuten, immer 165 Widerstandes gegenüber bestehenden Abhän-
aber liegt dem klassischen Erziehungsbegriff gigkeiten oder im Zuge von Spontanhandlun-
die Vorstellung zugrunde, dass es so etwas gibt gen.
wie eine objektiv vorhandene, vom einzelnen Es […] gibt […] genug Alltagssituationen, in
120 Subjekt unabhängige Wirklichkeit, in der sich denen wir unsere Rollengebundenheit spüren
solche sozialen Prozesse vollziehen. Wenn man 170 können. Ich will ein Beispiel von mir selbst
von Rollen spricht, die der Mensch zu spielen geben. Irgendwann in meiner Kindheit hatte ich
hat, wird dieses – sagen wir naive – Wirklich- einmal gehört, dass es angeblich eine Briefmar-
keitsverständnis aufgegeben. Soziale Wirklich- kensprache geben soll. Ich weiß beim besten
125 keit ist aus der Sicht der Rollentheorie zum Willen nicht, ob es sie tatsächlich gibt, diese
überwiegenden Teil das, was wir an Verhaltens- 175 Briefmarkensprache, und was man alles mit der
erwartungen, an Rollen also, selbst produzie- Anordnung der Briefmarken auf dem Um-
ren. Rollenbezogen Interaktionen werden nicht schlag dem Empfänger vorab signalisieren
in einer vorgegebenen Wirklichkeit entwickelt, kann. Ich habe mir im Grunde nur eines ge-
130 sondern sie selbst konstituieren diese Wirklich- merkt: Wenn man die Briefmarke verkehrt
keit auf der Grundlage von Verhaltenserwar- 180 herum aufklebt, also das Abbild auf den Kopf
tungen – die allerdings nicht völlig unkalkulier- stellt, dann soll das angeblich soviel heißen wie
bar erscheinen; denn indem sich mein eigenes „Leck mich am …“, das Götz-Zitat also. Natür-
Verhalten durch Erwartungen anderer be- lich habe ich relativ viel Briefpost zu erledigen,
135 stimmt, erwarte ich gleichzeitig bestimmte da kommt es schon einmal vor, dass ich in aller
Verhaltensweisen meiner sozialen Umwelt und 185 Hast, fünf Minuten bevor der Briefkasten
zwar in der Regel jene, die ich durch die Ge- geleert wird, eine Marke umgekehrt drauf
14haue – was in mir, indem ich das erkenne, war, eine Maus zu sein, begegnet nach seiner
sogleich einen echten Konflikt auslöst, zumal Entlassung einer Katze, er reißt aus in panischer
ich unter Zeitdruck stehe. Angst.
190 Darf ich einem bekannten Wissenschaftler, bei „Warum denn das?“, fragt ihn der Doktor nach
dem ich mich für die Zusendung eines Beitrages 240 der Wiedereinlieferung, „Sie wissen doch, dass
für einen von mir herauszugebenden Sammel- Sie keine Maus sind.“ „Ja, natürlich, weiß ich
band bedanke – darf ich diesem ehrwürdigen das – aber ob die Katze das weiß?“
Ordinarius mittels der umgedrehten Briefmar- Die beiden kleinen Geschichten – der Irren-
195 ke signalisieren: Meine Anrede, „Hochverehrter Witz und das Briefmarkenerlebnis – sagen uns,
Herr Kollege“ soll eigentlich heißen: Du altes 245 dass die Rollen, die wir im Alltag ausüben, über
A....!? Alles, was in meinem Brief an Dank und Kommunikationsvorgänge erworben werden,
Anerkennung steht, müsste dann von ihm so unsere Kommunikation mit anderen Personen
aufgenommen werden, als ob ich das genaue aber wiederum davon abhängt, welche Bedeu-
200 Gegenteil meine – eben verkehrt herum wie tungen wir den Zeichen und Symbolen geben,
diese Briefmarke. Das wäre doch völlig unmög- 250 mit denen wir uns verständigen.
lich! Unfassbar, was er von mir denken würde! Alltagskommunikation impliziert Verständi-
„Reg dich nicht auf “, sagt die Stimme des gung über Rollen; die Signale des nonverbalen
Unbekümmerten in mir, „woher soll denn der Verhaltens und der Sprache, mit deren Hilfe wir
205 gute Kollege X die Briefmarkensprache kennen? kommunizieren, enthalten Botschaften. Die
Der guckt sowieso nicht auf den Umschlag und 255 Bedeutungen, die wir zwecks Kommunikation
liest nur den Brief!“ in die eigenen „Botschaften“ hineinlegen,
„Aber vielleicht hat er eine Sekretärin, die den müssen in gewisser Weise kongruent sein mit
Umschlag für ihn öffnet, Frauen schauen sich jenen Bedeutungen, die wir als an uns gerichte-
210 solche Dinge ja sehr genau an, die wird ihm das te Botschaften entschlüsseln.
sofort erzählen!“ 260 Kommunikationsstörungen, Rollenkonflikte
„Ach Unsinn“, reagiert die Stimme des Unbe- und Paradoxien entstehen immer dann, wenn
kümmerten in mir, „das mit der Briefmarken- diese Kongruenz nicht existiert, z. B. weil das-
sprache ist doch was für Teenager, das kann selbe Wort in einem entgegengesetzten Sinne
215 man doch kein Erwachsener ernst nehmen.“ verstanden wird, als sein Inhalt ausdrückt.
„Ja, das mag ja alles sein“, stöhnt mein Rollen- 265 Wenn meine Partnerin zu mir sagt: „Du bist
Ich, „aber weiß ich, ob er das weiß?“ – Zu guter aber heute besonders liebenswürdig zu mir!“,
Letzt, die Zeit drängt, löse ich die Marke ab, und dann werde ich diesen Satz nur dann als Kom-
klebe sie „ordnungsgemäß“ richtig herum auf. pliment entschlüsseln, wenn die Art, in der dies
220 Mein rollenbestimmtes Sicherheitsbedürfnis gesagt wird, zum Inhalt stimmig ist, also in
hat gesiegt gegenüber dem unbekümmerten 270 freundlichem Ton. Sowie eine Spur von Bitter-
Selbst. keit die Stimme färben sollte, weiß ich sofort,
Nebenbei: Dass jedermann um die Möglichkeit dass das Gegenteil gemeint ist.
weiß, das Götz-Zitat durch eine Briefmarke Eulenspiegel spielt seine Schalksrolle dort am
225 übermitteln zu können, dies aber selbstver- eindrucksvollsten, wo er die Leute beim Wort
ständlich meidet, halte ich deshalb für nicht 275 nimmt, indem er den wörtlichen Inhalt der
ausgeschlossen, weil bei der vielen Post, die in Aufforderungen der erbosten Bürger ausführt,
unserem Briefkasten täglich steckt, wohl ab und nicht aber den gemeinten Sinn. Scherz, Witz
zu Briefe mit Marken in verschiedenen Kreuz- und Ironie, aber auch die Drohung sind Äuße-
230 und-quer-Lagen dabei sind (z. B. auf Briefen rungsformen, durch die unsere Alltagsrollen in
von Freunden der Kinder), aber eine einzeln 280 Frage gestellt werden. Sie wirken überwiegend
umkehrt aufgeklebte Marke habe ich noch nicht durch Vertauschung oder Verfremdung von
erlebt – etwa Sie? Bedeutungen; die „Als-ob-Signale“ die solche
Die Sache erinnert natürlich an eine bekannte umfunktionierten Bedeutungen enthalten,
235 Form von Irren-Witzen. Der Irre, der überzeugt
15 1. Bedeutung des Spiels nach
George Herbert Mead (nur LK)werden nach Regeln verstanden, die etwas mit So amüsant die Geschichte für den Zuhörer
285 dem Spiel gemein haben. klingt, lösen können die beiden ihr Problem
[…] Eine Rolle spielen bedeutet: „So tun, als nicht – weil sie sich ihres unterschiedlichen Dis-
ob …“, und dieses So-tun-als-ob, das wir im 335 tanzmaßes gar nicht bewusst sind. Nur ein
Alltag praktizieren, ist ebenso eine Quelle für Dritter, der zu einem Gespräch über den Kon-
das Rollenspiel der Kinder. Alltagskommunika- flikt anregt, also die beiden zur Metakommuni-
290 tion und Spielsituationen zeichnen sich da- kation führt, könnte hier helfen.
durch aus, dass im Konfliktfall die Regeln des Die Therapie schizophrener Patienten besteht
Handelns neu überdacht werden müssen. 340 nach Bateson in dem Versuch, „die metakom-
Wenn ein „Neuer“ zu einer Gruppe spielender munikativen Gewohnheiten des Patienten zu
Kinder stößt, dann wird zunächst darüber verändern“. Denn charakteristisch für den
295 gehandelt, ob er überhaupt mitspielen darf, und Schizophrenen sei die Unfähigkeit zur Meta-
wenn ja, welche Funktion, welche Rolle er kommunikation; nur mit Hilfe von metakom-
übernehmen soll. Gespräche dieser Art wie 345 munikativen Fähigkeiten könnte das ständige
auch jede Diskussion um eine mögliche Verän- Produzieren von Verhaltensparadoxien verhin-
derung der Spielregel sind Metakommunikati- dern.
300 on. Die meisten Alltagskonflikte, sind kaum […] Am Ende unserer Spielbetrachtung sind
anders als mit Hilfe von Metakommunikation wir erstaunlicherweise beim „Wahn-Sinn“
lösbar. Aber nicht in allen Fällen besteht dazu 350 angelangt. Machen wir einmal folgendes Expe-
die Möglichkeit, nämlich dann nicht, wenn die riment: Ich verbinde jemandem, den ich gut
Kommunikanden, ohne es zu wissen, sich in kenne, die Augen, verstopfe seine Ohren, setze
305 einer kommunikativen „Falle“ befinden. Ein mich mit ihm ins Taxi und fahre zu einem Haus;
besonders aufschlussreiches Beispiel einer Wir betreten einen Raum, der eine sog. Einweg-
kommunikativen „Falle“ beschreibt Watzla- 355 Sichtscheibe besitzt und den Blick frei gibt auf
wick. einen anderen Raum, in dem eine Gruppe von
Jeder von uns hält einen gewissen Abstand zu Menschen um einen Tisch sitzt.
310 einem fremden Gesprächspartner, ohne dass Der Freund, der jetzt seine Sinnesorgane wieder
wir uns dessen bewusst sind. Wenn uns aber gebrauchen kann, soll sagen, was die Gruppe tut
jemand zu nahe auf den Pelz rückt, wird uns das 360 und was das für eine Gruppe sein könnte. Die
unangenehm. Bei einem Nordländer ist diese Gruppe gestikuliert mit Händen und Füßen,
räumliche Distanz zum Gesprächspartner meist einige lachen plötzlich laut auf; was sie tun, ist
315 größer als bei einem Südländer (also bei Leuten dem Betrachter jedenfalls unverständlich.
aus Stockholm wahrscheinlich größer als bei Dem Freund bleiben eigentlich nur 2 Möglich-
Neapolitanern). Wenn sich aber nun ein Nord- 365 keiten zu antworten: Entweder er sagt, „die
länder und ein Südländer erstmals begegnen kommen mir verrückt vor, vielleicht sind wir
und miteinander ins Gespräch kommen, wäre hier in der Psychiatrie!“ Oder er sagt, „die
320 der folgende Verhaltenskonflikt denkbar: verhalten sich so, als ob sie etwas spielen, was
Der Südländer wird den für ihn als normal ich aber nicht verstehe, vielleicht sind wir hier
empfundenen Abstand einnehmen, für den 370 im Jugendzentrum!“
Nordländer ist dies jedoch zu nah, so dass er
unbewusst einen Schritt zurücksetzt, um seine (Aus: Hein Retter, Einführung in die Pädagogik des
325 Distanz wieder herzustellen. Spiels. Basistext zur Lehrveranstaltung, Braunschweig,
Der Südamerikaner hat während des Gesprächs Erstdruck 1998/Neuauflage 2003, S. 75–82, erschienen
aber nun das unbestimmte Gefühl, dass etwas in: Spielmittel, 9. Jg. 1990, Heft 4, S. 97–103. (leicht
nicht stimmt, unbewusst wird er aufrücken. verändert) © Hein Retter, Institut für Allgemeine
Pädagogik und Technische Bildung, Abteilung Histo-
Das „Spiel“ geht so weit, bis der Nordamerika-
risch-Systematische Pädagogik, TU BS; in: https://
330 ner schließlich an der Wand steht und vielleicht
www.tu-braunschweig.de/Medien-DB/hispaed/
sogar in homosexuelle Panik gerät. spiel98-03.pdf - 1.12.2014)
161 Erläutern Sie, inwiefern die Überlegungen 3 Vergleichen Sie die spieltheoretischen Über-
von Hein Retter die Theorie des Spiels von legungen Meads mit denen Schäfers (siehe
George Herbert Mead konkretisieren. im „Kursbuch Erziehungswissenschaft“
2 Belegen Sie am Textauszug, inwieweit Hein S. 342 ff.) und erörtern Sie den jeweiligen
Retter der Kritik Meads an der herkömmli- pädagogischen Wert.
chen Rollentheorie folgt.
Spielecke
(Foto: Georg
Bubolz, Erkelenz)
17 1. Bedeutung des Spiels nach
George Herbert Mead (nur LK)2. Interdependenz von Streben nach Autonomie
und sozialer Verantwortlichkeit im Modell der
produktiven Realitätsverarbeitung
(Foto: Georg Bubolz, Erkelenz)
„Man muss sich die Freiheit nehmen.
Sie wird einem nicht gegeben.“
Meret Oppenheim
182.1 Hinführung: Jorge Bucay, Der angekettete Elefant –
Eine pädagogische Parabel
Jorge Bucay, 1949 in Buenos Aires geboren, ist Als Sechs- oder Siebenjähriger vertraute ich
Autor, Psychiater und Gestalttherapeut. 40 noch auf die Weisheit der Erwachsenen. Also
Vor allem seine Geschichten zu einem humanen fragte ich einen Lehrer, einen Vater oder Onkel
Zusammenleben haben ihn bekannt gemacht. – nach dem Rätsel des Elefanten. Einer von ihnen
Im folgenden Text geht es um ein therapeutisches erklärte mir, der Elefant mache sich nicht aus
Gespräch mit seinem Klienten Demian. dem Staub, weil er dressiert sei.
45 Meine nächste Frage lag auf der Hand: „Und
„Ich kann nicht“, sagte ich. „Ich kann es einfach wenn er dressiert ist, warum muss er dann noch
nicht.“ angekettet werden?“
„Bist du sicher?“, fragte er mich. Ich erinnere mich nicht, je eine schlüssige
„Ja, nichts täte ich lieber, als mich vor sie hinzu Antwort darauf bekommen zu haben. Mit der
5 stellen und ihr zu sagen, was ich fühle … Aber 50 Zeit erinnerte ich mich nur dann wieder daran,
ich weiß, dass ich es nicht kann.“ wenn ich auf andere Menschen traf, die sich
Der Dicke setzte sich im Schneidersitz in einen dieselbe Frage irgendwann auch schon einmal
dieser fürchterlichen blauen Polstersessel in gestellt hatten.
seinem Sprechzimmer. Er lächelte, sah mir in Vor einigen Jahren fand ich heraus, dass zu
10 die Augen, senkte die Stimme wie immer, wenn 55 meinem Glück doch schon jemand weise genug
er wollte, dass man ihm aufmerksam zuhörte, gewesen war, die Antwort auf die Frage zu
und sagte: finden:
„Komm, ich erzähl dir eine Geschichte.“ Der Zirkuselefant flieht nicht, weil er schon seit
Und ohne ein Zeichen meiner Zustimmung frühester Kindheit an einen solchen Pflock
15 abzuwarten, begann er zu erzählen. 60 gekettet ist.
Als ich ein kleiner Junge war, war ich vollkom Ich schloss die Augen und stellte mir den wehr
men vom Zirkus fasziniert, und am meisten losen neugeborenen Elefanten am Pflock vor.
gefielen mir die Tiere. Vor allem der Elefant Ich war mir sicher, dass er in diesem Moment
hatte es mir angetan. Wie ich später erfuhr, schubst, zieht und schwitzt und sich zu befreien
20 ist er das Lieblingstier vieler Kinder. Während 65 versucht. Und trotz aller Anstrengung gelingt es
der Zirkusvorstellung stellte das riesige Tier ihm nicht, weil dieser Pflock zu fest in der Erde
sein ungeheures Gewicht, seine eindrucks steckt.
volle Größe und seine Kraft zur Schau. Nach Ich stellte mir vor, dass er erschöpft einschläft
der Vorstellung aber und auch in der Zeit bis und es am nächsten Tag gleich wieder probiert,
25 kurz vor seinem Auftritt blieb der Elefant 70 und am nächsten Tag wieder, und am nächs
immer am Fuß an einen kleinen Pflock ange ten … Bis eines Tages, eines für seine Zukunft
kettet. verhängnisvollen Tages, das Tier seine Ohn
Der Pflock war allerdings nichts weiter als ein macht akzeptiert und sich in sein Schicksal fügt.
winziges Stück Holz, das kaum ein paar Zenti Dieser riesige, mächtige Elefant, den wir aus
30 meter tief in der Erde steckte. Und obwohl die 75 dem Zirkus kennen, flieht nicht, weil der Ärms
Kette mächtig und schwer war, stand für mich te glaubt, dass er es nicht kann.
ganz außer Zweifel, dass ein Tier, das die Kraft Allzu tief hat sich die Erinnerung daran, wie
hatte, einen Baum mitsamt der Wurzel auszu ohnmächtig er sich kurz nach seiner Geburt
reißen, sich mit Leichtigkeit von einem solchen gefühlt hat, in sein Gedächtnis eingebrannt.
35 Pflock befreien und fliehen konnte. 80 Und das Schlimme dabei ist, dass er diese
Dieses Rätsel beschäftigt mich bis heute. Was Erinnerung nie wieder ernsthaft hinterfragt hat.
hält ihn zurück? Nie wieder hat er versucht, seine Kraft auf die
Warum macht er sich nicht auf und davon? Probe zu stellen.
19 2. Interdependenz von Streben nach Autonomie und sozialer
Verantwortlichkeit im Modell der produktiven
Realitätsverarbeitung„So ist es, Demian. Uns allen geht es ein biss 105 ein Stück heran, setzte sich mir gegenüber auf
85 chen so wie diesem Zirkuselefanten: Wir bewe den Boden und sprach weiter:
gen uns in der Welt, als wären wir an Hunderte „Genau dasselbe hast auch du erlebt, Demian.
von Pflöcken gekettet. Dein Leben ist von der Erinnerung an einen
Wir glauben, einen ganzen Haufen Dinge nicht Demian geprägt, den es gar nicht mehr gibt und
zu können, bloß weil wir sie ein einziges Mal, 110 der nicht konnte.
90 vor sehr langer Zeit, damals, als wir noch klein Der einzige Weg herauszufinden, ob du etwas
waren, ausprobiert haben und gescheitert sind. kannst oder nicht, ist, es auszuprobieren, und
Wir haben uns genauso verhalten wie der zwar mit vollem Einsatz. Aus ganzem Herzen!“
Elefant, und auch in unser Gedächtnis hat sich (Aus: Jorge Bucay, Der angekettete Elefant, in: Ders.,
die Botschaft eingebrannt: Ich kann das nicht, Komm, ich erzähl dir eine Geschichte, aus dem Spani-
95 und ich werde es niemals können. schen von Stephanie von Harrach, Fischer TaschenBib-
Mit dieser Botschaft, der Botschaft, dass wir liothek, Frankfurt/M. 2008, S. 7–11.; © Deutsche
machtlos sind, sind wir groß geworden, und Ausgabe: Ammann Verlag & Co., Zürich 2005)
seitdem haben wir niemals mehr versucht, uns
von unserem Pflock loszureißen. 1 Interpretieren Sie die Geschichte.
100 Manchmal, wenn wir die Fußfesseln wieder 2 Erörtern Sie die „Lehre“ der Geschichte in
spüren und mit den Ketten klirren, gerät uns Hinblick auf menschliches Streben nach
der Pflock in den Blick, und wir denken: Ich Autonomie.
kann nicht, und werde es niemals können.“ 3 Beziehen Sie Stellung unter Berücksichti
Jorge machte eine lange Pause. Dann rückte er gung der pädagogischen Perspektive.
2.2 Das Modell der produktiven Realitätsverarbeitung nach Klaus Hurrelmann
Klaus Hurrelmann, Jahrgang 1944, war bis zu 15 sourcen, zur Rolle der Sozialisationsinstanzen,
seiner Emeritierung Professor für Sozial- und zur Persönlichkeitsentwicklung, Lebenslauf,
Gesundheitswissenschaft an der Universität zum Sozialisationseffekt gesellschaftlicher
Bielefeld. Das Modell der produktiven Realitäts- Ungleichheit und zu männlichen und weibli
verarbeitung bildet den Kern seiner Sozialisati- chen Dispositionen für die Persönlichkeitsent
onstheorie. In einer seiner Thesen erläutert 20 wicklung. [...]
Hurrelmann die Entwicklung der Ich-Identität Störungen der Identitätsbildung haben ihren
als Voraussetzung für autonome Handlungsfä- Ausgangspunkt in einer mangelnden Überein
higkeit und psychische Gesundheit. stimmung der personalen und sozialen Kompo
nenten der Identität, also den auf Individuation
Das Modell repräsentiert die über den Einzel 25 zielenden Bedürfnissen, Motiven und Interes
theorien der Sozialisation angesiedelte metathe sen auf der einen und den auf Integration
oretische Vorstellung, dass ein Mensch sich gerichteten gesellschaftlichen Erwartungen auf
stets aktiv mit seinen körperlichen und psychi der anderen Seite. Stimmen diese nicht überein,
5 schen Umweltbedingungen auseinandersetzt kann es zu Störungen des Selbstvertrauens und
und dabei seine Persönlichkeitsentwicklung 30 in der Folge zu sozial unangepasstem und
während des gesamten Lebenslaufs vorantreibt. gesundheitsschädigendem Verhalten kommen.
[...] Die Kernaussagen … treffen Feststellungen Je entscheidungsfähiger und handlungssicherer
zum Verhältnis von innerer und äußerer Reali ein Mensch ist, je mehr Fertigkeiten zur Bewäl
10 tät, zur Produktion der eigenen Persönlichkeit, tigung psychischer und sozialer Beziehungs
zur Bewältigung der Entwicklungsaufgaben, 35 strukturen und Netzwerke einbezogen und in
zum Spannungsverhältnis von Individuation wichtigen gesellschaftlichen Rollenzusammen
und Integration, zur Bildung von Ich-Identität, hängen anerkannt ist, desto besser sind die
zum Verhältnis personaler und sozialer Res Voraussetzungen für die Ich-Identität und
20Begriffe an einer Hauswand
(Foto: Georg Bubolz, Erkelenz)
damit für die selbstständige und autonome
40 Handlungsfähigkeit.
(Aus: Klaus Hurrelmann, Sozialisation. Das Modell
der produktiven Realitätsverarbeitung, Beltz Verlag,
Weinheim und Basel 2012, S. 75–76, 62–63)
1 Erläutern Sie die Grundlagen des Modells
der produktiven Realitätsverarbeitung nach
Hurrelmann – auch unter Rückgriff auf S.
380 ff. im „Kursbuch Erziehungswissen
schaft“.
2 Erörtern Sie die Bedingungen für selbststän
dige und autonome Handlungsfähigkeit.
Arbeiten Sie dabei auch heraus, inwiefern die
Entwicklung von Verantwortlichkeit mit der
Genese dieser Handlungsfähigkeit verbun
den ist.
2.3 Die Interdependenz von Streben nach Autonomie und sozialer
Verantwortlichkeit
Klaus Hurrelmanns Modell wird in den folgen- Die Ablösung erfolgt auf verschiedenen
den Textauszügen am Beispiel des Jugendalters Ebenen:
exemplarisch betrachtet, einer Zeit, in der sich in • Der psychischen Ebene, indem die Einstel
der Regel Jugendliche von den Eltern ablösen, zu 15 lungen und Handlungen nicht mehr vorran
Autonomie streben und zunehmend eigene gig an den Eltern, sondern an Angehörigen
Verantwortlichkeit zeigen müssen. der eigenen Generation ausgerichtet werden.
• Der emotionalen und intimen (erotischen,
sexuellen) Ebene, indem nicht mehr Mutter
2.3.1 Die Ablösung von den Eltern 20 und Vater Liebesobjekte sind, sondern selbst
gewählte Partnerinnen und Partner.
Die Eltern-Kind-Beziehung durchläuft im
• Der kulturellen Ebene, indem ein persönli
Jugendalter eine grundlegende Transformation
cher Lebensstil entwickelt wird, der sich von
von der emotional nahen und schützenden
dem der Eltern unterscheidet.
Haltung der Eltern mit deutlichen Erziehungs
25 • Der räumlichen Ebene, indem der Wohn
5 akzenten in der Kindheit zur sympathisierend
standort aus dem Elternhaus verlagert wird.
begleitenden und Selbstständigkeit fördernden
• Der materiellen Ebene, indem die wirtschaft
Haltung. Ablösung, verbunden mit Distanzie
liche Selbstständigkeit erreicht und damit die
rung und Eigenständigkeit, ist Voraussetzung
finanzielle Abhängigkeit vom Elternhaus
für die Weiterentwicklung der Persönlichkeit in
30 beendet wird.
10 der Adoleszenzphase (Larson, Wilson, Brown,
Furstenberg und Verma 2002).
21 2. Interdependenz von Streben nach Autonomie und sozialer
Verantwortlichkeit im Modell der produktiven
RealitätsverarbeitungDie Bewältigung des vielschichtigen Ablö setzen sie auch entsprechend um. […] Die
sungsprozesses verlangt von beiden Parteien 80 jungen Männer halten es auch anschließend
einfühlsames Verhalten und gute Kommunika deutlich länger im Elternhaus aus als die jungen
tionsfähigkeiten, wenn es nicht zu Spannungen Frauen und entwickeln sich häufiger zu „sozia
35 und Konflikten kommen soll. Da die Eltern mit len Nesthockern“.
der räumlichen und finanziellen Versorgung
einen mächtigen Hebel in der Hand haben, Zwischen Verbundenheit und Distanzierung
bleibt ihr Einfluss auf die Lebensgestaltung der Für die meisten Jugendlichen sind die Her
85
jugendlichen Kinder sehr groß, auch wenn kunftsfamilien unentbehrliche soziale und
40 diese sich innerlich schon abgelöst haben. Bei emotionale „Trainingslager“, um die schwieri
vielen Jugendlichen ist eine unbefangene Mi gen sozialen Kompetenzen einzuüben, die sie
schung aus psychischer Loslösung und pragma für die Lebensbewältigung und die Beziehungs
tischer sozialer Bindung typisch, und auch die 90 arbeit benötigen. Familien „bieten also nicht
meisten Eltern haben sich mit der Kombination nur emotionalen Schutz, sondern wichtige
45 aus Zuwendung und Ablösung gut arrangiert Lernmöglichkeiten. Gleichzeitig schaffen sie
(Fend 2005, S. 300; Flammer und Alsaker 2002, einen Raum, in dem die Individuation des
S. 179). Menschen voranschreitet, in dem die Balance
95 von Unabhängigkeit und Verbundenheit einge
Abfolge der Ablösungsschritte übt werden kann“ (Fend 2005, S. 303). Das
Auf den verschiedenen Ebenen findet der Hin- und Herschwanken zwischen enger
50 Ablösungsprozess zu unterschiedlichen Zeit Verbundenheit mit emotionalem Anlehnungs
punkten statt (Papastefanou 2006). Dabei treten bedürfnis und Abgrenzung mit selbstgesteuer
die einzelnen Ablösungsereignisse in der Regel 100 ter Eigenständigkeit und demonstrativer Dis
in einer bestimmten Abfolge auf. Die psychi tanzierung ist dabei für beide Seiten – sowohl
sche Ablösung erfolgt heute meist als erste, für die Eltern als auch für die Jugendlichen –
55 teilweise schon um das 11. und 12. Lebensjahr charakteristisch (Amett 2010, S. 176; Silbereisen
herum. Sie hat sich wegen der früher einsetzen und Kracke 1999).
den Pubertät im Lebenslauf weiter vorverlagert. 105 Die flexible Synchronisierung von unterschied
Auch auf der emotionalen und kulturellen lichen Erwartungen, Einstellungen und Lebens
Ebene werden Jugendliche heute früh selbst auffassungen, die ständige Neueinstellung der
60 ständig. Die materielle Ablösung hingegen hat Balance zwischen emotionaler Nähe und sozia
sich eher zurückverlagert und kann heute – bei ler Eigenständigkeit gibt den Jugendlichen das
Jugendlichen, die eine Hochschulausbildung 110 psychische Rüstzeug, um auch außerhalb der
durchlaufen – bis an das Ende des dritten Familie kompetent zu handeln. An die Kombi
Lebensjahrzehnts rücken. nations- und Verhandlungsfähigkeit beider
65 Die räumliche Ablösung vom Elternhaus erfolgt Seiten, von Eltern und jugendlichen Kindern,
in langsamen Schritten. Ein großer Teil der werden dabei hohe Ansprüche gestellt.
Jugendlichen möchte so lange wie möglich den 115 Durch die Ablösungsbemühungen der Jugend
Komfort der elterlichen Wohnung („Hotel lichen können sich Eltern psychisch verletzt
Mama“) genießen und hat es mit dem Auszug fühlen. Sie müssen ein geschicktes Konfliktma
70 nicht eilig. Die Eltern akzeptieren das meist nagement betreiben, um die grundlegende
gerne. Diese Situation spiegelt die relativ span emotionale Beziehung zu ihrem Kind aufrecht
nungsfreie Beziehung der Generationen wider. 120 zuerhalten und zugleich die Ablösungsimpulse
Andere würden zwar ganz gern ausziehen, in Verselbstständigungsanforderungen umzu
verfügen aber nicht über die finanziellen Mittel lenken. Eine an Überzeugung und Argumenten
75 (Leven, Quenzel und Hurrelmann 2010, S. 68). orientierte Erziehung auf der Basis einer guten
[…] Beziehung ist dabei notwendig, verbunden mit
Weibliche Jugendliche artikulieren ihre Aus 125 großer Sensibilität und Aufmerksamkeit für die
zugswünsche früher als die männlichen und seelischen Vorgänge bei den Kindern und die
22Sie können auch lesen