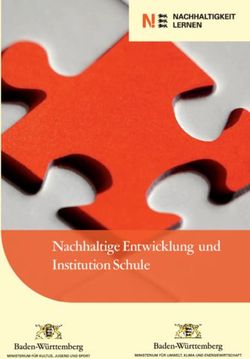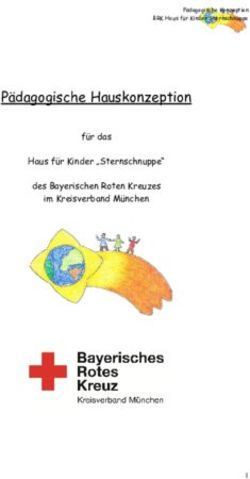Offene Jugendarbeit und Schule
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Bern, November 2005 Offene Jugendarbeit und Schule Ein Leitfaden für die Zusammenarbeit Autorinnen und Autoren: Rahel Lischer, Jugendsekretariat Moosseedorf Roger Kislig, Fachstelle Jugend, Amt Schwarzenburg Eva Mosimann, Jugendarbeit Urtenen-Schönbühl Sarah Lauper, Jugendzone Ost, TOJ Daniel Lozano, Büro für offene Jugendarbeit, Kirchgemeinde Bethlehem Christa Egger, Sozialräumliche Jugendarbeit Bern-West, TOJ
Impressum:
Texte: Rahel Lischer, Jugendsekretariat
Moosseedorf; Roger Kislig, Fachstelle Jugend,
Amt Schwarzenburg; Eva Mosimann, Jugend-
arbeit Urtenen-Schönbühl; Sarah Lauper,
Jugendzone Ost, TOJ; Daniel Lozano, Büro
für offene Jugendarbeit, Kirchgemeinde
Bethlehem; Christa Egger, Sozialräumliche
Jugendarbeit Bern-West, TOJ
Gestaltung/Korrektur: an|streicher
Bilder: Jugendsekretariat Moosseedorf,
Fachstelle Jugend, Amt Schwarzenburg,
Jugendarbeit Urtenen-Schönbühl,
Jugendzone Ost, TOJ & an|streicher
Kontaktadresse: Sekretariat VOJA
Wydenstrasse 6, 3076 Worb
T: 031 839 66 31; F: 031 839 66 03
info@voja.ch; www.voja.chInhalt
Seite
4
Kapitel
Vorwort aus dem VOJA-Vorstand
Seite
17
Kapitel
4. Institutionalisierung der Zusammen-
Vorwort der Fachgruppe arbeit von Jugendarbeit und Schule
Jugendarbeit und Schule 4.1 Standards der Zusammenarbeit
5 1. Ausgangslage 18 4.2 Anforderungen
1.1 Gesellschaftliche Aspekte 19 4.3 Checkliste zur Aufnahme
7 1.2 Auftrag der Kinder- und Jugendarbeit der Zusammenarbeit
1.2.1 Trägerverein «Vernetzte offene 21 4.4 Hilfreiche Tipps für
Jugendarbeit Kanton Bern» die Zusammenarbeit mit der Schule
1.2.2 Steuerungskonzept der offenen 21 5. Angebote und Produkte der offenen
Kinder- und Jugendarbeit im Kinder- und Jugendarbeit gegenüber
Kanton Bern der Gesundheits- und der Schule
Fürsorgedirektion (GEF) 5.1 Pausenplatzaktionen
10 1.3 Grundsätze der offenen Kinder- 5.2 Öffentlichkeitsarbeit im
und Jugendarbeit Klassenzimmer
11 1.4 Auftrag Schulsozialarbeit 5.3 Schullager
1.4.1 Auftrag / Pflichtenheft 5.4 Gesundheitsförderung und
Schulsozialarbeit Präventionskurse
131.4.2 Organisationsmodell 5.5 Soziale Gruppenarbeit
1.5 Auftrag Schule 5.6 Mitwirkung bei Anlässen der Schule
15 2. Schnittstellen zwischen den Arbeits- 22 5.7 Hilfe bei der Berufswahlvorbereitung
bereichen der offenen Jugendarbeit 5.8 Beratung und Begleitung
und der Schulsozialarbeit 22 6. Literatur
2.1 Unterschiede 23 7. Anhang
2.2 Gemeinsamkeiten 7.1 Münsingen: Leistungsvereinbarung
2.3 Kooperationsmöglichkeiten Offene Kinder- und Jugendarbeit
16 3. Gewinn, Chancen und Zusatznutzen 27 7.2 Ostermundigen: Ressourcen der
einer Zusammenarbeit von Jugend- Kinder- und Jugendarbeitenden als
arbeit und Schule Angebot für die Schulen
3.1 Chancen und Nutzen für die 31 7.3 Ergebnisse der Umfrage
offene Kinder- und Jugendarbeit bei den VOJA-Institutionen
3.2 Chancen und Nutzen für die Schule betreffend Zusammenarbeit
mit den Schulen
3Vorwort aus dem VOJA-Vorstand Vorwort der Fachgruppe
«Jugendarbeit und Schule»
Die «Vernetzte offene Jugendarbeit Kanton Bern» Dieser «Leitfaden für die Zusammenarbeit» ist eine
VOJA ist bestrebt, die Fachlichkeit und die Zu- Handreichung, welche die Fachgruppe «Jugend-
sammenarbeit in der offenen Jugendarbeit des arbeit und Schule» im Auftrag der VOJA (Vernetzte
Kantons Bern zu fördern. Der VOJA-Vorstand hat offene Jugendarbeit Kanton Bern) erarbeitet hat.
deshalb im Jahr 2002 beschlossen, Fachgruppen Dazu wurden diverse Veröffentlichungen über die
von Jugendarbeitenden einzusetzen, die je einen Themenfelder der offenen Kinder- und Jugendarbeit,
gesellschaftlichen Brennpunkt besonders intensiv der Schulsozialarbeit und der Schule gesichtet.
und kontinuierlich bearbeiten. Mittlerweile existie- Besonders wertvoll für die Erarbeitung des Leit-
ren sieben so genannte FAG (Fachgruppen). fadens waren die Ergebnisse quantitativer und qua-
litativer Befragungen von Jugendarbeitenden und
An seiner Retraite vom Januar 2003 hat der VOJA- SchulsozialarbeiterInnen.
Vorstand ein Thesenpapier einer Gruppe von
Jugendarbeitenden diskutiert, das die Zusammen- Jugendarbeit, Schulsozialarbeit und Schule gelten
arbeit zwischen offener Jugendarbeit und Schule als fachlich gleichermassen qualifizierte Partner in
zum Thema hatte. Er kam dabei zum Schluss, dass verwandten Arbeitsfeldern, die sich mit den glei-
die Fragen nach dem spezifischen Auftrag der offe- chen Adressaten beschäftigen, nämlich Kindern und
nen Jugendarbeit und den geeigneten Formen der Jugendlichen. Alle drei Bereiche sehen sich mit den
Zusammenarbeit mit der Schule der Klärung bedür- veränderten Bedingungen des Aufwachsens in der
fen. Der Vorstand erteilte der Gruppe den Auftrag, heutigen Gesellschaft konfrontiert. Die gemeinsa-
sich als FAG «Jugendarbeit und Schule» zu konstitu- men Herausforderungen und Probleme ergeben
ieren, das Thema vertieft zu studieren und die unserer Meinung nach einen plausiblen Ausgangs-
Ergebnisse in geeigneter Form zu dokumentieren. punkt für eine Kooperation.
Die VOJA stellt sich damit auch der Tatsache, dass im
Kanton Bern zunehmend Stellen für Schulsozial- Um eine Kooperation zu erreichen, müssen sich die
arbeit geschaffen werden, womit ein weiterer Part- Kinder- und Jugendarbeit, die Schulsozialarbeit und
ner im gesellschaftlichen Beziehungsgeflecht be- die Schule über Ziele gemeinsam verständigen und
rücksichtigt und in die Zusammenarbeit miteinbezo- bereit sein, aus den unterschiedlichen Aufgaben re-
gen werden muss. sultierende Widersprüche zu akzeptieren und be-
gleitende Lösungsansätze zu entwickeln. Damit
Der vorliegende Leitfaden ist das Ergebnis von wird die Zusammenarbeit zwischen den Institu-
Gesprächen der FAG «Jugendarbeit und Schule» mit tionen und auch zwischen den Professionen zur Vor-
Verantwortlichen von Schule und Schulsozialarbeit. aussetzung. Diese Zusammenarbeit muss von allen
Er spiegelt den aktuellen Stand des Nachdenkens Seiten gewollt und gelernt werden, und sie muss
über den eigenen Auftrag und die möglichen For- Teil des Selbstverständnisses beider Seiten sein.
men der Zusammenarbeit aus der Sicht der offenen
Jugendarbeit. Im Namen des VOJA-Vorstands danke Der Leitfaden soll als Fundgrube zum Thema
ich der FAG für ihre Arbeit und wünsche dem Leit- Jugendarbeit, Schulsozialarbeit und Schule dienen
faden gute Aufnahme bei allen Interessierten. sowie deren erfolgreiche Zusammenarbeit fördern
und unterstützen. Er soll helfen, die Unterschiede in
Andreas Berz den Zielsetzungen, den Denkansätzen, den Metho-
den zu erkennen, zu verstehen und den Boden für
gemeinsames Handeln zu ebnen. Der Leitfaden rich-
tet sich an Fachkräfte aus den Bereichen Jugend-
arbeit, Schulsozialarbeit und Schule.
Auszüge aus dem Leitfaden dürfen vervielfältigt werden.
41. AUSGANGSLAGE
Die gesellschaftlichen Aspekte sind die Rahmenbedingungen.
Sie bilden die Grundlage für den Auftrag der Kinder- und Jugendarbeit.
1.1 Gesellschaftliche Aspekte
Die Anforderungen an die Gesellschaft sind durch Dazu kommt, dass diese gesellschaftliche Ent-
die sozioökonomischen Veränderungen der letzten wicklung in den letzten Jahren auch die Bedeutung
Jahrzehnte deutlich grösser geworden. Noch nie war der Familie beeinflusst hat. Die tradierten Milieus,
eine Kultur so schnellen Veränderungen unterwor- die Familien und Kindern das Gefühl von Sicherheit
fen wie die heutige. und Geborgenheit, Verlässlichkeit von Beziehungen
und Berechenbarkeit der Zukunft geben, sind in der
Ursachen hierfür sind unterschiedliche Entwick- Stadt wie auf dem Lande brüchig geworden.
lungen. Als Stichworte hierzu seien kurz genannt:
Neue Unübersichtlichkeiten, Globalisierung, Indivi- Schliesslich drängen viele Einflüsse die Bedeutung
dualisierung, wirtschaftlich-strukturelle Einbrüche. der Familie für die kindliche Sozialisation zurück.
Mit diesen Einflüssen kann die Familie kaum kon-
Bietet die Gesellschaft ein geringeres Mass an kurrieren. Die Erfahrungen und Kompetenzen der
Zukunftsperspektive, schwinden die Grundlagen für Elterngeneration wirken immer weniger identitäts-
Zuversicht, Lebens- und Berufsplanung. Von diesen stiftend. Eltern sehen sich schwierigen Erziehungs-
Veränderungen der ökonomischen und sozialen aufgaben gegenüber, die sie oft nicht alleine bewäl-
Basis sind Kinder und Jugendliche am stärksten be- tigen können. Ausserfamiliäre Erziehungsinstanzen
troffen. Jugendliche stehen vor einer Zukunft, die erhalten so eine immer grössere Bedeutung.
nicht selbstverständlich gesichert erscheint.
5Die Schule sieht sich Schülern und Schülerinnen Offene Kinder- und Jugendarbeit hat den Auftrag,
gegenüber, die weniger von der Autorität der Älte- soziale Brennpunkte aufzunehmen und möglichst
ren bestimmt sind, stattdessen stark vom Verhalten flexibel auf Probleme, Bedürfnisse und aktuelle
und der Denkweise der Gleichaltrigen beeinflusst Trends Jugendlicher einzugehen. Ziel und Heraus-
werden. Für sie hat ihre Freizeit Priorität, sie wollen forderung muss zudem sein, Kindern und Jugend-
ihren Freiheitsdrang ausleben, stellen traditionelle lichen, Schülerinnen und Schülern nicht nur aus der
Werte in Frage, sind mobil, und materielle Werte Perspektive der Erwachsenen und ihrer Bedürfnisse
spielen eine wichtige Rolle. zu begegnen, sondern zugleich auch deren Perspek-
tiven und Bedürfnisse wie auch Lebenswelten zu be-
Zudem tragen Kinder und Jugendliche ihre persön- rücksichtigen, unter dem Gesichtspunkt passender
lichen, familiär und sozial bedingten Probleme in die Integrationshilfen und ganzheitlicher Bildung.
Schule. Die Schulen sind der Spiegel unserer Gesell-
schaft. Sie sind der Ort, wo soziale Brennpunkte, be- vgl.:
dingt durch eine grosse soziale, kulturelle und 06. Mai 2005 / Internet: www.ljr-bw.de/ljr/download/
sprachliche Vielfalt und ein breites Begabungsspek- borschueren/kooperationjuaschule.pdf
trum in den Schulklassen, in verschiedenster Form 06. Mai 2005 / Internet: www.ejwue.de/jugendpolitik/
aufbrechen. Dies stellt hohe Anforderungen an die upload/kriterien_jugendarbeit_und_schule.pdf
Lehrpersonen und an die Schülerinnen und Schüler. 06. Mai 2005 / Internet: www.jugendfoerderwerk.de/
contentpapst/texte/arbeitshilfe-gts.pdf
61.2 Auftrag der Kinder- 1.2.2 Steuerungskonzept
und Jugendarbeit der offenen Kinder- und
Im Kanton Bern gibt es in Bezug auf die Kinder- und Jugendarbeit im Kanton Bern
Jugendarbeit so viele Pflichtenhefte, wie es Stellen der Gesundheits- und
der Kinder- und Jugendarbeit gibt. Aus diesem Fürsorgedirektion (GEF)
Grund lehnen wir uns einerseits an die «Aufgaben Die Gesundheits- und Fürsorgedirektion hat sich
und Schwerpunkte der Kinder- und Jugendarbeit», zum Ziel gesetzt, die offene Kinder- und Jugend-
herausgegeben von der VOJA, andererseits ans arbeit im Kanton Bern zu vereinheitlichen. Dazu hat
«Steuerungskonzept der offenen Kinder- und sie im Oktober 2000 ein Steuerungskonzept heraus-
Jugendarbeit im Kanton Bern», welches jede gegeben, an welchem sich die einzelnen Gemeinden
Gemeinde des Kantons bis spätestens im Jahr 2008 zu orientieren haben.
umgesetzt haben muss.
Die Gesundheits- und Fürsorgedirektion legitimiert
die offene Kinder- und Jugendarbeit durch gesetzli-
1.2.1 Trägerverein «Vernetzte che Grundlagen. Die GEF hat den Wirkungsbereich
offene Jugendarbeit der offenen Kinder- und Jugendarbeit verankert im
Kanton Bern» (VOJA) Artikel 3 des kantonalen Sozialhilfegesetzes (SHG):
Der Trägerverein «Vernetzte offene Jugendarbeit • Prävention
Kanton Bern» repräsentiert seit 1999 die offene • Hilfe zur Selbsthilfe
Kinder- und Jugendarbeit in Stadt und Region Bern • Verhinderung von Ausgrenzung
und seit 2003 im Kanton Bern. Die VOJA ist eine • Förderung der Integration
Dachorganisation, in welcher Gemeinden mit pro-
fessionellen Angeboten der offenen Kinder- und Definition der offenen Kinder-
Jugendarbeit zusammengeschlossen sind. und Jugendarbeit:
Offene Kinder- und Jugendarbeit umfasst die von
Vision den Gemeinden in Zusammenarbeit mit dem Kanton
Die offene Jugendarbeit begleitet und fördert bereitgestellten professionellen pädagogischen
Jugendliche auf dem Weg zur Selbstständigkeit. Angebote, welche Kinder und Jugendliche stützen
Dabei setzt sie sich dafür ein, dass Jugendliche im (Prävention), fördern (Partizipation) und ihnen ei-
Gemeinwesen partnerschaftlich integriert sind, sich nen angemessenen Platz in unserer Gesellschaft er-
wohl fühlen und an den Prozessen unserer Gesell- möglichen (Integration).
schaft beteiligt werden. Die Jugendarbeit versteht
sich als Mittler zwischen den Jugendlichen und den Die Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit
übrigen Anspruchsgruppen. Sie folgt mit geeigne- richten sich primär an Kinder und Jugendliche zwi-
ten animatorischen und partizipativen Methoden schen 6 und 20 Jahren sowie an deren Bezugs-
dieser Vision. Die offene Jugendarbeit richtet sich an personen und Umfeld, insofern die Interessen der
Jugendliche zwischen 12 und 20 Jahren sowie an ihr Kinder und Jugendlichen im Zentrum stehen.
Umfeld (junge Erwachsene, Bezugspersonen, Kin-
der). Die Angebote der offenen Kinder- und Jugend- Offene Kinder- und Jugendarbeit richtet sich un-
arbeit gehören zum Grundangebot jeder Gemeinde. mittelbar an einzelne junge Menschen und an insti-
(vgl. Leitbild der VOJA, 2004) tutionell nicht organisierte Gruppen von Kindern
und Jugendlichen auf der Basis von niederschwel-
ligen, integrationsfördernden Freizeitangeboten
und Begegnungsmöglichkeiten, welche die Kinder
und Jugendlichen im ausserschulischen / ausserbe-
ruflichen Freizeit- und Bildungsbereich ansprechen
7und von diesen freiwillig angenommen werden. Die Dienstleistungen ab. Zudem werden unter diesem
offene Kinder- und Jugendarbeit wird politisch und Titel keine Leistungen an Tagesschulen resp. Mit-
konfessionell neutral angeboten. tagstische ausgerichtet, die dem Steuerungskon-
zept «familienexterne Betreuungsangebote» zuge-
Die offene Kinder- und Jugendarbeit grenzt sich per ordnet werden. Die offene Kinder- und Jugendarbeit
Definition von der Schulsozialarbeit ab; die Zusam- grenzt sich über die Altersbegrenzung ab zu
menarbeit mit der Schule wird jedoch angestrebt. Angeboten im Bereich der Kleinkinder (0 bis 6 Jahre)
Die offene Kinder- und Jugendarbeit grenzt sich und der jungen Erwachsenen (über 20 Jahre).
ebenfalls von medizinischen und therapeutischen (vgl. Steuerungskonzept der offenen Kinder- und Jugendarbeit
Kanton Bern, S. 7)
Angebotspalette
Der Kanton unterteilt die Arbeit der offenen
Kinder- und Jugendarbeit in folgende Bereiche:
A: Animation / Begleitung
B: Information / Beratung
C: Entwicklung / Fachberatung
A: Animation / Begleitung
Beschreibung:
Aktive Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen als Ausgangspunkt für
vielfältiges und soziales Lernen, zudem orientieren sich die Angebote an
übergeordneten kinder- und jugendrelevanten Brennpunkten, Problemberei-
chen und Themen und beinhalten deren gezielte Bearbeitung mit gruppen-
und gemeinwesenorientierten Methoden:
• Animation zur aktiven Freizeitgestaltung
• Unterstützung und Begleitung von Kindern und Jugendlichen bei der
Umsetzung ihrer Anliegen und Initiativen
• Durchführung von Freizeitanlässen und -projekten unter Mitwirkung von
Kindern und Jugendlichen
• Bereitstellung von Ressourcen zur Ermöglichung von Freizeitaktivitäten
• Begleitung von Einzelnen und Gruppen sowie Intervention in Konflikt-
situationen. Durchführung von Präventionsveranstaltungen (z.B. Sucht-
und Gewaltprävention)
• Durchführung von Projekten zu kinder- und jugendspezifischen Themen
• Durchführung von geschlechtsspezifischen Projekten
• Unterstützung von Kinder- und Jugendgruppen bei Konfliktlösungen
• Unterstützung und Begleitung von Kindern, Jugendlichen und Betroffenen
in Mitwirkungsprozessen auf der politischen Ebene oder bei der
Gestaltung des Lebensraumes
• Motivieren von Kindern und Jugendlichen zu Mitwirkung
Zielgruppe:
• Kinder und Jugendliche sowie themenspezifisch Betroffene (Eltern,
Behörden, Schule, weitere Institutionen und Einzelpersonen im Gemein-
wesen)
Orte der Dienstleistungserbringung:
• Kinder- und Jugendtreffs, Gemeinwesen, Spielplätze, informelle Kinder-
und Jugendtreffs, Schulen
8B: Information / Beratung
Beschreibung:
Wissensvermittlung und beratende Unterstützung:
• Information von Kindern und Jugendlichen sowie
deren Bezugspersonen über kinder- und jugendrelevante Fragen
• Beratung von Kindern und Jugendlichen unter Miteinbezug
betroffener Bezugspersonen und Institutionen
• Vermittlung von Kindern und Jugendlichen an weiterführende
professionelle Institutionen
• Durchführung von Informationsveranstaltungen und Kursen
für Kinder, Jugendliche und Bezugspersonen
Zielgruppe:
• Kinder und Jugendliche, Bezugspersonen und betroffene Institutionen
Orte der Dienstleistungserbringung:
• Kinder- und Jugendtreffs, Spielplätze, informelle Kinder- und
Jugendtreffs im Gemeinwesen, Informations- und Koordinationsstellen
für Kinder- und Jugendfragen
C: Entwicklung / Fachberatung
Beschreibung:
Förderung geeigneter Rahmenbedingungen
für Anliegen von Kindern und Jugendlichen:
• Öffentlichkeitsarbeit / Sensibilisierung
• Kommunale und regionale Vernetzung und Koordination
mit Behörden und anderen Institutionen
• Beratung und Unterstützung von Behörden und Institutionen
in kinder- und jugendspezifischen Fragen
• Unterstützung von Behörden und Institutionen bei
der Konzeptionierung von kinder- und jugendspezifischen
Massnahmen sowie bei sozialplanerischen Aufgaben
• Unterstützung von Behörden und Institutionen bei
der Einführung, Verankerung und Umsetzung
von Mitwirkungsmöglichkeiten und -projekten
• Durchführung von Informationsveranstaltungen und Kursen für
Behörden und Institutionen zu kinder- und jugendspezifischen Fragen
• Lobbyarbeit
Zielgruppe:
• Behörden, Eltern, Institutionen (Fachstellen, Schulen, Vereine, Polizei, ...)
Orte der Dienstleistungserbringung:
• Institutionen des Gemeinwesens, Gemeinwesen
9Der Kanton sieht im Steuerungskonzept vor, dass 1.3.1 Freiwilligkeit
die Kinder- und Jugendarbeit in den Aufgaben der Freiwilligkeit ist ein wichtiges Prinzip der offenen
Animation / Begleitung und der Entwicklung / Fach- Kinder- und Jugendarbeit, wenn es um Projekte,
beratung im Bereich Schule tätig ist. Seitens der Veranstaltungen, Informationen, Beratungen oder
Kinder- und Jugendarbeit bestehen diese Kontakte das Angebot der Jugendtreffs geht.
bereits. Je nach Institution arbeiten die Kinder- und
Jugendarbeitenden eng mit der Schule zusammen. In der Zusammenarbeit mit der Schule gilt das
Die Kontakte zur Schule sind verschiedener Art, von Prinzip der Freiwilligkeit nicht ohne weiteres. Bietet
unverbindlichen, sporadischen Angeboten bis hin die offene Kinder- und Jugendarbeit während der
zu institutionalisierten Gesundheits- und Präven- Schulzeit Präventionskurse, konstruktive Konflikt-
tionskursen in Schulklassen. bearbeitung, Berufsorientierungs-, Arbeitsfindungs-
(vgl. Steuerungskonzept offene Kinder- und hilfe etc. an, sind die Schülerinnen und Schüler zur
Jugendarbeit Kanton Bern (GEF, 2000)) Teilnahme grundsätzlich verpflichtet.
1.3 Grundsätze der offenen 1.3.2 Beziehungsarbeit
Kinder- und Jugendarbeit Der Aufbau einer Beziehung bildet die Grundlage
Grundsätze, an denen sich die Kinder- und Jugend- der Arbeit der offenen Kinder- und Jugendarbeit.
arbeit im Kanton Bern orientiert, findet man im Leit- Dabei spielt die Präsenz und Ansprechbarkeit eine
bild der VOJA, im Steuerungskonzept der Gesund- grosse Rolle. So befinden sich die Einrichtungen der
heits- und Fürsorgedirektion (GEF) und in der Fach- offenen Kinder- und Jugendarbeit möglichst in
literatur. Wohnortnähe und strahlen eine Atmosphäre aus,
die für Kinder und Jugendliche ansprechend ist und
Zu den Grundsätzen der offenen Kinder- und Jugend- möglichst wenig Schwellenangst auslöst. Zudem
arbeit gehören Freiwilligkeit, Beziehungsarbeit, sind die administrativen Formalitäten auf ein Mini-
Lebensweltorientierung, Gesundheitsförderung, mum reduziert und die Öffnungszeiten der Freizeit
Prävention, Partizipation, Lösungsorientierung und der Kinder und Jugendlichen angepasst.
Vernetzung.
Von den Jugendarbeitenden werden
Diese Grundsätze basieren auf folgenden folgende Eigenschaften gefordert:
Wissensbeständen: Emotionale Wärme, Akzeptieren und
Achten der Kinder und Jugendlichen
• Wissen um die Lebenswelt (Akzeptanz), einfühlendes Verstehen
der Kinder und Jugendlichen (Empathie), Echtheit im Verhalten
• Erklärungswissen aus der Sozialarbeit, der beratenden Person (Kongruenz).
der Soziokulturellen Animation,
der Psychologie, der Soziologie und
der Heil- und Sozialpädagogik
• Wissen über Verfahren und Techniken 1.3.3 Gesundheitsförderung /
der Jugendsozialarbeit Prävention
• Werteorientierung nach dem Der Grundsatz der Gesundheitsförderung / Präven-
Berufskodex der sozialen Arbeit tion bedeutet, dass die offene Kinder- und Jugend-
(vgl. Schweizer Berufsverband arbeit nicht erst dann zu helfen versucht, wenn
Soziale Arbeit SBS/ASPAS, 1999) Schwierigkeiten auftreten und sich verhärten, son-
dern bereits dann agiert, wenn Schwierigkeiten zu
erwarten sind. So bietet die offene Kinder- und
Jugendarbeit z.B. Präventionskurse an Schulen an
oder engagiert sich in Früherfassungsgremien.
101.3.4 Partizipation 1.4 Auftrag Schulsozialarbeit
Ein wichtiger Grundsatz der offenen Kinder- und 1.4.1 Auftrag / Pflichtenheft
Jugendarbeit ist das Ermöglichen von Beteiligung Schulsozialarbeit
und Mitbestimmung der Kinder und Jugendlichen. Gemäss Matthias Drilling (2002, S. 95) ist Schul-
Das heisst, dass die Jugendarbeit zusammen mit sozialarbeit «ein eigenständiges Handlungsfeld der
Kindern und Jugendlichen nach Artikulationsmög- Jugendhilfe, das mit der Schule in formalisierter und
lichkeiten wie z.B. SchülerInnenräten und Mitwir- institutionalisierter Form kooperiert. Schulsozial-
kungsanlässen sucht. In SchülerInnenräten und an arbeit setzt sich zum Ziel, Kinder und Jugendliche im
Mitwirkungsanlässen lernen Kinder und Jugend- Prozess des Erwachsenwerdens zu begleiten, sie bei
liche, ihre Bedürfnisse zu formulieren und nach einer für sie befriedigenden Lebensbewältigung zu
Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Dadurch können unterstützen und ihre Kompetenzen zur Lösung von
sie ein gesundes Selbstbewusstsein entwickeln. Sie persönlichen und/oder sozialen Problemen zu för-
fühlen sich ernst genommen und machen die dern. Dazu adaptiert Schulsozialarbeit Methoden
Erfahrung, etwas bewirken zu können. und Grundsätze der Sozialen Arbeit auf das System
Schule.»
1.3.5 Lösungsorientierung Im Kanton Bern gibt es keinen einheitlichen Auftrag
Der Grundsatz der Lösungsorientierung verlangt die und kein einheitliches Pflichtenheft für die Schul-
Haltung, dass Kinder und Jugendliche die Fähigkeit, sozialarbeit. Die bestehenden Schulsozialarbeiter-
die sie zur Lösung ihrer Probleme brauchen, bereits stellen haben jeweils ein eigenes Pflichtenheft.
in die Beratung mitbringen. In der Beratung geht es
darum, bereits vorhandenes Wissen der Kinder und Daniel Brechbühl, Leiter der Schulsozialarbeit
Jugendlichen nutzbar zu machen und in Kooperation der Stadt Bern, definiert den Tätigkeitsbe-
und Verhandlung mit den Kindern und Jugendlichen reich der Schulsozialarbeit folgendermassen:
passende Lösungswege zu finden.
• Schulsozialarbeit findet während
der Schulzeit statt.
1.3.6 Vernetzung • Schulsozialarbeit ist ein Unterstützungsan-
Ein weiteres Arbeitsprinzip der Kinder- und Jugend- gebot für die Schule, ihre Schülerinnen und
arbeit ist die geplante, zielgerichtete, möglichst in- Schüler und deren Eltern.
stitutionalisierte Vernetzung in regionalen und • Schulsozialarbeit ist Sozialarbeit im
überregionalen Strukturen. klassischen Sinn, also Einzelfallhilfe,
welche das umgebende System einbezieht.
Das heisst, Kinder- und Jugendarbeitende vernetzen • Schulsozialarbeit kann im Rahmen der Schule
im Sozialraum, arbeiten in interdisziplinären Früh- auch Gruppenarbeit anbieten.
erfassungs- bzw. Präventionskommissionen mit, ko-
ordinieren Präventions- und Gesundheitsförde-
rungsbemühungen in der Gemeinde und managen
Themenprojekte zu «Gewalt», «Drogen», «Gestal-
tung des öffentlichen Raumes» etc. Ausserdem sind
der kollegiale Austausch und die Mitarbeit in Fach-
gruppen eine wichtige Tätigkeit der offenen Kinder-
und Jugendarbeit.
11Tibor Beregszaszy, Schulsozialpädagoge
in Liebefeld (BE), hat folgenden Auftrag:
Beratung / Begleitung
SchülerInnen Lehrpersonen Eltern
Beratung Beratung Information
Begleitung «Coaching» Anlaufstelle
Information Vermittlung von Schülerinnen Beratung
Triage / Vermittlung und Schülern (kein Abschieben) Vermittlung
Intensivbegleitung
Time-out-Begleitung Gemeinsame Projekte
(Lösungen suchen) Mitarbeit Schulentwicklung
Kontaktaufnahme: Kontaktaufnahme: Kontaktaufnahme:
Schulhaus, Pausenplatz, Mittagstisch, in Pausen, Ausfallstunden, Telefon, Natel,
Büro (offene Tür), Briefkasten, Telefon, vereinbarten Besprechungen, E-Mail
Natel, E-Mail, über Eltern, Lehrpersonen Teilnahme an allen LehrerInnen-
oder durch SozialpädagogInnen und Kollegiumstagen und den
meisten Stufensitzungen 5/6
Projekte
Schulklassen Stufen Gesamte Schule
bei Ausgrenzungssituationen Präventionskonzepte SchülerInnenrat
bei Konflikten Geschlechtsspez. Projekte Elternpodien
Kriseninterventionen Gewaltprävention
Soziale Themen Schulhausprojekte
Themen- und Projektwochen Erlebniswochen
mit Elternrat
… und ausserdem
Vernetzung Lager Administration
Kontakt mit Fachstellen Landschulwochen Berichte
gemeinsame Projekte Winterlager Telefonate
Infoaustausch und Sitzungen (in der Regel nach «sozialpäda- Konzeptarbeit
gogischen Überlegungen») Literaturstudium
In aller Regel berät die Schulsozialarbeit auf freiwil-
liger Basis. In gravierenden Fällen (wiederholtes
Schuleschwänzen, Suchtmittelprobleme etc.) kann
es sinnvoll sein, dass Schülerinnen und Schüler und
ihre Eltern dazu angehalten werden, mit Hilfe der
Schulsozialarbeit die in der Schule manifestierten
Probleme zu bearbeiten, damit die Schule auf
weitergehende Massnahmen (Gefährdungsmel-
dung, Lager- oder Schulausschluss) verzichten
kann. In solchen Fällen ist eine sorgfältige Ab-
sprache unter allen Beteiligten unerlässlich, bevor
bei den Schülerinnen und Schülern und deren Eltern
in dieser Hinsicht interveniert wird. Die Schul-
sozialarbeit befasst sich nicht mit dem Bereich
Freizeit.
(vgl. Ausführungen des Schulsozialarbeiters
an der Schule Liebefeld Steinhölzli in Liebefeld)
12Quelle: Mitteilung der Direktion für Bildung, Umwelt und Integration der Stadt Bern,
Infoblatt 4 – 2004, Schulsozialarbeit, S. 8
1.4.2 Organisationsmodell 1.5 Auftrag Schule
Im Raum Bern sind zwei Organisationsmodelle Der gesellschaftliche Auftrag der Schule kann allge-
für die Schulsozialarbeit bekannt. Die Modelle sind: mein als die Vermittlung von Wissen und Bildung
umschrieben werden. Gleichzeitig soll sie die Ent-
Integrierte Schulsozialarbeit wicklung der Persönlichkeit der Schülerinnen und
Die Schulsozialarbeiterstelle befindet sich direkt im Schüler fördern. Im schweizerischen Schulsystem
Schulhaus und ist dadurch sehr niederschwellig an- gilt die allgemeine Schulpflicht, womit schon gesagt
gelegt. Sowohl Schülerinnen und Schüler als auch ist, dass wir uns hier nicht mehr auf dem Boden der
die Lehrpersonen haben täglich in diversen Situ- Freiwilligkeit bewegen.
ationen Kontakt mit der Schulsozialarbeit. Der
Schulsozialarbeiter oder die Schulsozialarbeiterin «Die Schulen führen ihren Erziehungs- und Bil-
ist ein Bestandteil des Schulhauses und erlebt und dungsauftrag auf der Grundlage des Volksschul-
prägt in seiner täglichen Arbeit das Schulklima mit. gesetzes, des Lehrplans und weiterer Erlasse aus.
Dies geschieht an jeder Schule vor dem Hintergrund
Zentrale Schulsozialarbeit unterschiedlicher Bedingungen: Lage, Grösse und
Die Schulsozialarbeiterstelle befindet sich ausser- besondere Merkmale des Ortes und der Region,
halb des Schulhauses, d.h. sie ist zum Beispiel dem Grösse der Schule, Zusammensetzung der Lehrer-
Gesundheitsdienst der Gemeinde oder des Stadt- und Schülerschaft usw. stellen verschiedenartige
quartiers angegliedert. Die Nutzung des Angebots Voraussetzungen für die Erziehungs- und Bildungs-
bedingt ein gezieltes Aufsuchen. Diese Hoch- arbeit dar. Da sich diese Bedingungen stets verän-
schwelligkeit kann für Schülerinnen und Schüler ein dern, muss die Schule flexibel auf neue Situationen
Hindernis darstellen. Der Schulsozialarbeiter oder reagieren können. Die Delegation von Entschei-
die Schulsozialarbeiterin nimmt den Alltag des dungsbefugnissen an die Schule soll es ihr ermög-
Schulhauses nicht hautnah wahr. lichen, ihren Auftrag situationsgerecht zu erfüllen.
In Zusammenarbeit mit den Schulbehörden und un-
In der Stadt Bern werden beide Modelle angewandt. ter Einbezug der Eltern gestalten die Lehrerinnen
und Lehrer ihre Schule als Ort,
• wo der verantwortungsbewusste Umgang mit
sich selbst, mit andern Menschen und mit der
Mitwelt erfahren und geübt wird;
• wo auf die Ziele des Lehrplans
hingearbeitet wird;
13• wo Lernen gelernt wird und elementare Zusammenarbeit
Kulturtechniken erworben werden; Schule – Eltern
• wo es Raum für Musse und Spontaneität «Die Schule unterstützt die Familie in der Erziehung
sowie Gestaltungsmöglichkeiten für die der Kinder. Während die Erziehungsverantwortung
Beteiligten gibt.» im engeren Sinn bei den Eltern liegt, übernehmen
(vgl. Lehrplan für die Volksschule, Lehrerinnen und Lehrer die Verantwortung für die
Erziehungsdirektion des Kantons Bern, S. 11) schulische Bildung. Aus der gemeinsamen Verant-
wortung ergibt sich die Notwendigkeit der Zusam-
Die Schule in der Gesellschaft menarbeit. Die Vielfalt der Werthaltungen erfordert
«Die Schule ist für die Kinder und Jugendlichen ein von der Schule und von den Eltern die Bereitschaft,
wesentlicher Lebensbereich und ein wichtiges sozi- Fragen der Erziehung im Rahmen der schulischen
ales Umfeld. Die Gesellschaft, an der die Schule teil- Bildung gemeinsam zu erörtern. Eltern begegnen
hat, stellt vielfältige, teilweise auch widersprüch- heute einer Schule, die nicht mehr derjenigen ent-
liche Anforderungen. Die Schule muss deshalb spricht, die sie selbst als Schülerinnen und Schüler
Schwerpunkte setzen; sie kann nicht alle Ansprüche seinerzeit erlebt haben.
erfüllen. Die Wirkungsmöglichkeiten der Schule
sind begrenzt. Weder für die Bildung noch für die Das Schulleitbild kann den Lehrerinnen und Lehrern
Erziehung hat sie eine Monopolstellung: Vor und eine wertvolle Orientierungshilfe für ihre Erzie-
nach der Schulpficht und ausserhalb der Schule hungsarbeit und für die Zusammenarbeit mit den
werden Bildung und Erziehung in unterschiedlich- Eltern sein. Gemeinsame Arbeit der Erziehungs-
ster Form vermittelt. verantwortlichen setzt gegenseitiges Vertrauen vor-
aus. Dieses entsteht, wenn Kontakte rechtzeitig ge-
Mündigkeit als Bildungsziel sucht werden und die Zusammenarbeit mit den
Die Schule unterstützt die Kinder und Eltern regelmässig und in gegenseitiger Offenheit
Jugendlichen auf deren Weg zur Mündigkeit. erfolgt.» (ebenda, S. 15)
• Mündigkeit zeigt sich in Selbstkompetenz,
Sozialkompetenz und Sachkompetenz. Neben Veranstaltungen zu erzieherischen oder un-
• Selbstkompetenz bedeutet die Fähigkeit, terrichtlichen Fragen sind auch Schulfeste, Feiern,
für sich selber Verantwortung zu übernehmen Theater, Ausstellungen usw. wichtig. Hier sind es oft
und entsprechend zu handeln. die Kinder, die helfen, Brücken zwischen den Er-
• Sozialkompetenz bedeutet die Fähigkeit, wachsenen zu schlagen.
in Gemeinschaft und Gesellschaft zu leben,
Verantwortung wahrzunehmen und entspre- Zusammenarbeit mit
chend zu handeln. aussenstehenden Personen
• Sachkompetenz bedeutet die Fähigkeit, und Institutionen
sachbezogen zu urteilen und entsprechend «Die Schule steht in vielfältigen Kontakten mit
zu handeln. Stellen, die sie in ihrer Arbeit unterstützen (Erzie-
hungsberatung, Kinder- und Jugendpsychiatrischer
Die Heranwachsenden sind gleichermassen in ihren Dienst, Schulsozialarbeit, Kinder- und Jugendarbeit,
intellektuellen, emotionalen und handlungsmässi- Berufsberatung, Schulärztlicher Dienst, Zentral-
gen Möglichkeiten in Bezug auf Selbstkompetenz, stelle für Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung, Schul-
Sozialkompetenz und Sachkompetenz zu fördern. inspektorat und seine Beratungsdienste). Damit
Die drei Kompetenzen sind nicht getrennte Be- aussenstehende Stellen wirksam Unterstützung
reiche, und sie sind auch nicht einzelnen Fächern leisten können, müssen sie rechtzeitig beigezogen
zuzuordnen; sie sollen sich vielmehr gegenseitig werden; der gegenseitige Austausch von Informa-
durchdringen und ergänzen. tionen muss gewährleistet sein.» (ebenda, S. 14)
Neben diesen Leitideen verfolgt die Schule auch
ganz konkrete Ziele. Der Bildungsauftrag, den die
Schule gemäss Gesetz zu verfolgen hat, findet sich
in einer operationalisierten Form im Lehrplan wie-
der.» (ebenda, S. 7)
142. SCHNITTSTELLEN ZWISCHEN
DEN ARBEITSBEREICHEN
DER OFFENEN JUGENDARBEIT
UND DER SCHULSOZIALARBEIT
Die Schule steht in Bezug auf ihre Entwicklung und das Vermitteln von
Lebensperspektiven insbesondere für sozioökonomisch und kulturell aus-
gegrenzte Kinder und Jugendliche vor massiven Herausforderungen. Hier
nehmen die Schulsozialarbeit und die Jugendarbeit unterschiedliche, je-
doch komplementäre Funktionen ein. Zwischen Schulsozialarbeit und offe-
ner Jugendarbeit gibt es viele Kooperationsmöglichkeiten, aber auch we-
sentliche Unterschiede.
2.1 Unterschiede
Der Schwerpunkt in der Schulsozialarbeit liegt in so- Schulsozialarbeit und Jugendarbeit wirken, direkt
zialpädagogischen Hilfen für Schülerinnen und oder indirekt, in der Schule und haben damit
Schüler in psychosozialen Problemlagen, während Einfluss auf die Schulqualität und das Schulklima.
sich die Angebote der offenen Kinder- und Jugend- Beide Angebote leisten einen Beitrag zur Öffnung
arbeit auf den Freizeitbereich konzentrieren. Bei der der Schule. Beide Arbeitsweisen verfolgen in unter-
Jugendarbeit und Schule geht es weniger um eine schiedlicher Ausprägung eine gesamtgesellschaftli-
Kooperation mit der Schule in ihrem Sozialraum, che Perspektive und den Anspruch, beizutragen zur
vielmehr um ein jugendarbeiterisches Angebot für Integration. (GEF 2003, Schuster 2004, Müller 2004)
Kinder und Jugendliche als Schüler und Schüle-
rinnen. Grundsätze sind unter anderem Freiwil-
ligkeit, Verzicht auf Leistungsorientierung, Alters- 2.3 Kooperationsmöglichkeiten
heterogenität sowie vielfältige Möglichkeiten der Offene Angebote der Kinder- und Jugendarbeit kön-
Mitbestimmung und Selbstorganisation; sie können nen die Schulsozialarbeit unterstützen und ergän-
schulischen Prinzipien entgegenstehen. zen, indem sie einen niederschwelligen Zugang zur
(Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) 2003; Zielgruppe herstellen. Sie bieten unverbindliche
Schuster 2004, Müller 2004) Kontaktmöglichkeiten. Dadurch wird ein gegenseiti-
ges Kennenlernen ermöglicht, welches spätere in-
tensive Kontakte möglicherweise stark erleichtern
2.2 Gemeinsamkeiten kann. Offene Angebote können daher auch eine
Die zwei Arbeitsbereiche Schulsozialarbeit und offe- Rolle bei der Vermittlung der konkreten Hilfe-
ne Jugendarbeit sehen sich idealerweise als ver- angebote an die Schülerinnen und Schüler spielen.
netzte Jugendpflege. Diese Form der vernetzten Die Zusammenarbeit von Jugendarbeit und Schul-
Jugendpflege versteht sich als ein umfassender sozialarbeit, insbesondere im Bereich der offenen
Ansatz. Das Fehlen eines Teils vernachlässigt die an- Angebote, sollte vor Ort verbindlich geregelt wer-
gegebene Zielgruppe und wird dem Grundsatz, dass den, da sie für die Qualitätsentwicklung beider
alle Jugendlichen gleichermassen angesprochen Leistungen unerlässlich ist.
werden sollen, nicht gerecht. Nur mit einer transpa-
renten Vorgehensweise wird es möglich sein, Weitere niederschwellig ausgerichtete Angebote
Doppelspurigkeiten und Missverständnisse zu ver- sind z.B. Projekte zu gemeinsamen Themen (z.B.
meiden. Gewalt, Drogen), Hilfen zur Alltagsbewältigung
(Freizeitangebote, Elternarbeit etc.) und Hilfen zur
Bewältigung des schwierig gewordenen Übergangs
in den Beruf. (z.B. Projekte mit «schulmüden»
Jugendlichen) (GEF 2003)
153. GEWINN, CHANCEN UND ZUSATZ-
NUTZEN EINER ZUSAMMENARBEIT
VON JUGENDARBEIT UND SCHULE
Kooperation ist ein Prozess mit Höhen und Tiefen und kein selbstverständ-
liches, von allein funktionierendes Unterfangen. Sie etabliert sich nur
durch Nutzen, der von beiden Partnern als Gewinn erlebt wird. Erst der
Versuch einer Zusammenarbeit ermöglicht die Überprüfung, ob vermehrte
Belastung mit Kooperation verbunden ist, oder ob gute Erfahrungen ge-
macht werden und Ergebnisse entstehen, die alleine nicht möglich gewe-
sen wären.
In der Kooperation von Jugendarbeit und Schule mit verbundenen pädagogischen Hintergrund ge-
kommen jene Partner zusammen, deren Interessen prägt, doch können in einer Zusammenarbeit ge-
und Ziele in relativ hoher Übereinstimmung zuein- meinsame Ziele in einem hohen Masse realisiert
ander stehen. Besonders im Hinblick auf die Ziel- werden. Die Kooperation beinhaltet das Potenzial,
gruppen verdeutlichen sich die gemeinsamen Inte- verschiedene Lernformen in einen einheitlichen Bil-
ressen und Anliegen. dungsprozess zu integrieren. Von einer guten
Zusammenarbeit können und sollen alle Beteiligten
Die konkreten Beweggründe der Beteiligten sind profitieren.
zwar von ihrem spezifischen Arbeitsfeld und dem da-
3.1 Chancen und Nutzen für 3.2 Chancen und Nutzen
die offene Kinder- und für die Schule
Jugendarbeit • Synergien im Hinblick auf Zielgruppe,
• Die Zielgruppen werden umfassend Unterricht und Teamarbeit.
und effizient erreicht. • Impulse von aussen für Kommunikation
• Für viele Kinder und Jugendliche ist im ge- und Auseinandersetzung.
schützten Rahmen der Schule ein einfacher und • Unterstützungs- und Ergänzungsangebote in
niederschwelliger Erstkontakt mit der Kinder- unterschiedlichen Bereichen ihres Bildungs-
und Jugendarbeit möglich. und Erziehungsauftrags (Suchtprävention,
• Synergien im Hinblick auf die Zielgruppe. Gewaltprävention, demokratische Erziehung,
• Präsenz in der Öffentlichkeit. interkulturelles Lernen usw.).
• «Raum» für die Realisierung und Durchführung • Ergänzungsangebote in den Bereichen
spezifischer Angebote (Suchtprävention, Persönlichkeitsstärkung, soziale Kompetenzen,
Gewaltprävention, Teambildung, geschlechter- Teamfähigkeit, Konfliktlösung usw.
spezifische Angebote). • Erlernte soziale Kompetenz wirkt sich auf das
• Kinder- und Jugendarbeit wird gezwungen, ihre Schulklima positiv aus, im Verband erlerntes
Leistungen zu präsentieren, was zu einer klare- Engagement kann zum Engagement für die
ren Vorstellung des eigenen Wertes und zu Schule werden.
Selbstbewusstsein hinsichtlich eigener • Die Schule wird unterstützt durch die
Fähigkeiten führen kann. sozialpädagogische Kompetenz der
• Kinder- und Jugendarbeit könnte erfahren, dass Kinder- und Jugendarbeit.
die Schule etwas von ihr will, weil das Angebot • Niederschwelliges Beratungsangebot /
attraktiv und bereichernd ist. Austausch in Bezug auf «schwierige» und
• Anerkennung ihrer Fachkompetenzen. «auffällige» Kinder.
• Impulse zur Weiterentwicklung von • Kollegiale Beratung, Feedback von aussen
Arbeitsansätzen. und Unterstützung sind möglich.
vgl.
06. Mai 2005 / Internet: www.ljr-bw.de/ljr/download/
borschueren/kooperationjuaschule.pdf
06. Mai 2005 / Internet: www.ejwue.de/jugendpolitik/
upload/kriterien_jugendarbeit_und_schule.pdf
06. Mai 2005 / Internet: www.jugendfoerderwerk.de/
contentpapst/texte/arbeitshilfe-gts.pdf
164. INSTITUTIONALISIERUNG
DER ZUSAMMENARBEIT
VON JUGENDARBEIT UND SCHULE
Die Stellenkonzepte in vielen Schulen lassen vermu- sich beide Bereiche zur Zusammenarbeit, stecken
ten, dass eine Kooperation zwischen Jugendarbeit ihre Kompetenzen ab und regeln Detailfragen. Ein
und Schule von Seite der Schule gewünscht wird, solcher Vertrag zwischen offener Kinder- und
denn in der Regel sehen diese Konzepte durchaus Jugendarbeit und Schule ist auf Jugendarbeitsseite
Tätigkeiten im Bereich der Pädagogik und der vom Träger und auf der Schulseite von der Schule
Schulentwicklung vor. Dass es in der Praxis relativ und der Schulkommission abzuschliessen. Insbe-
selten zur umfassenden Umsetzung dieser präventi- sondere müssen rechtliche und organisatorische
ven Funktion der offenen Kinder- und Jugendarbeit Bedingungen vertraglich geregelt werden (z.B.
in der Schule kommt, mag damit zusammenhängen, Zuständigkeiten, formale Kompetenzen, konzeptio-
dass der Erfolg der betreffenden Tätigkeiten an die nelle Aspekte, Formen der Zusammenarbeit, Wahr-
Kooperation mit den Lehrkräften gebunden ist und nehmung der Verantwortung, Fortbildung etc.).
diese Kooperation oft nicht in gewünschtem Aus-
mass möglich ist. Dafür kann es verschiedene Auch die Finanzierung muss geklärt werden. Das
Gründe geben: Prinzip der gemeinsamen Verantwortung erfordert,
dass beide Seiten zur finanziellen Absicherung bei-
• Fehlende finanzielle und zeitliche Ressourcen tragen.
behindern Absprachen und Abstimmungen
unter den Berufsgruppen.
• Unklare Zuständigkeiten und 4.1 Standards der Zusammenarbeit
Entscheidungskompetenzen. • Die Interessen der beiden Parteien – Schule
• Mangelnde gegenseitige Bereitschaft, sich und Jugendarbeit – sind abgeklärt.
auch in die Rolle des anderen zu versetzen. • Die Kooperation ist von beiden Seiten gewollt.
Man geht von der Erfüllung der eigenen Auf- • Die verschiedenen Mitglieder des lokalen
gabe aus und klammert das Denken und die Netzwerks «Bildung» (Elternrat, Schulkom-
Aufgabe der anderen Berufsgruppen aus. mission, Vormundschaftsbehörde, heilpädago-
• Fachliche Rolle, Funktion und die Ziele der gisches Ambulatorium etc.) sind mit in die
offenen Kinder- und Jugendarbeit sind zu Überlegungen der Kooperation einbezogen.
wenig bekannt. • Die beiden Partnerinnen Schule und
Jugendarbeit sind gleichberechtigt.
Damit dieses Konfliktpotential entschärft werden • Eine abgesicherte Kontinuität und die Nach-
kann, braucht es die Benennung der obengenann- haltigkeit des Projekts werden angestrebt.
ten Barrieren und die Institutionalisierung der • Die Professionalität wird von der Schule und
Zusammenarbeit, das heisst es braucht Aufträge, der Jugendarbeit weiterentwickelt. Dabei wird
Verträge, Pflichtenhefte und klare Strukturen. berücksichtigt, dass für die unterschiedlichen
Berufsgruppen je eigene Perspektiven auf
Zusammenarbeitsverträge können vor Ort vor allem Situationen, Zusammenhänge und Menschen
durch Vereinbarungen und Kontakte zwischen den erforderlich sind.
Beteiligten geschaffen werden. Darin verpflichten
174.2 Anforderungen
Damit Schule und offene Jugendarbeit erfolgreich
zusammenarbeiten können, ist es sinnvoll, vorher
folgende Fragen zu stellen:
• Welches sind die Interessen der beiden Parteien • Die Zusammenarbeit zwischen Jugendarbeit
Schule und Jugendarbeit? Ist absehbar, dass bei- und Schule hat nur dann Aussicht auf Erfolg,
de Seiten auf ihre Kosten kommen und dadurch wenn das Projekt von der Konzeptionsentwick-
Gewinn aus der Kooperation ziehen können? lung bis zur weiteren Profilierung kein einseiti-
• Ist die Kooperation beiderseits gewollt? ger Akt ist, sondern als partnerschaftlicher
• Sind Schülerinnen und Schüler sowie Eltern, Prozess erfolgt.
aber auch die Schulkommission, die Vormund- • Werden Verantwortungsübernahme und Kom-
schaftsbehörden, das heilpädagogische Ambu- petenzen wechselseitig zugestanden und die
latorium und andere PartnerInnen des lokalen Kontrolle gemeinsam verabredet?
Netzwerks «Bildung» mit in die Überlegungen • Die unterschiedlichen Berufsgruppen mit je ei-
einbezogen? Wird die angestrebte Kooperation genen Perspektiven auf Situationen, Zusam-
auch von diesen Stellen unterstützt? menhänge und Menschen erfordern, dass die
• Sind die beiden Partner Schule und Jugendar- Professionalität auch gemeinsam weiterentwi-
beit gleichberechtigt? Gestehen sich die Partner ckelt wird. Mehrperspektivität ist in diesem Fall
die jeweils andere Fachkompetenz zu? ein Gewinn und kommt der Gestaltung einer
• Kooperationsbemühungen machen dann Sinn, kinder- und jugendgerechten Schule zugute.
wenn sie nicht nur Augenblicksprojekte sind. Werden gemeinsame Fortbildungen für schul-,
Wie steht es um die angestrebte und abgesi- sozial- und gemeindepädagogische Fachkräfte
cherte Kontinuität und Nachhaltigkeit des Pro- durchgeführt oder geplant? Sind dafür ausrei-
jekts? Ist langfristige Arbeit auch finanziell und chend Mittel vorhanden? Befürwortet das auch
personell sichergestellt? die Schulkommission?
184.3 Checkliste zur Aufnahme
der Zusammenarbeit
Damit die Kinder- und Jugendarbeit in der Schule Fuss
fassen kann, gilt es folgende Punkte zu klären:
A: Wie sieht der Auftrag der Kinder- und Jugendarbeit innerhalb des Quartiers oder
der Gemeinde aus? Dazu hilft ein Blick ins Pflichtenheft der Kinder- und Jugendarbeit.
B: Wie sieht die zeitliche Kapazität der Kinder- und Jugendarbeit aus, um Projekte
und Angebote innerhalb der Schule anzubieten?
C: Wie sehen die fachlichen Ressourcen der Kinder- und Jugendarbeitenden aus,
um mögliche Projekte und Angebote innerhalb der Schule anzubieten?
D: Wie sehen die finanziellen Ressourcen der Kinder- und Jugendarbeit aus?
Je nach Projekt und Angebot sind diese mit Kosten verbunden (Material, externe
Fachpersonen, Fahrkosten, eventuell spezielle Räumlichkeiten etc.). Ist es der
Kinder- und Jugendarbeiterstelle möglich, Projekte im Rahmen des regulären
Budgets durchzuführen, oder benötigt es zusätzliche finanzielle Ressourcen? Sollte
aus den Verhandlungen mit den Schulverantwortlichen ersichtlich werden, dass ein
spezielles Bedürfnis seitens der Schule besteht (z.B. Gesundheits- und Präven-
tionskurse in sämtlichen 5. bis 9. Klassen), muss verhandelt werden, ob die Schule
sich finanziell beteiligen oder ob das Budget der Jugendarbeiterstelle diesbezüglich
erhöht werden kann.
E: Wenn die Punkte A bis D geklärt sind, kann mit der Vorarbeit begonnen werden.
Diese kann auch aus kleineren Projekten oder Angeboten bestehen, die im Rahmen
des Schulbetriebs getätigt werden (siehe dazu Kapitel 6: Angebote und Produkte der offenen
Kinder- und Jugendarbeit gegenüber der Schule).
F: Bevor die Kontaktaufnahme mit den zuständigen Personen der Schule getätigt
wird, ist es sinnvoll, sich Gedanken darüber zu machen, welche Projekte oder
Angebote die Kinder- und Jugendarbeiterstelle anbieten kann und welches
Alterssegment man ansprechen will. Es ist hilfreich, sich ein Bild über die Situation
der Kinder und Jugendlichen im Quartier oder der Gemeinde zu verschaffen, um
Brennpunkte aufnehmen zu können. Zudem muss geklärt sein, ob es in den entspre-
chenden Schulhäusern eine Schulsozialarbeiterstelle bereits gibt. Sollte dies der Fall
sein, gilt es Angebote zu erstellen, die ergänzend zu der Schulsozialarbeit sind. Ein
Gespräch mit der zuständigen Person der Schulsozialarbeit bezüglich möglicher
Lücken oder Bedürfnisse innerhalb der Schule ist unumgänglich! Es ist sinnvoll, im
Alterssegment Mittelstufe einzusteigen, um Beziehungsarbeit zu leisten, damit die-
se in der Oberstufe wissen, an wen sie sich wenden können, wenn sie Unterstützung
brauchen.
G: Sind mögliche Projekte oder Angebote im Grundgerüst erstellt, gilt es, Kontakt
mit den zuständigen Personen der Schule aufzunehmen. Dazu müssen folgende
Informationen eingeholt werden:
• Welcher Stelle ist die Kinder- und Jugendarbeiterstelle unterstellt? Beste
Voraussetzung bietet die Unterstellung unter den Gemeinderat. Sollte dies nicht
der Fall sein, gilt es abzuklären, ob und wie allenfalls der Gemeinderat in die
Kinder- und Jugendarbeit einbezogen ist.
• Wer ist die vorgesetzte Person seitens der Schule? Bei der Gemeinde herausfin-
den, wer das Ressort Bildung betreut und wer das Präsidium der Schulkom-
mission führt.
• Wer ist die zuständige Schulleitungsperson auf der Ober- und Mittelstufe?
Diese Personen können Anliegen und Informationen weiterleiten und ermög-
lichen, dass die Kinder- und Jugendarbeit in der Schule Fuss fassen kann.
• Sind der Schule auch Kleinklassen angegliedert? Kleinklassen sind nicht im
Rahmen des regulären Schulbetriebs, sondern meist als Kleinklassenverbund or-
ganisiert, und sind anderen Personen unterstellt. Diese gilt es ebenfalls ausfin-
dig zu machen, um auch in diesen Klassen tätig zu sein.
19• Gibt es eine Früherfassungs- oder Präventionsgruppe innerhalb der (Schul-)Ge-
meinde? In verschiedenen Gemeinden oder Schulgemeinden gibt es Früher-
fassungsgruppen oder eine Fachgruppe Prävention. In solchen Gruppen sind
meist zuständige Gemeinderäte, Schulkommissionsmitglieder, Schulleitungs-
personen und Personen aus dem Bereich Sozialarbeit vertreten. In dieser
Gruppe werden Themen zur Prävention erarbeitet und Ideen entwickelt, zudem
wird über Kinder und Jugendliche, die negativ auffallen, gesprochen. In dieser
Gruppe Einsitz zu bekommen, wäre sehr hilfreich für die Zusammenarbeit mit
der Schule und ermöglichte die Einbringung der Perspektive des Freizeitbereichs
von Kindern und Jugendlichen.
H: Kommunikation / Arbeitsauftrag einholen:
Wenn die Punkte im Abschnitt G geklärt sind, kann die Verhandlung beginnen.
Wichtig ist, das Gespräch möglichst mit dem Gemeinderat zu führen, evtl. in
Begleitung der vorgesetzten Person der Kinder- und Jugendarbeiterstelle. Professio-
nelles Auftreten ist wichtig! Es geht darum, die Stärken und Ressourcen der Kinder-
und Jugendarbeiterstelle aufzuzeigen und am Auftrag festzuhalten. Es geht darum,
dass die leitenden Personen der Schule realisieren, dass die Kinder- und Jugend-
arbeiterstelle für sie ausserordentlich interessant ist. Die Kinder- und Jugendarbeit
kann Teilbereiche abdecken und die Lehrpersonen und die Schulsozialarbeit unter-
stützen. Verhandlungen mit einzelnen Lehrpersonen können für Teilaufgaben und
Kurzaufträge gut sein, nicht aber für die Institutionalisierung der Kinder- und
Jugendarbeit im Bereich Schule.
I: Arbeitsauftrag gegenüber den Lehrpersonen kommunizieren:
Wichtig ist, Aufträge nicht nur mündlich zu kommunizieren,
sondern schriftlich festzuhalten.
Die folgenden Punkte müssen im Arbeitsauftrag klar geregelt werden:
• Ziel des Auftrages
• Kompetenzen der Kinder- und Jugendarbeit
• Rahmenbedingungen und finanzielle Aspekte des Angebots
• Ansprechperson für die Kinder- und Jugendarbeitenden bei Problemen
• Verbindlichkeit und Regelmässigkeit des Angebots
• Abläufe und Prozedere sind klar festgehalten
• Grenzen der Kinder- und Jugendarbeitenden sind formuliert und
transparent gemacht
Der Gemeinderat muss zusammen mit dem Schulkommissionspräsidium die
Lehrpersonen über ein mögliches Angebot informieren. Die Kinder- und Jugend-
arbeitenden können, nachdem die Lehrpersonen offiziell über die Zusammenarbeit
und die klare Aufgabenstellung informiert wurden, sich dem Kollegium an einer
Konferenz vorstellen.
K: Kommunikation aufrechterhalten:
Ein regelmässiger Austausch mit den Schulleitungspersonen ist für die Arbeit in der
Schule unumgänglich. Es ist hilfreich, wenn die Kinder- und Jugendarbeitenden regel-
mässig im Lehrerzimmer sind und die Beziehung zu den Lehrkräften pflegen.
Informationen über die Angebote der Kinder- und Jugendarbeiterstelle allgemein
können ebenfalls in der Elternpost oder im Infoblatt der Schule eingebracht werden.
204.4 Hilfreiche Tipps
für die Zusammenarbeit
mit der Schule
• Die Schlüsselpersonen im System Schule soll- • Öffentlichkeitsarbeit und Informationsaus-
ten bekannt sein und die Kontakte entspre- tausch zu planen und sich an den Zeitplan zu
chend gepflegt werden. Wichtige Personen sind halten, erleichtert die Zusammenarbeit.
die Schulleitung, ältere und/oder erfahrene • Es braucht Kontinuität.
Lehrpersonen (informelle Machtträger) und der • Es ist von Vorteil, die Lehrpersonen nicht mit
Hauswart oder die Hauswartin. Angeboten zu überhäufen und in Absprache
• Es ist wichtig, die Organigramme, Zuständig- mit ihnen Abläufe wie das Verteilen von Flyern
keiten und Abläufe zu kennen, z. B. ob es an der oder das Versenden eines Elternbriefes zu pla-
Schule eine/n Gesundheitsbeauftragte/n gibt. nen und die Abmachungen einzuhalten.
• Es ist nützlich, sich bei einem neuen Mitarbei-
ter oder einer neuen Mitarbeiterin vorzustellen.
5. ANGEBOTE UND PRODUKTE DER
OFFENEN KINDER- UND JUGEND-
ARBEIT GEGENÜBER DER SCHULE
5.1. Pausenplatzaktionen 5.4 Gesundheitsförderung
Die Kinder- und Jugendarbeitenden konfrontieren und Präventionskurse
die Schülerinnen und Schüler auf dem Pausenplatz Die Kinder- und Jugendarbeitenden führen inner-
gezielt mit themenspezifischen Aktionen (wzB.: ge- halb von Schulklassen der Mittel- und Oberstufe
sunde Ernährung, Suchtproblematik, Bewegung im Lektionen zu den Themen Sucht, Liebe, Sexualität
Alltag etc.). und Gesundheit durch. Dies kann in institutionali-
sierter Form, aber auch gezielt auf Anfrage einer
Die Kinder- und Jugendarbeitenden stehen den Lehrperson hin geschehen.
Schülerinnen und Schülern für einen «Schwatz» zur
Verfügung und fördern dadurch den Beziehungs- 5.5 Soziale Gruppenarbeit
aufbau. Die Kinder- und Jugendarbeitenden können in
schwierigen Klassensituationen der Lehrperson
5.2. Öffentlichkeitsarbeit Hilfe anbieten und themenspezifisch mit der Klasse
im Klassenzimmer arbeiten. Bestehende Beziehungen seitens der
Die Kinder- und Jugendarbeit aus dem Einzugs- Kinder und Jugendlichen zu den Kinder- und Jugend-
gebiet des Schulkreises stellt sich und ihr Angebot arbeitenden sind in solchen Situationen oftmals för-
den Klassen vor. derlich.
5.3 Schullager 5.6 Mitwirkung bei
Die Kinder- und Jugendarbeitenden begleiten gezielt Anlässen der Schule
Schulklassen in Klassenlager (Wintersportlager, Sporttage, Tage der offenen Tür, Projektwochen,
Landschulwochen etc.). Sie können den Lehr- Schulfestivitäten, Elternabende etc. Die Kinder- und
personen bei schwierigen Klassensituationen Hilfe Jugendarbeitenden können sowohl personelle als
bieten (Streitschlichtungsprogramme, Gewaltprä- auch fachliche Ressourcen mit einbringen und ent-
ventionskurse, SchülerInnenmediation etc.). lastend sowie unterstützend bei solchen Anlässen
mitwirken.
Ausserdem lernen die Kinder- und Jugendarbei-
terInnen alle Kinder und Jugendlichen einer Klasse
kennen.
21Sie können auch lesen