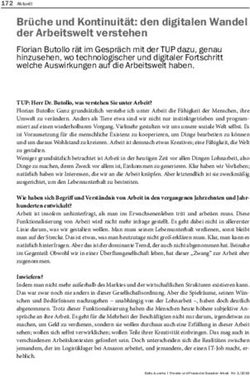Leitfaden für wissenschaftliches Arbeiten am Lehrstuhl für Grundschulpädagogik und Grundschuldidaktik - Stand: Mai 2017
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Fakultät für Humanwissenschaften
Institut für Pädagogik
Lehrstuhl für Grundschulpädagogik
und Grundschuldidaktik
Leitfaden für wissenschaftliches Arbeiten
am Lehrstuhl für Grundschulpädagogik
und Grundschuldidaktik
Stand: Mai 2017INHALTSVERZEICHNIS
1. Allgemeine Hinweise ...................................................................................................... 2
1.1 Zitationsgrundlage ................................................................................................... 2
1.2 Abgabe der Arbeit ................................................................................................... 2
2. Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten ................................................................ 2
2.1 Umfang und Formatierung der Arbeit ...................................................................... 2
2.2 Struktur wissenschaftlicher Arbeiten ........................................................................ 3
2.3 Abbildungen und Tabellen ....................................................................................... 5
2.4 Fußnoten................................................................................................................. 6
2.5 Gendersensible Sprache ......................................................................................... 6
3. Zitierregelwerk ................................................................................................................ 6
3.1 DGPs-Zitierweise: Kurzbeleg im Fließtext ............................................................... 6
3.1.1 Einzelne Quelle ................................................................................................ 7
3.1.2 Mehrere Quellen .............................................................................................. 7
3.1.3 Fortlaufende Zitation aus gleicher Quelle ......................................................... 8
3.1.4 Mehrere Angaben in einem Klammerausdruck ................................................. 9
3.2 Primär- und Sekundärliteratur ................................................................................. 9
3.3 Verweisarten ..........................................................................................................10
3.3.1 Indirektes Zitat.................................................................................................10
3.3.2 Direktes Zitat ...................................................................................................10
3.4 Literaturverzeichnis ................................................................................................11
3.4.1 Abkürzungen im Literaturverzeichnis ...............................................................12
3.4.2 Reihenfolge der Werke im Literaturverzeichnis ...............................................12
3.4.3 Autor/-innenangaben .......................................................................................13
3.4.4 Elemente des Literaturverzeichnisses .............................................................13
4. Wissenschaftliche Präsentationen .................................................................................15
4.1 Formatierung ..........................................................................................................15
4.2 Inhaltliche Anforderungen.......................................................................................151. ALLGEMEINE HINWEISE
1.1 ZITATIONSGRUNDLAGE
Der folgende Leitfaden basiert auf den „Richtlinien zur Manuskriptgestaltung“ (2007) der Deut-
schen Gesellschaft für Psychologie (DGPs). Er stellt eine Orientierungshilfe für die Anfertigung
wissenschaftlicher Arbeiten sowie für die Erstellung von Präsentationen im Rahmen von Lehr-
veranstaltungen dar.
1.2 ABGABE DER ARBEIT
Der Abgabetermin wird von den Dozierenden individuell in der Lehrveranstaltung bekannt
gegeben. Die wissenschaftliche Arbeit wird in Papierform abgegeben.
2. ANFORDERUNGEN AN WISSENSCHAFTLICHE ARBEITEN
2.1 UMFANG UND FORMATIERUNG DER ARBEIT
Der Umfang von Hausarbeiten umfasst in der Regel 15-20 Seiten. Bei schriftlichen Ausarbei-
tungen eines Referats dienen ca. 10 Seiten als Orientierungsgröße. Zulassungsarbeiten soll-
ten ca. 50-70 Seiten enthalten. Entscheidend ist die Absprache mit der betreuenden Person.
Formatierungshinweise
Die folgenden Formatierungshinweise dienen der Orientierung:
Schriftart Arial/Times New Roman
Schriftgröße Text Arial: 11 Punkt; Times New Roman: 12 Punkt
Schriftgröße Fußnoten Arial: 9 Punkt; Times New Roman: 10 Punkt
Zeilenabstand 1.5 Zeilen
Ausrichtung Blocksatz
Rand oben, unten und rechts: 2 cm; links: 2.5 cm
Alle Seiten werden nach dem Titelblatt fortlaufend arabisch durchnummeriert.
22.2 STRUKTUR WISSENSCHAFTLICHER ARBEITEN
Aufbau Inhalt
Angabe der Veranstaltung: Universität, Fakultät, Lehr-
stuhl, Lehrveranstaltung, Dozent/-in, Semester
Deckblatt
Vollständiger Titel der Arbeit
Angabe zur Person des Autors: Vollständige An-
schrift, Studiengang, Fächer, Fachsemester, evtl.
Mailadresse
Ort und Datum der Abgabe
Eine Vorlage für das Deckblatt finden Sie auf der
Homepage des Lehrstuhls für Grundschulpädagogik
und -didaktik
verdeutlicht inhaltliche Gliederung der Arbeit und ge-
danklichen Aufbau
Gliederung mit Neben- und Unterpunkten in logisch
einwandfreier Form
Inhaltsverzeichnis Gliederungssystem: Dezimalklassifikation
Überschriften: Nominalstil
Seitennummerierung angeben, beginnt mit Einleitung
Überschriften im Inhaltsverzeichnis entsprechen wört-
lich den Überschriften im Text
Hinführung zum Thema
Ziel der Arbeit
Einleitung
kurzer Überblick über den Aufbau der Arbeit
Eingrenzung des Themas
Klärung zentraler Begriffe
Darstellung der zentralen Forschungsfrage der Arbeit
Darstellung relevanter theoretischer Aspekte
Hauptteil Darstellung des aktuellen Forschungsstandes
Fundierung der Aussagen durch Anbindung an ein-
schlägige Theorien und Forschungsbefunde
argumentative Gedankenführung
Zusammenfassung der wichtigsten Aussagen der Ar-
Zusammenfassung
beit in Bezug auf die Fragestellung
3 Aufgreifen des Ziels der Arbeit
Kritische und reflektierte Auseinandersetzung mit dem
Diskussion Ergebnis der Arbeit (= Beantwortung der Forschungs-
(gilt vorrangig für frage)
Hausarbeiten und Zu-
lassungsarbeiten) Diskussion der Chancen und Grenzen der Arbeit
Darstellung der (didaktischen) Implikationen der Ar-
beit
Ausblick auf neu entstandene Fragestellungen in der
Auseinandersetzung mit dem Thema
Ausblick
Darstellung offener Fragen im Zusammenhang mit
dem Thema
ggfs. Transkripte, Leitfaden oder komplexe Abbildun-
gen und Tabellen, die für das Verständnis des Fließ-
texts nicht zwingend nötig sind
Eidesstattliche Erklärung (Vorlage siehe Homepage
des Lehrstuhls für Grundschulpädagogik
Anhang und -didaktik)
Nummerierung des Anhangs durch Großbuchstaben
in alphabetischer Reihenfolge auf der ersten Seite
des Anhangs (z.B. A B C …)
Anhang als Gliederungspunkt im Inhaltsverzeichnis
nach der Literatur
Einleitung
Die Einleitung der wissenschaftlichen Arbeit dient dazu, zu einem Thema hinzuführen und das
Interesse zu wecken. Bereits innerhalb der Einleitung soll das Ziel der Arbeit vermittelt und ein
kurzer Überblick über den Aufbau gegeben werden.
Hauptteil
Im Hauptteil wird sowohl bei theoriebasierten als auch bei empirischen Arbeiten eine For-
schungsfrage bzw. Problemstellung aufgegriffen und untersucht. Dabei ist es essenziell, die
Forschungsfrage als eigenen Gliederungspunkt darzustellen und sie als Frage zu formulieren.
Anhand einschlägiger Theorien und Forschungsbefunde soll die Problemstellung bzw. die
Forschungsfrage geklärt werden. Empirische und theoriebasierte Arbeiten unterscheiden sich
bezüglich der Forschungsfrage lediglich in ihrer Lokalisation im Aufbau der Arbeit. Während in
theoriebasierten Arbeiten die Forschungsfrage zu Beginn des Hauptteils gestellt wird, schließt
sie in empirischen Arbeiten den Theorieteil ab.
4Diskussion
Eine hohe Bedeutung kommt in allen wissenschaftlichen Arbeiten der Diskussion zu, die aus-
führlich und reflektiert zu gestalten ist. In der Diskussion findet eine kritische Auseinanderset-
zung mit dem Ergebnis der Arbeit (= Beantwortung der Forschungsfrage) statt, wobei auch
Chancen und Grenzen der Arbeit erörtert werden sollen.
„Roter Faden“
Grundsätzlich ist darauf zu achten, eine wissenschaftliche Arbeit stringent aufzubauen und
den „roten Faden“ beizubehalten. Gerade auch die einzelnen Gliederungspunkte müssen sys-
tematisch aufeinander aufbauen und auf die Klärung der Forschungsfrage abzielen. Eine ar-
gumentative Gedankenführung sollte klar erkennbar sein, wobei es sinnvoll ist, Aussagen
durch Theorien und Forschungsbefunde zu untermauern. Eine korrekte Zitation ist in diesem
Kontext zwingend geboten.
Abbildungs-, Tabellen- und/oder Abkürzungsverzeichnis
Bei Bedarf ist die Arbeit mit einem Abbildungs-, Tabellen- und/oder Abkürzungsverzeichnis zu
versehen. Diese werden nach dem Inhaltsverzeichnis aufgeführt.
Eidesstattliche Erklärung
Die Arbeit ist mit einer unterzeichneten eidesstattlichen Erklärung im Anhang abzugeben (Vor-
lage siehe Homepage des Lehrstuhls für Grundschulpädagogik und -didaktik).
2.3 ABBILDUNGEN UND TABELLEN
Abbildungen (Grafiken, Diagramme, Fotografien, Schaubilder usw.) und Tabellen sollen ein-
gesetzt werden, um komplexe Inhalte verständlich darzustellen. Wichtig ist hierbei, Abbildun-
gen und Tabellen hinsichtlich der Ausdrucksweise, des Formates und der Beschriftung einheit-
lich zu gestalten
Alle in der wissenschaftlichen Arbeit verwendeten Abbildungen und Tabellen werden fortlau-
fend nummeriert und mit einer Beschriftung versehen. Bei Tabellen wird die kurze, prägnante
Überschrift über der Tabelle platziert, bei Abbildungen wird der jeweilige Titel unter der Abbil-
dung platziert. Übernommene Tabellen oder Abbildungen sind durch Quellenangaben (unter
der Tabelle bzw. Abbildung) kenntlich zu machen. Tabellen und Abbildungen, die nicht zentral
für das Verständnis des Textes sind, sind in den Anhang der Arbeit zu stellen.
52.4 FUßNOTEN
Anhand von Fußnoten können Informationen zum Inhalt ergänzt werden, die im Fließtext den
Lesefluss stören würden. Fußnoten sind generell sparsam einzusetzen und nicht als Zitati-
onsweise zu verwenden. Alle Fußnoten werden mit hochgestellten arabischen Ziffern fortlau-
fend durchnummeriert.
2.5 GENDERSENSIBLE SPRACHE
In allen wissenschaftlichen Arbeiten ist auf gendersensible Sprache zu achten, in der Frauen
und Männer gleichermaßen angesprochen werden. Dies kann durch geschlechtsspezifische
Ausdrücke (z.B. Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten) oder geschlechts-
neutrale Personenbeschreibungen (z.B. Lehrkräfte, Lehrpersonen, Seminarleitung) umgesetzt
werden. Auch eine Sparschreibung (z.B. Binnen-I „SchülerInnen“, Schrägstriche mit Binde-
strich „Schüler/-innen“) ist grundsätzlich vertretbar. Dabei ist auf eine einheitliche Handhabung
der gewählten Form im Rahmen der gendersensiblen Sprache zu achten.
3. ZITIERREGELWERK
Als elementares Prinzip wissenschaftlichen Arbeitens gilt es, die Herkunft einer Aussage
durch die Angabe der Quelle zu belegen und eigene Argumentationen von herangezogenen
Sachverhalten zu unterscheiden. Übernommenes, fremdes Gedankengut ist dabei stets als
solches zu kennzeichnen. In diesem Kontext ist bei der Zitation darauf zu achten, den ur-
sprünglichen Sinn einer Aussage nicht zu verfälschen. Generell ist alle zitierte Literatur, die im
Fließtext angegeben wird, im Literaturverzeichnis aufzuführen. Nicht zitierte Quellen werden
nicht im Literaturverzeichnis erfasst. Quellenangaben sollten aus der jeweils neuesten Auflage
eines Werkes entnommen werden.
3.1 DGPS-ZITIERWEISE: KURZBELEG IM FLIEßTEXT
Grundsätzlich wird die Quelle im Text direkt im Anschluss an das Zitat in einer Klammer wie-
dergegeben, in der der Nachname der Verfasserin bzw. des Verfassers, das Erscheinungsjahr
sowie die Seitenzahl aufgeführt werden (Beispiel: Helmke, 2009, S. 210).
Bei mehrseitigen Textstellen werden die exakten Seitenzahlen angegeben (Beispiele: S. 10-
12; S.21-22). Die Seitenangabe entfällt nur dann, wenn sich die zitierte Aussage nicht auf eine
einzelne bzw. mehrere Textstellen zurückführen lässt, sondern der Kernaussage eines Wer-
kes entspricht.
63.1.1 EINZELNE QUELLE
Im Fließtext werden der Nachname der Autorin/des Autors bzw. der Autor/-innen sowie das
Erscheinungsjahr und die Seitenzahl in Klammern angegeben. Die Seitenangabe, die mit „S.“
abgekürzt wird und mit der jeweiligen Seitenzahl endet, erfolgt nach einem Komma nach dem
Erscheinungsjahr.
Im schulischen Schreibunterricht ist eine klare Definition der Kommunikationssituation von ho-
her Bedeutung (Schneuwly,1996, S. 31).
Wenn der Name der Autorin bzw. des Autors bereits im Fließtext genannt wird, wird nach der
Angabe lediglich das Erscheinungsjahr mit der Seitenangabe in Klammern gesetzt:
Nach Schneuwlys These (2009, S. 31) zum schulischen Schreibunterricht…
3.1.2 MEHRERE QUELLEN
Zwei Autor/-innen
Ein Werk von zwei Autor/-innen wird immer unter Angabe beider Namen zitiert. Innerhalb der
Klammern, in Tabellen sowie im Literaturverzeichnis werden die Namen durch das Et-Zeichen
„&“ verbunden:
Das Erfassen von Textqualität nach empirischen Gütekriterien weist in der Fachdidaktik keine
lange Tradition auf (Becker-Mrotzek & Schindler, 2008, S. 100).
Werden die Namen im Fließtext genannt, wird das Et-Zeichen „&“ durch das Wort „und“ er-
setzt:
Becker-Mrotzek und Schindler (2008, S. 100) zufolge weist das Erfassen von Textqualität…
Drei bis fünf Autor/-innen
Bei mehr als zwei, aber weniger als sechs Autor/-innen werden bei der ersten Nennung alle
Autor/-innen in der Klammer genannt, wobei die Nachnamen durch Kommata voneinander ge-
trennt werden (z.B. Autor/-in, Autor/-in, Autor/-in, Autor/-in & Autor/-in, 2012). Zwischen dem
vorletzten und letzten Namen wird innerhalb der Klammer das Et-Zeichen „&“ verwendet, im
Fließtext das Wort „und“ angegeben:
7Beim ersten Auftreten
Die Konzeption „Schreiben als kulturelle Tätigkeit“ (Dehn, Merklinger & Schüler, 2011) sieht
vor, …
Nach Maier, Bohl, Kleinknecht und Metz (2013, S. 36-37) sind Aspekte lernförderlicher Aufga-
ben beispielsweise der Lebensweltbezug bzw. die Authentizität.
Bei weiteren Verweisen
Nach der ersten Nennung wird bei weiteren Verweisen ab einschließlich drei Autor/-innen nur
die erste Autorin bzw. der erste Autor in der Klammer angegeben, gefolgt von einem „et al. (la-
teinisch für „und andere“) und dem Erscheinungsjahr sowie der Seitenzahl. Zwischen „et al.“
und dem Erscheinungsjahr wird ein Komma gesetzt.
(Dehn et al., 2011, S. 80)
(Maier et al., 2013, S. 35)
Die Abkürzung „et al.“ wird ausschließlich in Klammern verwendet. Im Fließtext werden die
Ausdrücke „und andere“ oder „und Kollegen“ angeführt.
Nach Dehn und Kolleginnen (2011, S. 80) …
Maier und anderen (2013, S. 35) zufolge …
Ab sechs Autor/-innen
Bei einem Werk von sechs oder mehr Autor/-innen wird stets die Erstautorin/ der Erstautor
angegeben, gefolgt von et al. und dem Erscheinungsjahr. Im Literaturverzeichnis werden die
ersten sechs Autorinnen bzw. Autoren angegeben und alle weiteren durch ein „et al.“ ersetzt.
3.1.3 FORTLAUFENDE ZITATION AUS GLEICHER QUELLE
Wird auf die gleiche, unmittelbar zuvor genannte Quelle (unabhängig von der Anzahl der Au-
tor/-innen und der Verweisart) erneut verwiesen, erfolgt in Klammern die Abkürzung „ebd.“,
anstatt den Namen der Autorin bzw. des Autors und das Erscheinungsjahr bzw. die Seitenan-
gabe zu wiederholen. Ebd. steht für ebenda.
Die Seitenangabe wird nur dann erneut angegeben, wenn sich die weitere zitierte Aussage auf
eine andere Seitenzahl bezieht.
Nach Maier, Bohl, Kleinknecht und Metz (2013, S. 36-37) sind Aspekte lernförderlicher Aufga-
ben beispielsweise der Lebensweltbezug bzw. die Authentizität. Aber auch die Offenheit der
Aufgabenstellung (ebd., S. 34-36) gehört zu den entscheidenden Merkmalen.
83.1.4 MEHRERE ANGABEN IN EINEM KLAMMERAUSDRUCK
Grundsätzlich werden Angaben von mehreren Werken in einer Klammer in der Reihenfolge
dargestellt, in der sie auch im Literaturverzeichnis angeführt werden.
Zwei oder mehrere Werke derselben Autorin bzw. desselben Autors
Zwei oder mehrere Werke derselben Autorin bzw. desselben Autors werden nach dem Er-
scheinungsjahr gereiht und durch Kommata abgetrennt, wobei der Name der Autorin bzw. des
Autors nur einmal erscheint.
Helmke (2009, 2014)
(Helmke, 2009, 2014)
Werke derselben Autorin bzw. desselben Autors aus demselben Erscheinungsjahr
Werke derselben Autorin bzw. desselben Autors aus demselben Erscheinungsjahr werden mit
den Zusätzen a, b, c usw. direkt nach dem Erscheinungsjahr angegeben. Die Reihung dieser
Zusätze orientiert sich an der Reihenfolge der Werke im Literaturverzeichnis. Im
Literaturverzeichnis werden sie innerhalb desselben Erscheinungsjahres alphabetisch
geordnet. Diese Regelung gilt auch bei mehreren Autor/-innen.
(Nussbaumer & Sieber, 1994a,1994b)
Zwei oder mehrere Werke verschiedener Gruppen von Autor/-innen
Zwei oder mehrere Werke verschiedener Gruppen von Autor/-innen werden alphabetisch nach
dem Nachnamen der Erstautorin bzw. des Erstautors angeführt und nicht nach dem
Erscheinungsjahr sortiert. Die Angaben zu den verschiedenen Werken werden dabei durch
Semikola voneinander getrennt.
Basierend auf psychologischen Kompetenz-Performanz-Modellen (Erpenbeck & Rosenstiel,
2003; Weinert, 2001)...
3.2 PRIMÄR- UND SEKUNDÄRLITERATUR
Grundsätzlich gilt, nach dem Primärtext (= Originaltext) zu zitieren und Sekundärliteratur zu
vermeiden. Sekundärquellen können allenfalls als Ausnahme dann verwendet werden, wenn
die Primärliteratur nicht zur Einsicht vorliegt. Dies ist durch den Hinweis „zitiert nach“ kenntlich
zu machen, wobei die Sekundärquelle angegeben wird.
(Ehlich, 2003; zitiert nach Bachmann & Becker-Mrotzek, 2010)
Ehlich (2003; zitiert nach Bachmann & Becker-Mrotzek, 2010)
9Im Literaturverzeichnis wird ausschließlich die herangezogene Sekundärquelle anstatt des
Originalwerks erfasst.
3.3 VERWEISARTEN
Grundsätzlich lassen sich zwei Verweisarten unterscheiden: direkte (wörtliche) Zitate und indi-
rekte (sinngemäße) Zitate.
3.3.1 INDIREKTES ZITAT
Bei indirekten Zitaten werden die Aussagen einer Verfasserin bzw. eines Verfassers nicht
wortwörtlich übernommen, sondern sinngemäß wiedergegeben. Sie werden ohne Anfüh-
rungszeichen im Fließtext angegeben und nach der bereits unter 3.1 vorgestellten Zitierweise
(Kurzbeleg im Fließtext) angegeben. Um die Unterscheidung zu einem direkten Zitat deutlich
zu machen, kann auch ein „vgl.“ eingefügt werden.
Im schulischen Schreibunterricht ist eine klare Definition der Kommunikationssituation von ho-
her Bedeutung (vgl. Schneuwly,1996, S. 31).
Über die Position eines Literaturbelegs in einem Satz bzw. Absatz kann deutlich gemacht
werden, auf welchen Satzteil bzw. Absatz sich eine übernommene Aussage bezieht:
Literaturbeleg am Ende eines Satzes: das Zitat verweist auf den ganzen Satz
Literaturbeleg mitten im Satz: das Zitat verweist auf den vorherigen Satzteil
Literaturbeleg am Ende eines Absatzes: das Zitat verweist auf den vorherigen Absatz
3.3.2 DIREKTES ZITAT
Bei direkten Zitaten wird die Aussage einer Autorin bzw. eines Autors wortwörtlich wiederge-
geben. Dabei ist darauf zu achten, dass direkte Zitate in Wortlaut, Orthografie und Interpunkti-
on exakt dem Original entsprechen, selbst bei Fehlern der Quelle. Das Zitat wird in doppelte
Anführungszeichen gesetzt und die Quellenangabe erfolgt im Text direkt nach den Anfüh-
rungszeichen, die das Zitat abschließen. Die Quellenangabe enthält den Nachnamen der Au-
torin bzw. des Autors, das Erscheinungsjahr sowie die Seitenangabe (abgekürzt mit „S.“). Alle
Informationen werden durch Kommata voneinander getrennt. Wird der Name der Autorin bzw.
des Autors unmittelbar vor dem Zitat bereits im Fließtext genannt, werden das Erscheinungs-
jahr und die Seitenangabe hinter dem Namen in Klammern platziert.
„Was hingegen in der gegenwärtigen Diskussion unfreiwillig ins Hintertreffen zu geraten
scheint, ist das Schreiben bzw. die Schreibkompetenz“ (Philipp, 2012, S. 59).
10Philipp (2012, S. 59) stellt fest: „Was hingegen in der gegenwärtigen Diskussion unfreiwillig ins
Hintertreffen zu geraten scheint, ist das Schreiben bzw. die Schreibkompetenz“.
Änderungen direkter Zitate
Alle Veränderungen eines direkten Zitats müssen gekennzeichnet werden.
Fehler im Original sind mit dem Begriff sic (kursiv und in eckigen Klammern gesetzt) [sic] di-
rekt nach der fehlerhaften Stelle anzugeben. Der lateinische Begriff sic steht dabei für „wirklich
so“ bzw. „vollständig“.
„…der Komputer [sic] wird…“ (Deutsche Gesellschaft für Psychologie, 2007, S. 81)
Auslassungen innerhalb eines zitierten Satzes werden durch drei Auslassungspunkte … ge-
kennzeichnet. Eigene Ergänzungen oder Erläuterungen, die nicht von der Originalquelle
stammen, werden in eckige Klammern gesetzt
„Sie [die Experten bzw. Expertinnen] haben…“ (Deutsche Gesellschaft für Psychologie, 2007,
S. 81)
Eigene Hervorhebungen innerhalb des Zitats erfolgen durch Kursivschreibungen, denen in
eckigen Klammern der Hinweis Hervorhebung v. Verf. folgt.
„eine besondere [Hervorhebung v. Verf.] Bedeutung…“ (Deutsche Gesellschaft für Psycholo-
gie, 2007, S. 81)
3.4 LITERATURVERZEICHNIS
Das Literaturverzeichnis dient dazu, die in der wissenschaftlichen Arbeit verwendete Literatur
identifizieren zu können. Literaturangaben müssen korrekt und vollständig wiedergegeben
werden. Jeder Eintrag im Literaturverzeichnis enthält grundsätzlich folgende Aspekte: Autor/-
in, Erscheinungsjahr, Titel und Veröffentlichungsdaten.
Formale Gestaltung
Das Literaturverzeichnis erscheint auf einer neuen Seite in der wissenschaftlichen Arbeit mit
der fortlaufend durchnummerierten Überschrift „Literaturverzeichnis“. Die Formatierung des
Fließtexts (siehe S. 2) ist beizubehalten. Zwischen den einzelnen Literaturangaben wird eine
Zeile Abstand gehalten. Innerhalb einer Literaturangabe wird die zweite Zeile eingerückt (hän-
gender Einzug: 0.6 cm).
11Beispiel:
Helmke, A. (2015). Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und
Verbesserung des Unterrichts (6., aktual. Aufl.). Seelze-Velber: Kallmeyer/Klett.
Augst, G., Disselhoff, K., Henrich, A., Pohl, T. & Völzing, P.-L. (2007). Text - Sorten - Kompe-
tenz. Eine echte Longitudinalstudie zur Entwicklung der Textkompetenz im Grundschulal-
ter. Frankfurt a.M.: Lang.
3.4.1 ABKÜRZUNGEN IM LITERATURVERZEICHNIS
Folgende Abkürzungen können verwendet werden:
Bezeichnung Abkürzung
Kapitel Kap.
Auflage Aufl.
2. Auflage 2. Aufl.
überarbeitete Auflage überarb. Aufl.
erweiterte Auflage erw. Auflage
aktualisierte Auflage aktual. Aufl.
Herausgeber/-innen Hrsg.
Seite S.
Band Bd.
Bände Bde.
Nummer Nr.
Beiheft, Supplement Suppl.
3.4.2 REIHENFOLGE DER WERKE IM LITERATURVERZEICHNIS
Alle Literaturangaben werden alphabetisch nach dem Familiennamen der Autorin bzw.
des Autors geordnet. Mehrere Werke der gleichen Autorin bzw. des gleichen Autors
werden anhand des Erscheinungsjahrs sortiert, wobei die älteste Veröffentlichung zu-
erst genannt wird.
Werke einer Einzelautorin bzw. eines Einzelautors werden vor den Werken mit ande-
ren nachgereihten Autor/-innen angegeben.
12 Werke mit gleicher Erstautorin bzw. gleichem Erstautor werden anhand der alphabeti-
schen Ordnung der zweiten Autorin bzw. des zweiten Autors geordnet.
Werke von Autor/-innen mit gleichen Nachnamen werden alphabetisch nach den Vor-
namen aufgeführt.
3.4.3 AUTOR/-INNENANGABEN
Im Literaturverzeichnis erscheinen die Namen der Autorinnen und Autoren durch Familienna-
men und Initialen der Vornamen. Zuerst werden die Familiennamen genannt, die durch ein
Komma von den Initialen getrennt werden. Die ersten sechs Autor/-innen eines Werkes wer-
den grundsätzlich angeführt, wobei die Namen durch Kommata getrennt werden und vor dem
letzten Namen das Et-Zeichen „&“ ohne Komma gesetzt wird. Ab der siebten Autorin bzw. des
siebten Autors ersetzt ein „et al.“ die nachfolgenden Autor/-innennamen.
Sollten durch diese Vorgehensweise Werke nicht voneinander zu unterscheiden sein, werden
so viele Autor/-innen angegeben, bis die Werke eindeutig zugeordnet werden können.
3.4.4 ELEMENTE DES LITERATURVERZEICHNISSES
Literatureintrag Beispiele
Helmke, A. (2015). Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionali-
tät. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unter-
richts (6., aktual. Aufl.). Seelze-Velber: Kallmeyer/Klett.
Monografien
Augst, G., Disselhoff, K., Henrich, A., Pohl, T. & Völzing, P.-L.
(2007). Text - Sorten - Kompetenz. Eine echte Longitudi-
nalstudie zur Entwicklung der Textkompetenz im Grund-
schulalter. Frankfurt a.M.: Lang.
Deutsche Gesellschaft für Psychologie (Hrsg.). (2007). Richtli-
nien zur Manuskriptgestaltung (3., überarb. und erw. Aufl.).
Göttingen: Hogrefe.
Monografien einer
Baumert, J., Lehmann, R., Lehrke, M., Schmitz, B., Clausen,
Gesellschaft
M., Hosenfeld, I. et al. (Hrsg.) (1997). TIMSS – Mathema-
tisch-naturwissenschaftlicher Unterricht im internationalen
Vergleich. Deskriptive Befunde. Opladen: Leske & Budrich.
13Grabowski, J. (Hrsg.) (2014). Sinn und Unsinn von Kompeten-
Herausgeberwerk zen: Fähigkeitskonzepte im Bereich von Sprache, Medien
und Kultur. Opladen, Berlin & Toronto: Budrich.
Klieme, E., Jude, N., Rauch, D., Ehlers, H., Helmke, A., Eichler,
W. et al. (2008). Alltagspraxis, Qualität und Wirksamkeit
des Deutschunterrichts. In DESI-Konsortium (Hrsg.), Unter-
richt und Kompetenzerwerb in Deutsch und Englisch. Er-
Beitrag in einem Her-
gebnisse der DESI-Studie (S. 319-344). Weinheim: Beltz.
ausgeberwerk
Bachmann, T. & Becker-Mrotzek, M. (2010). Schreibaufgaben
situieren und profilieren. In T. Pohl, & T. Steinhoff (Hrsg.),
Textformen als Lernformen (S. 191-210). Duisburg: Gilles &
Francke.
Klieme, E. & Rakoczy, K. (2008). Empirische Unterrichtsfor-
Periodisch erschei- schung und Fachdidaktik. Outcome-orientierte Messung
nende Zeitschriften und Prozessqualität des Unterrichts. Zeitschrift für Pädago-
gik, 54 (2), 222–237.
Persky, H. R., Daane, M. C. & Jin, Y. (U.S. Department of Edu-
cation, Eds.) (2003). The Nations´s Report Card - NAEP.
Writing 2002, Institute of Education Sciences. Online ver-
Online-Dokumente
fügbar:
http://nces.ed.gov/nationsreportcard/pdf/main2002/2003529
.pdf (Zugriff: 04.10.2016).
144. WISSENSCHAFTLICHE PRÄSENTATIONEN
Für Power-Point-Präsentationen in Lehrveranstaltungen gelten grundsätzlich dieselben Re-
gelungen wie für schriftliche Hausarbeiten. Dementsprechend sind auch Präsentationen
sinnvoll zu gliedern und alle Belege (einschließlich Tabellen und Abbildungen) korrekt zu zi-
tieren.
4.1 FORMATIERUNG
Bei der Formatierung der Folien ist darauf zu achten, eine gut lesbare Schriftgröße zu wählen,
eine einheitliche Schriftart sowie ein relativ schlichtes Design zu verwenden.
Formatierungshinweise (zur Orientierung)
Schriftart: Arial/Times New Roman
Schriftgröße: Arial: Richtwert 24 Punkt; Times New Roman: Richtwert 25 Punkt; Hie-
rarchisierung nach Inhalt (Überschriften größer als Fließtext)
Ausrichtung: Blocksatz
Hervorhebungen sparsam verwenden
4.2 INHALTLICHE ANFORDERUNGEN
Der Aufbau einer Präsentation folgt im Wesentlichen der Struktur einer schriftlichen Arbeit.
So sollte kurz in ein Thema eingeführt sowie das Ziel des Vortrages vorgestellt werden.
Ebenso sollten zentrale Begrifflichkeiten geklärt werden. Nach dem Hauptteil sollten die
Kernaussagen im Schlussteil kurz zusammengefasst und das Fazit herausgestellt werden.
Üblicherweise kann am Ende der Präsentation durch Fragen zu einer Reflexion und Diskus-
sion übergeleitet werden.
Die Folien sollten nicht zu viel Text enthalten und (mit Ausnahme von Definitionen) stich-
punktartig gestaltet sein. Abbildungen und Tabellen sind in Präsentationen eine gute Gestal-
tungsmöglichkeit.
In der nachfolgenden Tabelle wird zur Orientierung ein Überblick über die Struktur von Prä-
sentationen gegeben.
15Struktur der Präsentation Inhalt
Titel des Vortrags, Namen der Vortragenden, Lehrver-
Titelfolie
anstaltung und Datum
Gliederung Grober Überblick über die Struktur des Vortrages
Ziel der Präsentation vorstellen; Überblick über den
gegenwärtigen Forschungsstand geben; Inhalt aus
den gelesenen Werken zum Thema strukturiert wie-
Hauptteil
dergeben; Kernthesen vorstellen; Gemeinsamkeiten
und Unterschiede der verschiedenen Werke heraus-
stellen
Zentrale Aussagen zusammenfassen und ein Fazit
Zusammenfassung und Fazit
zum Ziel des Vortrages geben
Überleitung zur Diskussion und Reflexion im Plenum,
Diskussionsfragen
z.B. durch Fragen oder einen Ausblick
Literaturverzeichnis Darstellung der zitierten Literatur (vgl. S. 11-14)
16Sie können auch lesen