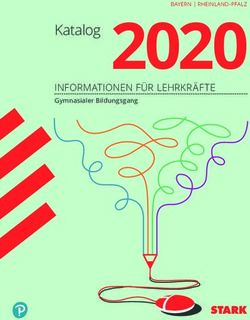Leitfaden zur Anfertigung wissenschaftlicher Arbeiten im Fach Wirtschaft und Ethik: Social Business - Universität Vechta
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Universität Vechta
Wirtschaft und Ethik: Social Business
Leitfaden zur Anfertigung wissenschaftlicher
Arbeiten im Fach
Wirtschaft und Ethik: Social Business
Stand: Mai 2016
Verfasser/in:
Dipl.-Kfm. Jürgen Sander
Eva Maria Spindler B.A.
Verw. Prof. Dr. Christoph SchankWirtschaft und Ethik [Stand: Mai 2016] Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis .......................................................................................................... IV
Tabellenverzeichnis ............................................................................................................... V
1 Vorbemerkung ................................................................................................................ 1
2 Art und Umfang der Arbeiten .......................................................................................... 2
3 Formaler Aufbau schriftlicher Arbeiten ............................................................................ 4
3.1 Das Titelblatt .............................................................................................................. 4
3.2 Inhalts-, Abbildungs-, Tabellen- und Abkürzungsverzeichnis ...................................... 5
3.3 Der Fließtext............................................................................................................... 6
3.3.1 Die Einleitung ................................................................................................... 6
3.3.2 Thematische Abgrenzung und Definitionen ...................................................... 7
3.3.3 Hauptteil ........................................................................................................... 7
3.3.4 Schluss ............................................................................................................. 8
3.3.5 Anhang ............................................................................................................. 9
3.4 Literaturverzeichnis .................................................................................................... 9
3.4.1 Monografien ................................................................................................... 10
3.4.2 Beiträge aus Sammelwerken .......................................................................... 11
3.4.3 Zeitschriftenartikel .......................................................................................... 11
3.4.4 Internetquellen ................................................................................................ 12
3.5 Eidesstattliche Erklärung / Eigenständigkeitserklärung ............................................. 13
4 Zitierweisen .................................................................................................................. 14
4.1 Harvard Zitierweise (amerikanische) ........................................................................ 15
4.2 Chicago Zitierweise (klassische Zitierweise)............................................................. 17
5 Das Layout schriftlicher Arbeiten .................................................................................. 19
6 Formale Gestaltung von wissenschaftlichen Postern .................................................... 20
7 Formale Gestaltung von PowerPoint-Präsentationen .................................................... 21
7.1 Allgemeine Hinweise zur Gestaltung von PowerPoint- Präsentationen..................... 21
7.2 Titelfolie.................................................................................................................... 22
7.3 Gliederung ............................................................................................................... 22
7.4 Abschlussfolie .......................................................................................................... 22
7.5 Quellenverzeichnis ................................................................................................... 23
8 Weiterführende Literatur ............................................................................................... 24
IIWirtschaft und Ethik [Stand: Mai 2016] Inhaltsverzeichnis
Anhang ................................................................................................................................ 25
Anhang 1: Musterdeckblatt ....................................................................................... 26
Anhang 2: Nummerische und alphanummerische Mustergliederungen .................... 27
Anhang 3: Eidesstattliche Erklärung / Eigenständigkeitserklärung............................ 29
Anhang 4: Zusammenfassung der wichtigsten Formalia .......................................... 30
Anhang 5: Checkliste zum Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten ........................... 34
Anhang 6: Häufige Fehler......................................................................................... 36
Literaturverzeichnis .............................................................................................................. 37
IIIWirtschaft und Ethik [Stand: Mai 2016] Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Musterdeckblatt ............................................................................................... 26
Abbildung 2: Nummerische Gliederung ................................................................................ 27
Abbildung 3: Alphanummerische Gliederung ....................................................................... 28
IVWirtschaft und Ethik [Stand: Mai 2016] Inhaltsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Gestaltung des Layouts ....................................................................................... 19
Tabelle 2: Art und Umfang schriftlicher Prüfungsleistungen ................................................. 30
Tabelle 3: Zusammenfassung zum Layout schriftlicher Arbeiten .......................................... 30
VWirtschaft und Ethik [Stand: Mai 2016] Vorbemerkung
1 Vorbemerkung
Der folgende Leitfaden wurde in Ergänzung zur Veranstaltung „WE-1.1 Propädeutikum wis-
senschaftliches Arbeiten“ verfasst. Er ist als Vorgabe für das Verfassen wissenschaftlicher
Texte und Präsentationen innerhalb des Faches Wirtschaft und Ethik: Social Business zu
betrachten. Der Begriff „wissenschaftliche Arbeit“ umfasst in diesem Fall sämtliche Prü-
fungsleistungen mit Ausnahme von Klausuren und Kolloquien. Der Leitfaden soll den
Studierenden helfen, wissenschaftliche Arbeiten inhaltlich korrekt zu strukturieren und for-
mal richtig darzustellen.
Lernziele wissenschaftlichen Arbeitens sind zum einen der sinnvolle und richtige Einsatz
von Methoden, Techniken und Instrumenten, und zum anderen die objektive, korrekte und
eindeutige Vermittlung von wissenschaftlichen Fragestellungen und Inhalten.
Studierende müssen in der Lage sein:
Themen klar einzugrenzen und in ihrer Vollständigkeit zu bearbeiten,
in der Arbeit verwendete Begriffe zu definieren und diese im Verlauf der Arbeit
konsequent zu nutzen,
die gesamte Arbeit objektiv, transparent und klar strukturiert aufzubauen und
gängige Zitierrichtlinien anzuwenden (vgl. Rossig/Prätsch 2008: 1f.).
Der Leitfaden folgt den Zitierrichtlinien der Harvard University. Entgegen der Regel, dass in
wissenschaftlichen Arbeiten jeweils nur eine Zitierweise angewendet werden darf, wird in
Kapitel 4.2 zur Veranschaulichung die Chicago-Zitierweise verwendet.
1Wirtschaft und Ethik [Stand: Mai 2016] Art und Umfang der Arbeiten
2 Art und Umfang der Arbeiten
Je nach Modulabschlussprüfung variieren Art und Umfang einer wissenschaftlichen Arbeit.
Die Signifikanz einer breiten Literaturbasis unter Verwendung aktueller und fundierter wis-
senschaftlicher Quellen gilt jedoch gleichermaßen. Exaktere Angaben zu Art und Anzahl
der verwendeten Quellen sowie zum Umfang werden gegebenenfalls durch den/die Dozen-
ten/in spezifisch festgelegt. Die folgenden Punkte sind daher als allgemeiner
Orientierungsrahmen zu verstehen und beziehen sich auf das Amtliche Mitteilungsblatt der
Universität Vechta 27/2015 (vgl. Raatz-Vornhusen 2015b: 7), sofern nicht anders gekenn-
zeichnet.
Hausarbeiten sehen die schriftliche Bearbeitung einer modulbezogenen, selbstgewählten
Fragestellung in einem Umfang von ca. 30.000 bis 37.500 Zeichen1 vor.
Referate beinhalten sowohl eine schriftliche Ausarbeitung einer gegebenen Aufgabenstel-
lung als auch die Präsentation der dabei gewonnenen Erkenntnisse.
Referatsausarbeitungen umfassen dabei ca. 15.000 bis 22.500 Zeichen, die Dauer des
Vortrages beträgt in der Regel 30 Minuten. Je nach Vorgabe kann die Präsentation der
Ergebnisse als PowerPoint-Präsentation oder in Form eines wissenschaftlichen Posters er-
folgen.
Projektberichte beinhalten in der Regel eine Präsentation der Ergebnisse sowie deren
schriftliche Fixierung in einem Umfang von 75.000 bis 105.000 Zeichen.
Als Portfolio werden Arbeiten bezeichnet, welche „den Lernprozess der Prüfungskandida-
tin/ des Prüfungskandidaten durch Zusammenstellung geeigneter kleinerer Texte oder
Daten, Recherchen oder Hausaufgaben, Artikel und ähnlicher Materialien sowie einen
Selbstreflexionsbericht dokumentiert“ (Raatz-Vornhusen 2015a: 14). Der Selbstreflexions-
bericht ist dabei in einem Umfang von 25.000 bis 30.000 Zeichen zu verfassen. Der exakte
Umfang und die spezifische Zusammensetzung aller Prüfungsleistungen werden – im Rah-
men der Prüfungsordnung – in den jeweiligen Seminarveranstaltungen bindend festgelegt.
Der Praktikumsbericht im Rahmen der Praktika für verschiedene Berufsfelder umfasst
25.000 bis 37.500 Zeichen. Wenn das „Orientierungspraktikum“ und das „Praktikum für ver-
schiedenen Berufsfelder“ zusammengefasst werden, erhöht sich der Umfang auf 37.500
bis 50.000 Zeichen. Es ist zudem die Praktikumsordnung zu beachten.
Bachelorarbeiten sollen zeigen, dass die Studierenden in der Lage sind, mit Hilfe wissen-
schaftlicher Methoden und Fachliteratur selbstständig eine fachbezogene, ggf.
1 Nicht gezählte Zeichen: Deckblatt, Inhalts-, Abbildungs- und Literaturverzeichnis, Anhänge und
Eidesstattliche Erklärung / Eigenständigkeitserklärung. Zeichenzahl inklusive Leerzeichen.
2Wirtschaft und Ethik [Stand: Mai 2016] Art und Umfang der Arbeiten
selbstgewählte Aufgabenstellung umfassend und gemäß wissenschaftlichen Standards zu
bearbeiten. Im Studiengang Bachelor Combined Studies umfasst eine Bachelorarbeit
75.000 - 125.000 Zeichen. Wurde eines der gewählten Fächer als A-Fach belegt, so muss
das gewählte Themengebiet in diesem Fachbereich eingegliedert sein. Werden zwei Fä-
cher in einer B-B-Gewichtung studiert, so kann das Fach in welchem die Bachelorarbeit
absolviert werden soll, frei gewählt werden.
Im Sinne einer gendergerechten Sprache ist bei dem Verfassen wissenschaftlicher Arbei-
ten die Verwendung des generischen Maskulinums zu vermeiden (hierzu und zu den
folgenden Ausführungen in diesem Absatz vgl. Ludwig-Maximilians-Universität München
(Hrsg.) 2011). Sofern dies möglich ist, sollten genderneutrale Personenbezeichnungen
(z.B. Studierende, Mitarbeitende usw.) verwendet werden. Anderenfalls wird zunächst der
Artikel, getrennt durch einen Schrägstrich, in maskuliner und femininer Form verwendet.
Darauf folgt die Personenbezeichnung mit geschlechtsspezifischer Endung (z.B. ein/eine
MitarbeiterIn; ein/eine StudentIn, der/die TeilnehmerIn).
3Wirtschaft und Ethik [Stand: Mai 2016] Formaler Aufbau schriftlicher Arbeiten
3 Formaler Aufbau schriftlicher Arbeiten
Bei schriftlichen wissenschaftlichen Arbeiten ist eine Untergliederung gemäß nachfolgen-
dem Beispiel erforderlich2. Hierbei ist zu beachten, dass die fett gedruckten Punkte
obligatorisch sind. Die nicht fett gedruckten Punkte sind nach Bedarf einzusetzen. Die ge-
naue Gliederung beim Fließtext wird ggf. durch den/die Dozenten/in spezifisch festgelegt.
Titelblatt
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Symbolverzeichnis
Fließtext
Einleitung
Vorgehensweise und Definitionen
Hauptteil
Schluss
Anhang
Literaturverzeichnis
Eidesstattliche Erklärung / Eigenständigkeitserklärung
Die Hauptüberschrift eines jeden dieser Teilbereiche steht dabei stets am Anfang einer
neuen Seite. Nachfolgend wird der formale Aufbau der Gliederungspunkte erläutert.
3.1 Das Titelblatt
Das Layout des Titelblattes kann von den Studierenden weitestgehend frei gestaltet wer-
den. Jedoch sollten weder Schmuckbilder noch das Universitätslogo verwendet werden.
Die inhaltliche Gestaltung sieht die Einbindung der folgenden Informationen vor (vgl.
Heinz/Reuter/Zillien 2011: 5ff.):
Studiendaten:
Name der Universität
Name des Departments
2 Die hier aufgeführten Punkte erhalten keine numerische Untergliederung. Im folgenden Fließtext
finden jedoch nummerische oder alphanummerische Gliederungssysteme in chronologischer
Reihenfolge Anwendung. Für beide Gliederungssysteme sind Mustergliederungen im Punkt
„Anhang 3: Nummerische und alphanummerische Mustergliederungen“ eingefügt.
4Wirtschaft und Ethik [Stand: Mai 2016] Formaler Aufbau schriftlicher Arbeiten
Studiengang
Modulbezeichnung (z.B. WE-1 Einführung in Wirtschaft und Ethik)
Aktuelles Semester (z.B. Wintersemester 2015/16)
Typ der Ausarbeitung (Hausarbeit, Referat, Bachelorarbeit, Masterarbeit)
Titel der Arbeit
Nur bei Referatsausarbeitungen: Datum und Titel des zugehörigen
Referates
Betreuende Lehrkraft (Titel und Name)
Datum der Abgabe
Anzahl der Zeichen
VerfasserIn
Vollständiger Vor- und Nachname
Matrikelnummer
Fachsemester
Anschrift
E-Mail-Adresse
Telefon- oder Mobilnummer
Das Titelblatt trägt keine Seitenzahl.
Ein Beispiel für die Gestaltung des Titelblattes findet sich im Anhang dieses Leitfadens
unter „Anhang 1: Musterdeckblatt“.
3.2 Inhalts-, Abbildungs-, Tabellen- und Abkürzungsverzeichnis
Das Inhaltsverzeichnis ist ein wichtiger Indikator für die Qualität der wissenschaftlichen Aus-
arbeitung (hierzu und zu den folgenden Ausführungen in diesem Absatz vgl. Theisen 2006:
179f.). Hier spiegeln sich die Vorgehensweise und der stringente Aufbau der Arbeit wider.
Das Inhaltsverzeichnis umfasst alle Abschnitts- und Teilabschnittsüberschriften sowie die
dazugehörigen Seitenzahlen. Die gesamte Arbeit muss mit fortlaufenden Seitenzahlen
nummeriert werden. Für die Seiten mit Inhalts-, Abbildungs-, Tabellen- und Abkürzungsver-
zeichnis (sofern diese vorhanden sind) ist eine römische Nummerierung zu wählen. Die
römische Nummerierung beginnt mit dem Titelblatt, auf welchem die Seitenzahl allerdings
nicht ausgewiesen wird. Das Inhaltsverzeichnis trägt somit die Nummerierung „II“. Für alle
anderen Seiten wird eine chronologische, arabische Nummerierung verwendet.
Die Gliederung des Fließtextes sollte nicht mehr als drei und maximal vier Hierarchieebe-
nen aufweisen (hierzu und zu den folgenden Ausführungen in diesem Absatz vgl. Diesterer
5Wirtschaft und Ethik [Stand: Mai 2016] Formaler Aufbau schriftlicher Arbeiten
2014: 111ff.). Weiter ist darauf zu achten, dass jede Überschrift nur einmal verwendet wer-
den darf, für Unterüberschriften mindestens zwei Kapitel vorhanden sein müssen und der
Titel der Arbeit mit keiner Überschrift übereinstimmen darf. Alle verwendeten Überschriften
müssen überdies hinaus exakt mit jenen des Inhaltsverzeichnisses übereinstimmen.
Das Tabellen- und das Abbildungsverzeichnis beinhalten die wortgleichen Titel aller Grafi-
ken sowie deren entsprechende Seitenzahl (vgl. Theisen 2006: 183). Die aufgeführten
Tabellen und Abbildungen müssen innerhalb des Verzeichnisses chronologisch nach ihrer
Nummerierung aufgeführt werden (vgl. Theisen 2006: 183).
Für die Erstellung aller Verzeichnisse (auch des Inhaltsverzeichnisses) wird empfohlen, die
automatischen Funktionen des entsprechenden Textverarbeitungsprogrammes (z.B. Micro-
soft Word) zu verwenden, da diese die Aktualisierung von Seitenzahlen und Überschriften
beträchtlich vereinfachen (vgl. Heinz/Reuter/Zillien 2011: 8f.). Lediglich das Abkürzungs-
verzeichnis ist manuell zu erstellen. Hier werden alle in der Arbeit verwendeten
Abkürzungen aufgeführt, welche nicht in der aktuellsten Ausgabe des Dudens zu finden
sind. Die Kürzel sowie deren Bedeutung sind in alphabetischer Reihenfolge aufzuführen.
Vor der ersten Verwendung der Abkürzung im Fließtext ist die genaue Bezeichnung zu-
nächst auszuschreiben und die Kürzel in Klammern danach einzufügen
(z.B. …die Europäische Zentralbank (EZB) ist dafür…). Im Unterschied zu den anderen
Verzeichnissen sind im Abkürzungsverzeichnis keine Seitenzahlen aufzuführen (vgl. Brink
2013: 203ff.; Heinz/Reuter/Zillien 2011: 9f.).
3.3 Der Fließtext
Die Untergliederung des Fließtextes ist von essenzieller Bedeutung, da den Lesenden das
Nachvollziehen des Aufbaus und der wissenschaftlichen Methodik ermöglicht wird. Anhand
der Tiefe der Gliederung sind die Bearbeitungsschwerpunkte zu erkennen. Sofern nicht
mindestens zwei Gliederungspunkte entstehen, ist eine Untergliederung nicht möglich.
(Beispiel: Nach „3“ und „3.1“ kann nicht „4“ folgen, zunächst muss „3.2“ ausgeführt werden.)
3.3.1 Die Einleitung
Eine jede Einleitung sollte folgende Informationen enthalten, wie:
Einordnung und Relevanz des Themas in den wissenschaftlichen Diskurs
(Welche Bereiche, z.B. ökonomische oder gesellschaftliche, sind betroffen und wie
aktuell ist das Thema im gegenwärtigen wissenschaftlichen Diskurs?)
6Wirtschaft und Ethik [Stand: Mai 2016] Formaler Aufbau schriftlicher Arbeiten
Fragestellung und Zielsetzung der Arbeit
(Welche Fragestellung soll in der Arbeit bearbeitet werden und welches Ziel wird
dabei verfolgt?)
Vorgehensweise im weiteren Verlauf der Arbeit
(Wie soll die Fragestellung und Zielsetzung der Arbeit erreicht werden? Wie ist die
Arbeit aufgebaut und weshalb in dieser Weise?)
Die Einleitung sollte nicht mehr als 10% des Fließtextes einnehmen (vgl. Heinz/Reuter/Zil-
lien 2011: 11).
3.3.2 Thematische Abgrenzung und Definitionen
Nach der Einleitung folgt ggf. ein weiterer Unterpunkt, welcher zum einen die thematische
Abgrenzung der Fragestellung vorsieht und zum anderen die Erläuterung von Schlüsselbe-
griffen der Arbeit impliziert (vgl. Esselborn-Krumbiegel 2004: 138ff.), z.B.:
Thematische Abgrenzung:
Welche Aspekte der Fragestellung werden nicht thematisiert? Warum werden
diese außenvorgelassen?
Erläuterungen:
Wie werden die zentralen Begriffe einer Arbeit definiert und warum wird auf diese
Definition zurückgegriffen? Können diese zentralen Begriffe in einen gemeinsa-
men Kontext gebracht werden und wenn ja, in welchen? (Die hier definierten
Begriffe sind in der Regel auch im Titel oder der Kernfragestellung der Arbeit wie-
derzufinden. Kurze Definitionen von weniger wesentlichen Begriffen sind auch im
Hauptteil der Arbeit noch möglich.)
Vorstellung / Einführung:
Sofern ein Untersuchungsobjekt in die Arbeit einbezogen wird, sollte es an dieser
Stelle näher vorgestellt werden.
(Z.B.: Um welchen Betrieb handelt es sich? Warum wurde dieser gewählt? In wel-
che Branche ist er einzuordnen und wie groß ist er?)
3.3.3 Hauptteil
Im Verlauf des Hauptteils wird die Fragestellung der Arbeit mithilfe wissenschaftlicher The-
orien auf ihre verschiedenen Antwortmöglichkeiten hin untersucht. Dabei kann es sich um
eine rein literaturgestützte Diskussion oder eine eigene empirische Untersuchung handeln.
7Wirtschaft und Ethik [Stand: Mai 2016] Formaler Aufbau schriftlicher Arbeiten
Wichtig ist jedoch, dass alle angeführten Argumentationen wissenschaftlich belegt werden
können.
Die systematische Vorgehensweise bei der Bearbeitung der wissenschaftlichen Fragestel-
lung ist im Hauptteil essenziell. Von grundlegender Bedeutung ist zudem der differenzierte
Diskurs potenzieller Argumente. In den verwendeten Quellen muss sich die Vielfalt der wis-
senschaftlichen Diskussionen und Erkenntnisse widerspiegeln. Ebenso ist eine kritische
Betrachtung der Quellen notwendig. Dies bedeutet zum einen die Analyse des wissen-
schaftlichen Charakters einer Arbeit (könnte der Autor/die Autorin als befangen gelten?),
zum anderen aber auch den Diskurs bestehender Thesen anhand von (aktuelleren) empi-
rischen Ergebnissen oder anderen Theorien. Alle formulierten Behauptungen müssen
theoretisch begründet sein. Die Verwendung der ersten Person Singular oder Plural ist im
gesamten Verlauf der Arbeit zu vermeiden. (Falsch: Ich habe mich in dieser Arbeit mit XY
auseinandergesetzt. Richtig: Diese Arbeit beschäftigt sich mit XY.)
Der Aufbau des Hauptteils kann unterschiedlich gestaltet werden, orientieren sollten sich
Verfassende jedoch an folgenden Merkmalen:
Aktueller Forschungsstand (und eventuelles Forschungsdesign oder Forschungs-
methoden)
Systematische Problemanalyse und diverse Bearbeitung der Fragestellung an-
hand wissenschaftlicher Quellen
Zusammenfassung der Kernaussagen
Kritische Reflexion von Quellen und Ergebnissen
(Vgl. Heinz/Reuter/Zillien 2011: 11f.).
3.3.4 Schluss
Dieser letzte Fließtextabschnitt dient dazu, die Kernaussagen hinsichtlich der Beantwortung
der eingangs aufgegriffenen Fragestellung noch einmal kurz zusammenzufassen und zu
interpretieren (hierzu und zu den folgenden Ausführungen in diesem Absatz vgl. Heinz/Reu-
ter/Zillien 2011: 12f.). In dem Schlussteil sollen keine neuen, in der Arbeit bislang noch nicht
verwendeten Argumente in den Diskurs eingebracht werden. Jedoch können bislang nicht
beantwortete Fragestellungen oder potenzielle Forschungsfelder aufgegriffen werden, um
einen Ausblick zu gewähren und den Ansatz neuer wissenschaftlicher Diskussion aufzuzei-
gen
8Wirtschaft und Ethik [Stand: Mai 2016] Formaler Aufbau schriftlicher Arbeiten
3.3.5 Anhang
Der Anhang ist nicht als Forum zu verstehen, in welchem Argumentationen, die im Fließtext
keine Erwähnung gefunden haben, diskutiert werden (hierzu und zu den folgenden Ausfüh-
rungen in diesem Absatz vgl. Theisen 2006: 170ff.). Er dient im Regelfall dazu, Material
empirischer Erhebungen (z.B. Interviewleitfäden und transkribierte Experteninterviews) auf-
zuführen. Zitierte Quellen – die entweder nicht öffentlich zugänglich oder veränderbar sind
– sollten ebenfalls (in Auszügen) eingebunden werden. Zu dieser Art von Quellen zählen
auch Onlinequellen, die beispielsweise in Form einer CD der Arbeit beigefügt werden. Alle
Elemente des Anhangs müssen ebenfalls betitelt und chronologisch mit arabischen Zahlen
nummeriert werden.
3.4 Literaturverzeichnis
Das Literaturverzeichnis dient der Aufführung aller in einer wissenschaftlichen Arbeit direkt
oder sinngemäß verwendeten Quellen (hierzu und zu den folgenden Ausführungen in die-
sem Absatz vgl. Heesen 2014: 72ff.). Sortiert nach den Namen der AutorInnen werden
diese in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Sollten mehrere Werke eines/einer Au-
tors/in Verwendung finden, so werden diese in aufsteigender Reihenfolge nach dem
Veröffentlichungsjahr sortiert. Sollten zudem zwei oder mehrere dieser Werke innerhalb
eines Kalenderjahres entstanden sein, so sind die Jahreszahlen zusätzlich in alphabeti-
scher Reihenfolge mit Kleinbuchstaben zu kennzeichnen (z.B. Theisen 2013a; Theisen
2013b). Die Sortierung der entsprechenden Werke folgt in alphabetischer Reihenfolge der
Titelanfänge der Werke. Dies ermöglicht die eindeutige Identifizierung der Quellen. Je nach
Art der Quelle sind jedoch verschiedene Informationsangaben innerhalb des Literaturver-
zeichnisses notwendig. Bevor näher auf diese Differenzierung eingegangen und Beispiele
angeführt werden, folgen zunächst allgemeine formale Kriterien.
Die Autoren und Autorinnen sind mit vollständigem Namen und Vornamen zu nen-
nen. Die Abkürzung des Vornamens soll, wann immer möglich, vermieden werden.
Akademische Grade oder Berufsbezeichnungen (z.B. “Prof. Dr.“ oder „Dipl.-Kfm.“)
werden im Literaturverzeichnis nicht angegeben.
Ist die natürliche Person, welche ein verwendetes Werk verfasst hat, nicht bekannt,
so ist die Behörde, die Organisation oder die Institution anstelle des Autors/der Au-
torin zu nennen und als Herausgeber zu kennzeichnen. Dazu wird direkt hinter die
Nennung der Organisation die Abkürzung „(Hrsg.)“ gesetzt. Bei Internetquellen
handelt es sich hier im Zweifelsfall um die im Impressum genannte, verantwortliche
Instanz.
9Wirtschaft und Ethik [Stand: Mai 2016] Formaler Aufbau schriftlicher Arbeiten
Sofern von einem Werk verschiedene Auflagen vorliegen, soll im Rahmen der wis-
senschaftlichen Arbeit nach Möglichkeit immer die aktuellste Auflage zur direkten
oder sinngemäßen Zitation verwendet werden.
Falls notwendige Informationen auch nach gründlicher Recherche nicht herausge-
funden werden können, sind folgende Abkürzungen zu verwenden:
o.V. = ohne Verfasser / ohne Verfasserin
o.J. = ohne Jahr
o.O. = ohne Ort
Name und Vorname der Autoren und Autorinnen sowie das Erscheinungsjahr soll-
ten fettgedruckt gesetzt werden.
Die einzelnen Titel im Literaturverzeichnis sollten ab der zweiten Zeile mit hängen-
dem Einzug (1,25 cm eingerückt) formatiert sein.
Titel und Untertitel eines Werkes sollten mit einem Gedankenstrich voneinander
getrennt werden.
Für jedes aufgeführte Werk ist ein Absatz erforderlich, das Ende eines jeden Bele-
ges muss mit einem Punkt gekennzeichnet sein.
Die notwendigen Angaben im Literaturverzeichnis verändern sich nach Art des Werkes,
weshalb im Folgenden die Unterschiede erläutert werden.
3.4.1 Monografien
Als Monografien werden Bücher bezeichnet, welche sich thematisch lediglich an einem
Schwerpunkt orientieren (vgl. Brink 2013: 53). Im Literaturverzeichnis werden sie schema-
tisch wie folgt dargestellt (vgl. Heesen 2014: 74).
Name, Vorname (Erscheinungsjahr): Titel der Monografie – ggf. Untertitel, ggf. Nummer
des Bandes innerhalb einer Reihe: Titel der Reihe, Auflage, Verlagsort: Verlag.
Handelt es sich um die Erstauflage, so wird dies nicht vermerkt. Sind mehrere Verlagsorte
genannt, so wird der Erstgenannte übernommen und mit dem Zusatz „u.a.“ aufgeführt.
Beispiel:
Horváth, Péter (2011): Controlling, 12., vollständig überarbeitete Auflage, München:
Vahlen Verlag.
10Wirtschaft und Ethik [Stand: Mai 2016] Formaler Aufbau schriftlicher Arbeiten
3.4.2 Beiträge aus Sammelwerken
Als Sammelwerke werden Bücher bezeichnet, welche sich aus Aufsätzen diverser Autor-
Innen, zu einem spezifischen Themengebiet zusammensetzen und durch einen oder meh-
rere HerausgeberInnen veröffentlicht wurde. Auch Festschriften gehören diesem
Literatursegment an (vgl. Brink 2013: 54). Beiträge aus Sammelwerken oder Sammelbän-
den werden im Literaturverzeichnis schematisch wie folgt dargestellt (vgl. Heesen 2014:
75f.):
Name, Vorname (Erscheinungsjahr): Titel des Beitrags – ggf. Untertitel, in: Name, Vor-
name (Hrsg.): Titel des Sammelwerkes – ggf. Untertitel, ggf. Nummer des Bandes
innerhalb einer Reihe: Titel der Reihe, Auflage, Verlagsort: Verlag, Seitenbereich
des Beitrages.
Auch hier gilt, dass die Auflage – sofern es sich um die Erstauflage handelt – keine Erwäh-
nung findet. Sind mehrere Verlagsorte genannt, so wird der Erstgenannte übernommen und
mit dem Zusatz „u.a.“ aufgeführt. Die Angabe des Seitenbereichs erfolgt von der ersten
Seite des Beitrags bis hin zur letzten Seite der Literaturhinweise des Beitrags. Soll das
gesamte Sammelwerk und nicht nur ein Beitrag daraus übernommen werden, so sind die
HerausgeberInnen an Stelle der Autoren und Autorinnen zu nennen und das Sammelwerk
wie eine Monografie aufzuführen.
Beispiele:
Höpner, Martin (2011): Corporate Governance, in: Nohlen, Dieter / Grotz, Florian (Hrsg.):
Kleines Lexikon der Politik, Band 1145: Bundeszentrale für politische Bildung, Mün-
chen u.a.: Verlag C.H. Beck, S. 79-80.
Schrader, Ulf / Hansen, Ursula (Hrsg.) (2001): Nachhaltiger Konsum – Forschung und
Praxis im Dialog, Frankfurt/Main: Campus Verlag.
3.4.3 Zeitschriftenartikel
Zeitschriftenartikel werden im Literaturverzeichnis schematisch wie folgt dargestellt
(vgl. Heesen 2014: 77f.):
Name, Vorname (Erscheinungsjahr): Titel des Artikels – ggf. Untertitel, in: Titel der Zeit-
schrift, ggf. Jahrgang: ggf. Ausgabennummer, Seitenbereich des Artikels.
11Wirtschaft und Ethik [Stand: Mai 2016] Formaler Aufbau schriftlicher Arbeiten
Herausgeber oder der Erscheinungsort von Zeitungs- und Zeitschriftenartikel werden nicht
ausgewiesen. Die Angabe des Seitenbereichs erfolgt von der ersten Seite bis hin zur letzten
Seite des Beitrags.
Beispiele:
Lin-Hi, Nick (2010): The problem with a narrow-minded interpretation of CSR – Why CSR
has nothing to do with philantrophy, in: Ramon Llull Journal of Applied Ethics, 1 (1),
S. 79-95.
Beckmann, Markus (2008): Ordnungsverantwortung in Demokratie und Marktwirtschaft,
in: zfwu – Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik, 9 (2),
S. 263-273.
3.4.4 Internetquellen
Da Internetquellen besonders leicht verändert werden können, müssen von diesen Quellen
elektronische Abzüge angefertigt werden, da sonst die Überprüfbarkeit der Angaben mög-
licherweise nicht gegeben ist (hierzu und zu den folgenden Ausführungen in diesem Absatz
vgl. Heinz/Reuter/Zillien 2011: 17ff.). Handelt es sich bei dem verwendeten Beitrag um die
identische Online-Kopie eines Artikels einer Fachzeitschrift, so gilt stets die Regel: Print-
quelle vor Onlinequelle. Die Hyperlinks bzw. die Unterstreichungen der angeführten Links
sind zu entfernen. Internetquellen werden im Literaturverzeichnis schematisch wie folgt dar-
gestellt:
Name, Vorname (Erscheinungsjahr): Titel des Beitrages – ggf. Untertitel, ggf. Zusatz
Working Paper: Universität, online im Internet unter: Link im URL Format, letzter
Aufruf: tt.mm.jjjj, Uhrzeit des letzten Aufrufes.
Mit Working Paper sind „Diskussionspapiere“ u.ä. gemeint, die unter dem Vorbehalt der
Vorläufigkeit für einen engen Interessentenkreis veröffentlicht (Hervorhebung im Original)
werden.“ (Brink 2013: 54).
Beispiele:
Beckert, Jens (2006): Sind Unternehmen sozial verantwortlich?, Reihe: MPIfG working
paper 06/4, online im Internet unter: http://www.econstor.eu/handle/10419/44275,
letzter Aufruf: 10.02.2016, 12:05 Uhr.
12Wirtschaft und Ethik [Stand: Mai 2016] Formaler Aufbau schriftlicher Arbeiten
Suchanek, Andreas / Lin-Hi, Nick (2006): Eine Konzeption unternehmerischer Verantwor-
tung; Diskussionspapier Nr. 2006-7 des Wittenberg-Zentrums für Globale Ethik,
online im Internet unter: http://wcge.org/download/DP_2006-7_Suchanek_Lin-Hi_-
_Eine_Konzeption_unternehmerischer_Verantwortung.pdf,
letzter Aufruf: 04.02.2016, 22.28 Uhr.
Wieland, Josef / Schmiedeknecht, Maud (2010): Corporate Social Responsibility (CSR),
Stakeholder Management und Netzwerkgovernance, Workingpaper No. 31/2010:
Konstanz Institut für Werte Management, online im Internet unter: http://www.htwg-
konstanz.de/fileadmin/pub/ou_kiem/Working_Papers/WP_31_2010_CSR_Stake-
holdermanagement_und_Netzwerkgovernance.pdf, letzter Aufruf: 05.11.2014,
20.23 Uhr.
3.5 Eidesstattliche Erklärung / Eigenständigkeitserklärung
Die Eidesstattliche Erklärung (zwingend erforderlich bei Bachelorarbeiten) bzw. Eigenstän-
digkeitserklärung ist die letzte Seite einer jeden Arbeit. Hier bestätigt der/die AutorIn, die
Arbeit selbst und nur unter Zuhilfenahme der angegebenen Quellen angefertigt zu haben.
Außerdem versichert der/die Verfassende, dass die entsprechende Arbeit noch in keiner
Weise als Leistungsnachweis bewertet oder eingereicht wurde. Die Erklärung ist mit dem
Datum der Abgabe sowie der Unterschrift des/der Verfassenden zu versehen. Ein Beispiel
für eine solche Erklärung findet sich im Anhang dieses Leitfadens („Anhang 3: Eidesstattli-
che Erklärung / Eigenständigkeitserklärung“).
13Wirtschaft und Ethik [Stand: Mai 2016] Zitierweisen
4 Zitierweisen
Innerhalb des wissenschaftlichen Arbeitens und des wissenschaftlichen Diskurses nimmt
die Zitation eine zentrale Rolle ein. Hier werden alle Gedanken, die einen Bezug zu bereits
bekanntem Wissen haben, markiert und es wird auf deren Ursprung verwiesen. Zitate kön-
nen sowohl wortwörtlich (direkt) wie auch sinngemäß übernommen werden. Der Verweis
auf Quellen ist wichtiger Bestandteil des wissenschaftlichen Arbeitens. Grundsätzlich gilt,
dass sich eine Quelle stets immer nur auf einen Satz bezieht. Ein Verstoß gegen diese
Regel kann als Täuschungsversuch gewertet werden. Für den Fall, dass sich eine Quelle
auf einen ganzen Absatz bezieht, ist eine Sammelquelle zu Beginn des Absatzes möglich
(Beispiel: hierzu und zu den folgenden Ausführungen in diesem Absatz vgl. Nachname
Jahr: ggf. Seite). Alternativ kann auch jeder Satz in dem Absatz mit der entsprechenden
Quelle einzeln belegt werden.
Durch das Zitieren anderer Werke werden zum einen die Urheberrechte aller AutorInnen
gewahrt, zum anderen können so übernommene Passagen und Gedanken im Originalwerk
überprüft werden. Dies soll helfen, subjektive Interpretationen der VerfasserInnen zu relati-
vieren (vgl. Heinz/Reuter/Zillien 2011: 28). Um den Anspruch einer wissenschaftlichen
Arbeit gerecht zu werden, ist es notwendig, dass es sich bei den verwendeten Quellen um
wissenschaftlich belastbares Material handelt (hierzu und zu den folgenden Ausführungen
in diesem Absatz vgl. Brink 2013: 220ff.). Die Qualität der Quellen entscheidet maßgeblich
über die Qualität der verfassten Arbeit. Onlineportale – wie die Plattform Wikipedia – gehö-
ren ausdrücklich nicht dazu und dürfen somit nicht als Quelle verwendet werden. Ebenso
wenig dürfen Skripte, Seminar- oder unveröffentlichte Diplomarbeiten sowie PowerPoint-
Präsentationen aus Veranstaltungen als Quelle herangezogen werden. Ferner soll nach
Möglichkeit stets auf das Originalwerk zurückgegriffen werden. Für den Fall, dass ein Zitat
aus einem Werk übernommen wird, welches wiederum ein anderes Originalwerk zitiert, so
muss dieses bei der Zitation hervorgehoben werden.
Folgende Punkte sind bei der Verwendung direkter Zitate zu beachten (vgl. Hein/Reuter/Zil-
lien 2011: 23ff.; Brink 2013: 218ff.):
Direkte Zitate müssen sowohl in ihrem Wortlaut und der Rechtschreibung, als auch
in der Zeichensetzung und der Verwendung von Hervorhebungen mit dem Original
exakt identisch sein. Auch Rechtschreibfehler sind zu übernehmen und mit einem
[sic!] zu kennzeichnen (z.B. „Unternehmen haben ein [sic!] gesellschaftliche Verant-
wortung“).
Typografische Hervorhebungen durch die AutorInnen sind zu kennzeichnen, in dem
in eckigen Klammern der Verweis „[Hervorhebung im Original]“ eingefügt wird.
14Wirtschaft und Ethik [Stand: Mai 2016] Zitierweisen
Wurde ein Textabschnitt durch den/die VerfasserIn hervorgehoben, so ist der Ver-
merk „[Hervorhebung durch den/die VerfasserIn]“ einzufügen.
Am Anfang und am Ende eines jeden direkten Zitates stehen Anführungszeichen.
Sofern ein Zitat mehr als 40 Wörter umfasst, ist es in Schriftgröße 10pt, mit einfa-
chem Zeilenabstand und im Vergleich zum restlichen Text eingerückt darzustellen.
Auslassungen zu Beginn und zum Ende eines Zitates müssen nicht gekennzeichnet
werden.
Werden in direkten Zitaten ein oder zwei Worte ausgelassen, so wird diese Stelle
durch das Einfügen von zwei Punkten „..“ gekennzeichnet. Werden drei oder mehr
Wörter ausgelassen, so ist dies durch drei Punkte „…“ zu kennzeichnen. Werden
längere Textpassagen wie zum Beispiel ein Absatz ausgelassen, so sind die drei
Punkte in einer eckigen Klammer anzuführen „[…]“. Durch die Auslassungen darf
das Zitat jedoch auf keinen Fall sinngemäß verändert werden.
Sind eigene Ergänzungen notwendig, um das Zitat beispielsweise in den Satzbau
zu integrieren, so sind diese in eckigen Klammern anzuführen „[]“.
Wird ein Zitat innerhalb eines Zitates zitiert, so werden anstelle der doppelten An-
führungsstriche („“) einfache Anführungsstriche verwendet (‚‘).
Am Ende eines jeden direkten oder sinngemäßen Zitates ist die Quelle aufzuführen.
Innerhalb des wissenschaftlichen Diskurses haben sich im Laufe der historischen Entwick-
lung im Wesentlichen zwei Zitiervarianten durchsetzen können: die Harvard Zitierweise,
auch „amerikanische Zitierweise“ genannt und die Chicagoer Zitierweise, auch als klassi-
sche Zitierweise bekannt.
4.1 Harvard Zitierweise (amerikanische Zitierweise)
Die Harvard Zitierweise gilt als die kürzeste Zitiervariante und erfährt dadurch zunehmende
Relevanz. Die Quellenangaben werden dabei direkt in den Fließtext eingebunden. Alle im
Fließtext aufgeführten Quellen sind im Literaturverzeichnis gesammelt aufzuführen. An ein
direktes oder sinngemäßes Zitat anschließend wird die Quellenangabe folgendermaßen
aufgeführt (vgl. Theisen 2013: 175f.):
15Wirtschaft und Ethik [Stand: Mai 2016] Zitierweisen
Bezugnahme auf das Gesamtwerk: (vgl. Nachname des Autors Erscheinungsjahr).
Z.B.: (vgl. Wieland 2007).
Bis zu drei Autoren: (vgl. Nachname/Nachname/ggf. Nachnahme Erscheinungsjahr).
Z.B.: (vgl. Maak/Ulrich 2007).
Mehr als drei Autoren: (vgl. Nachname et al. Erscheinungsjahr).
Z.B.: (vgl. Wieland et al. 2006).
Bezugnahme auf einen spezifischen Seitenbereich:
Eine Seite: (vgl. Nachname Erscheinungsjahr: Seitenzahl).
Z.B.: (vgl. Wieland 2007: 27).
Zwei Seiten: (vgl. Nachname Erscheinungsjahr: Seitenzahl der ersten Seite f.).
Z.B.: (vgl. Schmidt/Schank 2011: 13f.).
Mehrere Seiten: (vgl. Nachname Erscheinungsjahr: Seitenzahl der ersten Seite ff.)
Z.B.: (vgl. Theisen 2012: 44ff.)
Verweis auf mehrere Quellen:
(vgl. Nachname Erscheinungsjahr; Nachname Erscheinungsjahr).
Z.B.: (vgl. Schmidt/Schank 2011: 13f.; Wieland 2007).
Sinngemäßes Zitat: (vgl. Nachname Erscheinungsjahr: Seitenbereich)
Z.B.: (vgl. Theisen 2006: 100f.)
Direktes Zitat: (Nachname Erscheinungsjahr: Seitenzahl)
Z.B.: (Esselborn-Krumbiegel 2004: 77)
Zitation von zitierten Passagen:
(Nachname des Autors der Originalquelle Erscheinungsjahr: Seitenzahl, zit. nach Nach-
name des Autors der verwendeten Quelle Erscheinungsjahr: Seitenzahl).
Z.B.: (Homann 2004: 11, zit. nach Aßländer 2011: 231).
16Wirtschaft und Ethik [Stand: Mai 2016] Zitierweisen
Sofern mehrere Beiträge eines Autors/einer Autorin aus demselben Erscheinungsjahr ver-
wendet werden, sind die Jahreszahlen – identisch mit der Bezeichnung im
Literaturverzeichnis – zusätzlich mit Kleinbuchstaben zu versehen. Sind Anmerkungen zum
Text notwendig, so werden diese in Form von Fußnoten aufgeführt.
4.2 Chicago Zitierweise (klassische Zitierweise)
ACHTUNG: In dem folgenden Abschnitt wird lediglich zur Veranschaulichung die Chicago
Zitierweise verwendet. Die Anwendung von zwei verschiedenen Zitierweisen innerhalb ei-
ner wissenschaftlichen Arbeit ist untersagt und wird hier nur zu Lehrzwecken aufgeführt.
Anders als bei der Harvard-Zitierweise werden die Literaturverweise bei der klassischen
Zitierweise nicht in den Fließtext eingebunden, sondern am Ende einer jeden Seite, sepa-
riert vom eigentlichen Text als Fußnote mit einfachem Zeilenabstand und in einer
Schriftgröße von 10pt aufgeführt. Sie sind fortlaufend mithilfe des arabischen Zahlensys-
tems zu nummerieren und werden im fortlaufenden Text hochgestellt angeführt. Handelt es
sich um ein direktes Zitat, so wird die Fußnote direkt im Anschluss an das Zitat eingefügt.
Andernfalls findet die Fußnote nach dem Satzzeichen ihre Anwendung. Am Ende einer je-
den Fußnote ist ein Punkt zu setzten, bei Überschriften sind keine Verweise anzubringen.
Sofern der Fußnotenverweis nicht unmittelbar nach einem direkten Zitat, welches durch
Anführungszeichen zu kennzeichnen ist, eingefügt ist, bezieht sich die Fußnote auf den
vorhergehenden Abschnitt. Insbesondere bei längeren zusammenhängenden Abschnitten,
die sich auf eine Quelle beziehen, ist es sinnvoll bereits zu Beginn des Abschnittes auf
diese zu verweisen (z.B. Nach Ulrich handelt es sich dabei ….).
Die Gestaltung von Fußnoten:
Sinngemäße Bezugnahme auf das Gesamtwerk:
1
Vgl. Nachname des Autors (Erscheinungsjahr).
Z.B.: 1 Vgl. Wieland (2007).
Bis zu drei Autoren:
2
Vgl. Nachname/Nachname/ggf. Nachnahme (Erscheinungsjahr).
Z.B.: 2 Vgl. Maak/Ulrich (2007).
Mehr als drei Autoren:
3
Vgl. Nachname et al. (Erscheinungsjahr).
Z.B.: 3 Vgl. Wieland et al. (2006).
17Wirtschaft und Ethik [Stand: Mai 2016] Zitierweisen
Bezugnahme auf einen spezifischen Seitenbereich:
Eine Seite: 4 Vgl. Nachname (Erscheinungsjahr): S. Seitenzahl.
Z.B.: 4 Vgl. Wieland (2007): S. 27.
Zwei Seiten: 5 Vgl. Nachname (Erscheinungsjahr): S. Seitenzahl der ersten Seite f.
Z.B.: 5 Vgl. Schmidt/Schank (2011): S. 13f.
Mehrere Seiten: 6 Vgl. Nachname (Erscheinungsjahr): S. Seitenzahl der ersten Seite ff.
Z.B.: 6 Vgl. Theisen (2012): S. 44ff.
Verweis auf mehrere Quellen:
7
Vgl. Nachname (Erscheinungsjahr): Seitenbezug; Nachname (Erscheinungsjahr):
Seitenbezug.
Z.B.: 7 Vgl. Schmidt/Schank (2011): S. 13f.; Wieland (2007): S. 53.
Handelt es sich um ein sinngemäßes Zitat, so ist vor der Angabe des Quellenverweises in
den Fußnoten der Vermerk „Vgl.“ (Vergleiche) einzufügen. Handelt es sich um ein direktes
Zitat, so entfällt dieser Verweis.3
Indirektes Zitat:
8
Vgl. Nachname (Erscheinungsjahr): Seitenbezug.
Z.B.: 8 Vgl. Theisen (2006): S. 65f.
Direktes Zitat:
9
Nachname (Erscheinungsjahr): Seitenzahl.
Z.B.: 9 Esselborn-Krumbiegel (2004): S. 38.
Zitation von zitierten Passagen:
10
Nachname des Autors der Originalquelle (Erscheinungsjahr): S. Seitenzahl, zit. nach
Nachname des Autors der verwendeten Quelle (Erscheinungsjahr): S. Seitenzahl.
10
Z.B.: Homann (2004): S. 11, zit. nach Aßländer (2011): S. 231.
3 Vgl. Theisen (2013): S. 169ff.
18Wirtschaft und Ethik [Stand: Mai 2016] Das Layout schriftlicher Arbeiten
5 Das Layout schriftlicher Arbeiten
Hauptkapitel (entsprechen der ersten Gliederungsebene) beginnen jeweils auf einer
neuen Seite.
Absätze müssen inhaltliche Einheiten bilden; Umfang eines Absatzes: mindestens zwei
Sätze.
Hervorhebungen (fett, kursiv, gesperrt) sind einheitlich zu wählen und sollten eher spar-
sam eingesetzt werden; Unterstreichungen sind zu vermeiden.
Tabelle 1: Gestaltung des Layouts
Papier Din A4, Hochformat, weiß, einseitig bedruckt
Arial (11pt), Times New Roman (12pt), Calibri (12pt)
Schriftart und –größe
Zitate über 40 Wörter: 10pt für alle Schriftarten
Textformatierung Blocksatz mit Silbentrennung
1,5-zeilig im Fließtext, 1-zeilig für Fußnoten und Zitate über 40
Zeilenabstand
Wörter
Seitenränder links: 3,0 cm / oben, rechts: je 2,5 cm / unten: 2,0 cm
Deckblatt: keine Nummerierung
Inhalts-, Abbildungs-, Tabellen- und Abkürzungsverzeich-
Seitennummerierung nis mit römischen Zahlen beginnend bei „I“
alles Weitere: arabische Zahlen beginnend mit „1“
Position der Nummerierung: Unten rechts
19Wirtschaft und Ethik [Stand: Mai 2016] Formale Gestaltung von wissenschaftlichen Postern
6 Formale Gestaltung von wissenschaftlichen Postern
Bei der Gestaltung von wissenschaftlichen Postern ist voranging die Kreativität der Refe-
rierenden gefragt (hierzu und zu den folgenden Ausführungen in diesem Absatz vgl.
Helmle/Hoffmann o.J.). Daher wird der gestalterischen Freiheit im Rahmen der wissen-
schaftlichen Poster ein großer Spielraum beigemessen. Einige Hinweise gilt es dennoch zu
beachten:
Das Thema, welches das Poster behandelt, muss deutlich ersichtlich sein.
Dieselben Informationen, die in der Titelfolie von PowerPoint-Präsentationen ent-
halten sein sollten sowie die verwendeten Quellen sind in dem Poster aufzuführen.
Diese können jedoch in kleiner Schriftgröße (z.B. 10pt.) zum Beispiel auf der Rück-
seite des Posters angebracht werden.
Richtwert zur Postergröße: DIN A0
Ein Fließtext ist weitestgehend zu vermeiden und die Arbeit sollte mit visuellen Rei-
zen in den Vordergrund treten. Dies kann z.B. mithilfe von Diagrammen (mit
Legenden!), Bildern oder Zeichnungen geschehen.
Die wissenschaftlichen Poster sind nicht zwangsläufig PC-gestützt zu gestalten.
Im Vordergrund der Gestaltung von wissenschaftlichen Postern steht die Kreativität sowie
die didaktische Aufbereitung und Konstruktion zur Präsentation eines spezifischen Themas.
Aus diesem Grund sind keine vorgefertigten Poster als Beispiele aufgeführt.
20Wirtschaft und Ethik [Stand: Mai 2016] Formale Gestaltung von PowerPoint-Präsentationen
7 Formale Gestaltung von PowerPoint-Präsentationen
Obgleich die Gestaltung von PowerPoint-Präsentationen größtenteils der Kreativität der
Vortragenden obliegt, gilt es dennoch einige wichtige strukturelle Hinweise zu beachten.
Eine PowerPoint-Präsentation sollte folgende Gliederung aufweisen:
Titelfolie
Gliederung des Vortrags
Definitionen und Erläuterungen
Hauptteil
Fazit
Abschlussfolie
Quellenverzeichnis
Literatur
Internetquellen
Nachweise für Bilder und Grafiken
7.1 Allgemeine Hinweise zur Gestaltung von PowerPoint-
Präsentationen
Innerhalb dieses Teilabschnittes werden einige Hinweise zur formalen Gestaltung von
PowerPoint-Präsentationen gegeben (hierzu und zu den folgenden Ausführungen in die-
sem Absatz vgl. Renz 2013):
Die Einhaltung des vorgegebenen zeitlichen Rahmens ist essenziell. Signifikante
Abweichungen hinsichtlich der Dauer des Vortrages können negativ in die Bewer-
tung einfließen. (Orientierungshilfe: Pro Folie werden in der Regel 1-3 Minuten
Vortragszeit benötigt.)
Die Funktionstüchtigkeit und Kompatibilität von technischen Geräten sollte vorab
überprüft werden, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.
Die Präsentation sollte dem/der Dozierenden am Tag des Vortrags in gedruckter
Form zur Verfügung gestellt werden.
Von einer übermäßigen Nutzung farblicher Akzente und überbordender Animatio-
nen ist dringend abzuraten. Die Einbringung von Fließtexten sollte vermieden
werden.
Nach Möglichkeit sollte das Layout der Präsentation auf einem hellem Hintergrund
und dunkler Schrift beruhen.
21Wirtschaft und Ethik [Stand: Mai 2016] Formale Gestaltung von PowerPoint-Präsentationen
Die verwendete Schriftart sollte gut lesbar und möglichst schnörkellos sein. Wie
auch in schriftlichen Arbeiten sind insbesondere die Schriftarten Arial oder Calibri
zu empfehlen.
Die verwendete Schriftgröße sollte 18pt. nicht unterschreiten.
Sofern dies möglich ist sollten pro Folie nicht mehr als 7-9 Zeilen mit maximal
je 5-7 Wörtern verwendet werden.
Die Rechtschreibung in der Präsentation sollte dringend überprüft werden.
Die Folien – Titelfolie ausgenommen – sollten fortlaufend nummeriert werden.
Folien sollten stets mit Überschriften versehen werden.
Erforderliche Quellenverweise sollen der Harvard Methode entsprechen.
7.2 Titelfolie
Die Titelfolie einer jeden PowerPoint-Präsentation enthält folgende Informationen:
Vortragsthema
Vor- und Nachname der Referierenden
Vor- und Nachname des/der Dozierenden (mit Angabe des akademischen Grades)
Datum des Vortrags
Bezeichnung der Veranstaltung
Das Vortragsthema soll hervorgehoben werden.
7.3 Gliederung
Der Titelfolie folgt eine Folie mit der Gliederung des Vortrags, um die Struktur für die Zuhö-
rerInnen besser nachvollziehbar zu gestalten. Die Gliederung soll dabei einen groben
Überblick verschaffen und nicht zu feingliedrig gestaltet sein. Die eingangs vorgestellte
Gliederung muss sich im Rahmen des gesamten Vortrags widerspiegeln.
7.4 Abschlussfolie
Die letzte Folie eines jeden Vortrags sollte einen Dank an die ZuhörerInnen für die entge-
gengebrachte Aufmerksamkeit enthalten.
22Wirtschaft und Ethik [Stand: Mai 2016] Formale Gestaltung von PowerPoint-Präsentationen
7.5 Quellenverzeichnis
Die Gestaltung des Quellenverzeichnisses bei PowerPoint-Präsentationen entspricht den
Anforderungen eines Literaturverzeichnisses in einer schriftlichen Arbeit. Nähere Informa-
tionen dazu sind unter Punkt 3.4 „Literaturverzeichnis“ nachzulesen.
23Wirtschaft und Ethik [Stand: Mai 2016] Weiterführende Literatur
8 Weiterführende Literatur
Brink, Alfred (2013): Anfertigung wissenschaftlicher Arbeiten: Ein prozessorientierter Leit-
faden zur Erstellung von Bachelor-, Master und Diplomarbeiten, 5. überarbeitete und
aktualisierte Auflage, Dobrecht: Springer.
Esselborn-Krumbiegel, Helga (2008): Von der Idee zum Text – eine Anleitung zum wis-
senschaftlichen Schreiben, 3. überarbeitete Auflage, Paderborn u.a.: UTB.
Heinz, Andreas / Reuter, Julia / Zillien, Nicole (2011): Leitfaden wissenschaftliches Ar-
beiten – Wie schreibe ich Seminar- und Abschlussarbeiten im Fach Soziologie an
der Universität Trier?, online im Internet unter: https://www.uni-trier.de/filead-
min/fb4/ETH/Formalia/Leitfaden_wiss._Arbeit.pdf, letzter Aufruf: 04.02.2016, 16:02
Uhr.
Karmasin, Matthias / Ribing, Rainer (2006): Die Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten
– ein Leitfaden für Seminararbeiten, Bachelor-, Master- und Magisterarbeiten sowie
Dissertationen, 5. komplett überarbeitete Auflage, Wien: WUV.
Krämer, Walter (2009): Wie schreibe ich eine Seminar- oder Examensarbeit?, 3., überar-
beitete und aktualisierte Auflage, Frankfurt u.a.: Campus Verlag.
Theisen, Manuel René (2013): Wissenschaftliches Arbeiten – Erfolgreich bei Bachelor-
und Masterarbeit, 16., vollständig überarbeitete Auflage, München: Vahlen Verlag.
Wytrzens, Hans Karl / Schauppenlehner-Kloyber, Elisabeth / Sieghardt, Monika / Grat-
zer, Georg (2014): Wissenschaftliches Arbeiten – Eine Einführung,
4., aktualisierte Auflage, Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels AG.
24Wirtschaft und Ethik [Stand: Mai 2016] Anhang
Anhang
Anhang 1: Musterdeckblatt ..............................................................................................26
Anhang 2: Nummerische und alphanummerische Mustergliederungen ............................27
Anhang 3: Eidesstattliche Erklärung / Eigenständigkeitserklärung ...................................29
Anhang 4: Zusammenfassung der wichtigsten Formalia ..................................................30
Anhang 5: Checkliste zum Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten ...................................34
Anhang 6: Häufige Fehler ................................................................................................36
25Wirtschaft und Ethik [Stand: Mai 2016] Anhang
Anhang 1: Musterdeckblatt
Universität Vechta
Department I
Bachelor Combined Studies
Wirtschaft und Ethik: Social Business
Sommersemester 2016
WE-6.1 Propädeutikum wissenschaftliches Arbeiten
Hausarbeit
Thema
Dozent: Prof. Dr. Max Mustermann
Datum der Abgabe: tt.mm.jjjj
Anzahl der Zeichen: 12.345
Verfasser/in: Erika Musterfrau
Matrikelnummer: 123456
Fachsemester: 4
Anschrift: Musterallee 1, 12345 Musterhausen
E-Mail: max.mustermann@mail.uni-vechta.de
Telefon: 0172 1234567
Abbildung 1: Musterdeckblatt
26Wirtschaft und Ethik [Stand: Mai 2016] Anhang
Anhang 2: Nummerische und alphanummerische Mustergliederungen
Inhaltsverzeichnis (Nummerische Gliederung)
Abbildungsverzeichnis IV
Tabellenverzeichnis V
Abkürzungsverzeichnis VI
1 Einleitung 3
2 Allgemeine Pädagogik 5
2.1 Geschichte der Pädagogik 6
2.1.1 Mittelalter 12
2.1.2 Aufklärung 19
2.2 Erziehung 25
2.2.1 Erziehungsziele 29
2.2.2 Erziehungsmittel 35
3 Schulpädagogik 41
3.1 Didaktische Modelle 59
3.1.1 Bildungstheoretische Didaktik 68
3.1.2 Lerntheoretische Didaktik 75
3.2 Schulsystem 82
3.2.1 Dreigliedriges Schulsystem 87
3.2.2 Gesamtschule 92
4 Zusammenfassung 99
Anhang 102
Literaturverzeichnis 108
Eidesstattliche Erklärung 111
Abbildung 2: Nummerische Gliederung
27Wirtschaft und Ethik [Stand: Mai 2016] Anhang
Inhaltsverzeichnis (Alphanummerische Gliederung)
Abbildungsverzeichnis IV
Tabellenverzeichnis V
Abkürzungsverzeichnis VI
A. Einleitung 3
B. Allgemeine Pädagogik 5
I. Geschichte der Pädagogik 6
1. Mittelalter 12
2. Aufklärung 19
II. Erziehung 25
1. Erziehungsziele 29
2. Erziehungsmittel 35
C. Schulpädagogik 41
I Didaktische Modelle 59
1. Bildungstheoretische Didaktik 68
2. Lerntheoretische Didaktik 75
2. Schulsystem 82
1. Dreigliedriges Schulsystem 87
a) Hauptschule 88
b) Realschule 89
c) Gymnasium 90
2. Gesamtschule 92
D. Zusammenfassung 99
Anhang 102
Literaturverzeichnis 108
Eidesstattliche Erklärung
111
/ Eigenständigkeitserklärung
Abbildung 3: Alphanummerische Gliederung
28Sie können auch lesen