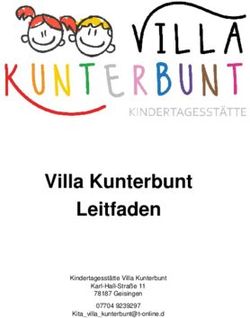Lernen auf Distanz Konzept zur Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht - Astrid-Lindgren-Schule - Astrid-Lindgren-Schule (Bonn)
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Lernen auf Distanz
Konzept zur Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht
Astrid-Lindgren-Schule
Förderschule mit dem
Schwerpunkt Sprache
Ludwig-Richter-Str. 29, 53123 Bonn
Stand Oktober 2020Inhalt
1 Grundsätze und Zielsetzungen ........................................................................................... 2
2 Verantwortlichkeiten und rechtliche Vorgaben .............................................................. 3
3 Organisatorische Planung ................................................................................................... 4
3.1 Schulische Ausgangssituation ........................................................................................4
3.2 Häusliche Lernumgebung der Schülerinnen und Schüler ........................................6
4 Pädagogische Planung: Pädagogische und methodisch-didaktische Aspekte .. 10
4.1 Aktuelle Regelungen und schulische Vorgehensweisen im Distanzunterricht 11
4.2 Perspektivische Erweiterung der methodisch-didaktischen Leitlinien .............. 13
4.3 Systematische Unterrichtentwicklung bei der Verknüpfung von Präsenz- und
Distanzunterricht............................................................................................................... 14
4.4 Aspekte der Sprachförderung von Schülerinnen und Schülern mit dem
Förderschwerpunkt Sprache im Distanzunterricht .................................................. 17
5 Literatur ................................................................................................................................... 19
6 Anhang .................................................................................................................................... 20
11 Grundsätze und Zielsetzungen
Die Covid-19-Pandemie und die damit verbundene vorübergehende Schließung der
Astrid-Lindgren-Schule im März 2020, hat Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehr-
kräfte, OGS-Mitarbeitende und Schulleitung vor große Herausforderungen gestellt. Die
Bewältigung der Krisenorganisation vor und während der Schulschließung, die Orga-
nisation der durchgängigen Notbetreuung von Kindern, deren Eltern in sogenannten
systemrelevanten Berufen arbeiten, und der anschließenden, kurzfristigen Rückkehr
in den Präsenzunterricht vor den Sommerferien, war durch Maßnahmen, Vorgaben
und Hinweise für die Schulen in Nordrhein-Westfalen geprägt mit dem Ziel einen dem
Infektionsgeschehen angepassten Schulbetrieb in Corona-Zeiten sicherzustellen.
Im Schuljahr 2020/2021 soll der Schul- und Unterrichtsbetrieb wieder möglichst
vollständig im Präsenzunterricht stattfinden. Dabei muss der Schutz der Gesundheit
der Lehrkräfte, der Schülerinnen und Schüler, sowie aller am Schulleben Beteiligten
sichergestellt sein.
Das schulinterne „Konzept zum Lernen auf Distanz“ und eine damit verbundene
bedarfsorientierte Anpassung der Fortbildungsplanung, ist in Anlehnung an die „Hand-
reichung zur lernförderlichen Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht“ (MSB
8/2020) erstellt worden.
Abb. 1 aus Bezirksregierung Köln, Handreichungen Schulleitungen, 2020-08-31 (PPT)
Ziel unseres Konzeptes ist somit, notwendige Maßnahmen und organisatorische Um-
setzungen von Präsenz- und Distanzunterricht vorzubereiten, um einen strukturierten
und unmittelbaren Wechsel beider Unterrichtsformen zu ermöglichen.
22 Verantwortlichkeiten und rechtliche Vorgaben
Für das Schuljahr 2020/21 sind die rechtlichen Vorgaben durch die „Zweite Verord-
nung zur befristeten Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung gemäß §52
SchulG“ erweitert worden. Damit ist der Distanzunterricht als Ergänzung zum Präsenz-
unterricht rechtlich verankert und als gleichwertige Unterrichtsform definiert worden.
„Der Distanzunterricht beruht auf einem pädagogischen und organisatorischen Plan.
Für den Distanzunterricht gelten die Unterrichtsvorgaben des Ministeriums und die
schuleigenen Unterrichtsvorgaben gemäß §29 des Schulgesetzes NRW. Die Schullei-
terin oder der Schulleiter richtet im Bedarfsfall den Distanzunterricht im Rahmen der
Unterrichtsverteilung ein und informiert die zuständige Schulaufsicht und die Schul-
konferenz darüber“ (MSB 8/2020, S. 5).
Die Organisation des Distanzunterrichts sowie die pädagogisch-didaktische Beglei-
tung der Schülerinnen und Schüler liegen in der Verantwortung der Lehrkräfte. Ihr Ein-
satz ist im Präsenz-und Distanzunterricht in Bezug auf ihren Stundenumfang ihrer Un-
terrichtsverpflichtung gleichwertig.
Der Distanzunterricht, egal ob in analoger oder digitaler Form, wird damit im Schuljahr
2020/21 gegenüber dem Präsenzunterricht als gleichwertig angesehen. Damit sind
alle Schülerinnen und Schüler verpflichtet, am Distanzunterricht teilzunehmen. Die im
Schulgesetzt aufgeführten Vorgaben zur Leistungsüberprüfung (§29) und
Leistungsbewertung (§48) sind auch auf die Leistungen, die während des Distanz-
unterrichts erbracht wurden, übertragbar. Das heißt, die Kenntnisse, Fähigkeiten und
Fertigkeiten, die den Schülerinnen und Schülern während des Distanzunterrichts
vermittelt wurden, werden in die Bewertung mit einbezogen. Dabei sollen auch der
Entstehungsprozess und der Lernweg sowie die erforderlichen Rahmenbedingungen
(ruhiger Arbeitsplatz, Unterstützungsmöglichkeiten, Zugang zu Medien) mit
einbezogen werden. Schriftliche Leistungsüberprüfungen finden in der Regel weiterhin
im Rahmen des Präsenzunterrichts statt.
Eltern und Erziehungsberechtigte entscheiden für ihre Kinder, welche eine relevante
Vorerkrankungen haben, ob der Besuch des Präsenzunterrichts eine gesundheitliche
Gefährdung darstellt und benachrichtigen schriftlich die Schule, sollte diese Gefähr-
dung gegeben sein. Bei begründeten Zweifeln kann die Schule von den Erziehungs-
berechtigten ein ärztliches Attest verlangen. Die Eltern der vom Präsenzunterricht frei-
gestellten Schülerinnen und Schüler sind gemäß §6, Zweite Verordnung zur befriste-
ten Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung gemäß §52 SchulG, dafür ver-
antwortlich, dass ihr Kind der Pflicht zur Teilnahme am Distanzunterricht nachkommt.
33 Organisatorische Planung
Als Regelfall soll der Schul- und Unterrichtsbetrieb wieder möglichst vollständig im
Präsenzunterricht in voller Gruppenstärke stattfinden. Der Distanzunterricht muss
umgesetzt werden, wenn Schülerinnen und Schüler aus gesundheitlichen Gründen
nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, eine Quarantäne für einzelne Kinder
oder Klassen angeordnet ist oder ein Lockdown erfolgt.
Um ein Lernen auf Distanz möglichst effektiv und lerngruppenspezifisch analog und
digital umsetzen zu können, sind Kenntnisse bei den Kolleginnen im Umgang mit
digitalen Medien und Tools erforderlich, die über geeignete Fortbildungsmaßnahmen
zu sichern sind. Seit Schuljahresbeginn ist die Arbeitsgruppe “Lernen auf Distanz”,
bestehend aus jeweils einer Kollegin pro Stufe, eingerichtet.
Grundlage für die Organisation von Präsenz- und Distanzunterricht ist die individuelle
Ausgangslage der Schule, das häusliche Umfeld und der Zugang zu digitalen End-
geräten der Schülerinnen und Schüler, aber auch das Alter, die Bedarfe und die Fähig-
keiten zum selbstreguliertem Lernen.
3.1 Schulische Ausgangssituation
Die Astrid-Lindgren-Schule ist eine Förderschule der Stadt Bonn mit dem
Förderschwerpunkt Sprache. Unsere Schule wird von Kindern mit sonderpäda-
gogischem Unterstützungsbedarf im Bereich Sprache besucht: Diese werden
zielgleich nach den Richtlinien und Lehrplänen der Grundschule unterrichtet. Darüber
hinaus besuchen auch Kinder, die zieldifferent im Förderschwerpunkt Sprache plus
Lernen unterrichtet werden, die Astrid-Lindgren-Schule. Außerdem bietet die Schule
für Kinder mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation (Schwerhörigkeit)
ein schulisches Angebot, das in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum des LVR für
Hören und Kommunikation in Köln abgestimmt ist.
Im Schuljahr 2020/21 werden 161 Kinder in 10 Klassen von insgesamt 20 Sonder-
pädagoginnen, einer entfristeten Lehrerin, zwei Lehramtsanwärterinnen und zwei
Praxissemesterstudierenden unterrichtet. Eine von 21 Lehrerinnen gehört aufgrund
einer Vorerkrankung zur sogenannten Risikogruppe und kann damit nicht im Präsenz-
unterricht eingesetzt werden. Ergänzt wird unser Team von einer Schulsozial-
arbeiterin, unserem Hausmeister und unserer Schulsekretärin. 20 Schülerinnen und
Schüler werden von Integrationsassistentinnen und Integrationsassistenten begleitet.
Die zur Verfügung stehenden technischen Ressourcen sind derzeit ein iPad Koffer mit
17 iPads für den Einsatz im Präsenzunterricht, ein PC im Lehrerzimmer inkl. Drucker,
ein Whiteboard (Klassenraum) und drei Verwaltungsrechner. Darüber hinaus stehen
in den Klassenräumen bis zu zwei internetfähige Schüler-PCs, welche jedoch über 12
Jahre alt sind. In zwei Klassenräumen gibt es keinen Internetanschluss (vgl. Medien-
konzept).
4Die Arbeitsgruppe „Lernen auf Distanz“ hat sowohl eine Kollegiumsbefragung als auch
eine Elternerhebung durchgeführt, um die Erfahrungen zum vorausgegangenen
„Homeschooling“ zu ermitteln und um die technischen Voraussetzungen in den
Familien für die weiteren methodisch-didaktischen Planungen im Lernen auf Distanz
berücksichtigen zu können.
Folgende Fortbildungsbedarfe hat die Arbeitsgruppe präzisiert:
Nutzung des iPads im Präsenz- und Distanzunterricht (Handhabung, Möglich-
keiten, usw.)
Nutzung des Padlets im Präsenz- und Distanzunterricht (Handhabung, Mög-
lichkeiten, usw.)
Erstellung von Erklärvideos im Präsenz- und Distanzunterricht (Handhabung,
Möglichkeiten, usw.)
Nutzung der Videofunktion der SchoolFox App im Distanzunterricht (sichere
Handhabung)
Nutzung der Plattform LOGINEO NRW (Handhabung, Möglichkeiten, usw.)
Die derzeitige Auslastung der Medienberater und Medienberaterinnen und anderer
Fortbildungsanbieter in diesem Themenfeld macht die Nutzung kollegiumsinterner
Kompetenzen erforderlich und wird zeitnah umgesetzt. Durch die Nutzung dieser
Ressourcen kann gleichzeitig spezifisch orientiert an unserer Schüler- und Elternschaft
zu den jeweiligen Themen gearbeitet werden.
Drei Kolleginnen stehen als Ansprechpartnerinnen für den Umgang mit den
schulischen iPads zur Verfügung. Sie selbst haben im September 2020 an einer
Fortbildung des Medienzentrums Bonn teilgenommen und fungieren als
Multiplikatorinnen. Ein erster Workshop zum Thema Erklärvideos wurde im Oktober
2020 durch eine Kollegin durchgeführt, ein Workshop zur Erstellung
klassenspezifischer Padlets wird Anfang November stattfinden. Um eine einheitliche
Informations- und Kommunikationsstruktur innerhalb des Kollegiums, aber auch zu
Schülerinnen und Schülern sowie den Eltern sicherzustellen, nutzt die Schule seit
März 2020 die App „SchoolFox“ Hierzu wurde im August ein kollegiumsinterner
Workshop durch eine Kollegin durchgeführt. Eltern erhielten außerdem am 20.08.20
in den Klassenpflegschaftssitzungen Informationen zu erweiterten Nutzungs-
funktionen. Die App „SchoolFox“ soll im Falle eines Distanzunterrichts auch zur
Durchführung von Videomeetings genutzt werden. Diese Funktion soll in den
kommenden Wochen mit Schülerinnen und Schülern und Lehrerinnen regelmäßig
erprobt werden. Die Plattform LOGINEO wird sukzessive durch die beiden
Medienkoordinatorinnen aufgebaut. Hierzu haben sie an einer Fortbildung der
Medienberatung Bonn im März 2020 teilgenommen und diverse Tutorials genutzt. Sie
informieren das Kollegium fortlaufend über die Nutzung und Neuerungen und stehen
den Kolleginnen für individuelle Fragen zur Verfügung (vgl. Schulprogramm und
Fortbildungskonzept).
53.2 Häusliche Lernumgebung der Schülerinnen und Schüler
Die Arbeitsgruppe „Lernen auf Distanz“ hat zu Beginn des Schuljahres 2020/21 eine
Elternbefragung zum Thema Lernen auf Distanz durchgeführt (s. Anhang).
Vorgehen und Umfrage
Vorbereitend wurde in den Jahrgangsstufen gesammelt:
Welche Lern- und Unterstützungsangebote wurden in der Zeit der Schulschlie-
ßung und im Anschluss während des sog. rollierenden Systems von Präsenz-
und Distanzunterricht eingesetzt?
Wie wurden die Materialien, Aufgaben, Rückmeldungen etc. organisiert?
Welche Herausforderungen konnten beobachtet werden?
Die Ergebnisse wurden in der Arbeitsgruppe zusammengetragen. Basierend auf
dieser Sammlung wurde entschieden, nicht nur die technischen bzw. häuslichen
Voraussetzungen für ein Lernen auf Distanz bei den Familien zu erheben, sondern
auch von den Erziehungsberechtigten eine Rückmeldung zu den eingesetzten
Materialien und Unterstützungsangeboten zu erfragen. Diese Fragen stellen den
ersten Teil des Fragebogens dar (Abb. 2).
Abb. 2 Auszug Schulinterner Fragebogen zum Lernen auf Distanz (Teil 1)
Als Antwortoptionen zur Frage 1 wurde eine 4-stufige Skala gewählt, um den Effekt
einer Tendenz zur Mitte zu vermeiden.
Im zweiten Teil haben wir uns an den Fragen „Ist-Zustand der Schülerinnen und
6Schüler“ der „Handreichung zur lernförderlichen Verknüpfung von Präsenz- und
Distanzunterricht“ (MSB, 2020) orientiert (s. Abb. 3).
Abb. 3 Auszug Schulinterner Fragebogen zum Lernen auf Distanz (Teil 2)
Der Fragebogen wurde im Rahmen der Elternpflegschaftssitzungen am 20.08.2020
verteilt. So konnte ein möglichst hoher Rücklauf gewährleistet werden und Eltern
konnten (insbesondere sprachliche) Verständnisfragen direkt vor Ort klären. Eltern, die
an diesem Abend nicht anwesend waren, erhielten den Fragebogen über Ihr Kind
(Postmappe). Die qualitative und quantitative Auswertung erfolgte im Anschluss durch
die Klassenleitungen (Auszählung der Nennung via Strichliste) bzw. die Arbeitsgruppe
(weitere Auswertung über die Klassen hinweg).
Ergebnisse: Fragebogen Teil 1
Der Rücklauf bezüglich des ersten Teils des Fragebogens beträgt 78 % (100/128
Fragebögen).
Frage 1: Wie konnte ihr Kind mit folgenden Materialien arbeiten?
Jeweils etwa 60% der Eltern gaben zu Arbeitsblättern, Arbeitsheften und dem
Wochenplan an, dass ihr Kind damit (weitgehend) selbständig arbeiten konnte. Zu den
digitalen Angeboten Anton App, Erklärvideos und Youtube Videos gab es in 24-38%
der Fälle keine Angabe, da diese nicht in allen Klassen gleichermaßen zum Einsatz
kamen. Diejenigen, die Angaben gemacht haben, kommen zu einer positiven
Einschätzung hinsichtlich der Selbständigkeit im Umgang mit diesen digitalen
Angeboten (s. Abb. 4).
7Abb. 4. Ergebnisse zur Frage 1
Frage 2: Das hat mir/uns als Eltern geholfen, unser Kind beim Lernen zu unterstützen:
88% der Eltern gaben an, dass der Wochenplan ihnen als Eltern geholfen habe, ihr
Kind beim Lernen zu unterstützen. Etwa die Hälfte der Eltern fand ferner Hilfsmittel
(49%) und Telefonate mit der Lehrkraft (44%) hilfreich. Der Austausch mit anderen
Eltern wurde von knapp einem Drittel (27%) als hilfreich erlebt.
Vor dem Hintergrund der Ergebnisse aus dem ersten Teil des Fragebogens soll ein
Wochenplan zukünftig (weiterhin) zentraler Bestandteil in Phasen mit Lernen auf
Distanz sein. Digitale Angebote sollen ergänzend zu den im Präsenz- wie auch
Distanzunterricht genutzten herkömmlichen Materialien (Arbeitsblätter, Hefte)
ausgebaut und mit den Schülerinnen und Schülern sukzessive geübt werden. Die
Erreichbarkeit von Lehrkräften und der kontinuierliche Austausch zwischen
Schülerinnen und Schülern und ggf. Eltern muss des Weiteren stets gewährleitet sein.
Ergebnisse: Fragebogen Teil 2
Die Erziehungsberechtigten aus den Klassen SEP 1a und 1b füllten lediglich den
zweiten Teil der Umfrage aus, da diese Kinder (Schulneulinge) zur Zeit der
Schulschließung und des Lernens auf Distanz noch nicht eingeschult waren.
Gleichzeitig wurde von einzelnen Erziehungsberechtigten aus höheren
Jahrgangsstufen der zweite Teil des Fragebogens leider nicht ausgefüllt (5,2%). Der
Rücklauf für Teil 2 beträgt 71 % (114/160). Die Ergebnisse zu den häuslichen
Voraussetzungen sind in Abb. 5 abgebildet.
8Abb. 5 Ergebnisse zur Frage 3 (Häusliche Voraussetzungen)
Hervorzuheben ist, dass über 20% der befragten Haushalte über kein Endgerät
verfügen, an denen das Kind arbeiten kann. Es wurde nicht differenziert erfragt, wie
viele Endgeräte in einem Haushalt bei wie vielen (Geschwister)Kindern vorliegen und
ob Erziehungsberechtigte die Geräte ggf. für Arbeiten im Home-Office selbst
benötigen. Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass die Zahl derer, die
nicht bzw. nicht immer über ein Endgerät verfügen, noch höher liegt. Ebenfalls
hervorzuheben ist, dass weniger als die Hälfte (46%) der befragten Haushalte über
einen Drucker verfügt, um Material eigenständig auszudrucken.
Des Weiteren wurde in 71% der Fälle angegeben, dass das Kind über einen
Arbeitsplatz verfüge, wobei einzelne Eltern anmerkten, dass es zwar einen
Schreibtisch und ggf. ein Zimmer gebe, dass jedoch Geschwisterkinder vorhanden
seien, die diese z.T. ebenfalls nutzen müssten. 64% der Befragten gaben an, ihr Kind
bei der technischen Umsetzung unterstützen zu können.
Es ist festzuhalten, dass unsere Schülerinnen und Schüler an ganz unterschiedlichen
Endgeräten zuhause arbeiten und dass mindestens ein Fünftel der Schülerschaft über
kein adäquates Endgerät verfügt und lediglich am Smartphone digitale Angebote
nutzen kann. Deshalb ist eine einheitliche Ausstattung der Schülerinnen und Schüler
mit den gleichen Endgeräten zwingend erforderlich, damit die Arbeit an und mit diesen
sinnvoll im Unterricht vorbereitet werden kann.
Neben digitalen Angeboten müssen unsere Schülerinnen und Schüler weiterhin mit
Arbeitsmaterialien in Papierform versorgt werden. Diese Versorgung muss durch
Abholung oder postalische Versendung erfolgen, da für einen hohen Anteil der Kinder
nicht gewährleistet ist, dass Materialien zuhause ausgedruckt werden können.
Die hier dargestellten Ergebnisse und Schlussfolgerungen fließen in die im Folgenden
dargestellte pädagogische Planung unmittelbar ein.
94 Pädagogische Planung: Pädagogische und methodisch-
didaktische Aspekte
Gemäß der oben genannten Handreichung sollte der Unterricht so geplant werden,
dass Veränderungen im Bereich des Präsenz-Distanz-Reglers möglichst wenige
Anpassungen notwendig machen. Das bedeutet, dass eine vorausschauende
Unterrichtsplanung die Lernprozesse so gestaltet, dass sie didaktisch und methodisch
nicht einseitig von einer Präsenz im Klassenraum abhängig sind. Dabei dürfen neben
der Förderung der Kompetenzerwartungen, die emotionalen und sozialen Bedürfnisse
der Schülerinnen und Schüler und die Beziehungsarbeit nicht außer Acht gelassen
werden.
Weitere Faktoren, die bei der Planung berücksichtigt werden müssen sind:
Schulform (Förderschule Sprache in der Primarstufe)
Jahrgangsstufen (SEP 1, SEP 2; SEP 3, Klasse 3, Klasse 4)
Individuelle Kompetenzen (Sprachkompetenz, Lernstand, Selbstregulation, Medi-
enkompetenz, ...)
Voraussetzungen in der häuslichen Umgebung
Technische Möglichkeiten der Schule
Voraussetzungen bei den Schülerinnen und Schülern, welche zum Gelingen eines
lernförderlichen Distanzunterrichts beitragen, sind, dass sie in der Lage sind, ihre
Lernprozesse selbst zu steuern, mit anderen (medienkompetent) zu kommunizieren
und zu kooperieren sowie Lernwege und -produkte kritisch zu hinterfragen.
„Der Umkehrschluss gilt jedoch auch: Wenn die genannten Kompetenzen nicht aus-
reichend entwickelt sind, können viele Unterrichtsvorhaben, die didaktisch prinzipiell
sinnvoll sind, in der Praxis nur im Ansatz realisiert werden. Enger geführte Unterrichts-
szenarien mit weniger Spielraum für die Entfaltung individueller Zugänge sind dann oft
die einzig mögliche Alternative“ (MSB 8/2020, S. 17).
Die oben genannten Faktoren sind der rote Faden bei der Konkretisierung des
schuleigenen Konzeptes zum Lernen auf Distanz und bilden die Zielperspektive.
Gleichzeitig müssen schnelle Umsetzungspläne zum jeweiligen aktuellen Zeitpunkt ein
Lernen auf Distanz sicherstellen.
Im Folgenden werden nun kurzfristige und perspektivische Vorgehensweisen und die
Weiterentwicklung des Unterrichts dargelegt, mit dem Ziel eine lernförderliche
Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht an der Astrid-Lindgren-Schule
sicherzustellen.
104.1 Aktuelle Regelungen und schulische Vorgehensweisen im
Distanzunterricht
Die Schule hat durch die Schulkonferenz beschlossen, dass die App SchoolFox als
Kommunikationsplattform mit Eltern, Schülerinnen und Schülern und dem Kollegium
verwendet wird. Somit ist eine einheitliche, verbindliche, effektive und nachhaltige
Kommunikationsstruktur etabliert.
Das Prinzip der Wochenplanarbeit ist den Schülerinnen und Schülern in abgestufter
Form, beispielsweise in Form von Hausaufgabenplänen, bekannt und wurde in der
Elternbefragung als hilfreich rückgemeldet. Ein Wochenplan soll daher weiterhin
zentraler Bestandteil in Phasen mit Lernen auf Distanz sein. Um digitale Angebote
(z.B. die Lern-App ANTON) einfach zugänglich in den Wochenplan integrieren zu
können und um eine motivierende Struktur der Pläne zu erhalten, wurde entschieden,
einen digitalen Wochenplan in Form eines Padlets (digitale Pinnwand) zur Verfügung
zu stellen. Dabei wird der Wochenplan innerhalb einer Stufe einheitlich gestaltet sein
und Aufgaben für die Unterrichtsfächer Deutsch, Mathematik, Englisch und
Sachunterricht für eine Schulwoche enthalten.
Eine feste Tagesstruktur soll den Schülerinnen und Schülern das selbständige
Arbeiten zuhause erleichtern. Hierzu soll es täglich um 9 Uhr ein gemeinsames
Klassenmeeting zum Start in den Tag via Videokonferenz über die App SchoolFox
geben. Ferner soll der Unterrichtstag um 12 Uhr gemeinsam ebenso via
Videokonferenz beendet werden. Diese Meetings bieten zudem Raum Fragen zu
Lerninhalten zu stellen und Feedback zum Arbeiten zu erhalten. Zusätzlich können
selbsterstellte oder vorhandene Erklärvideos, die über SchoolFox oder das Padlet zur
Verfügung gestellt werden sowie bei Bedarf individuelle Beratungen via SchoolFox
das Lernen auf Distanz unterstützen.
Da der Quarantänefall in der Regel nicht vorhersehbar ist, sollen die orangenen
Mappen, die an der Schule bisher in Vertretungsfällen genutzt wurden, spontan
eingesetzt werden können. In diesen Mappen werden Arbeitsblätter von der
Klassenlehrerin eingeheftet, mithilfe derer kurzfristiges und selbstständiges Lernen zu
Hause möglich ist.
Die Versorgung mit einem Wochenplan, analogen Arbeitsmaterialien und gegeben-
enfalls digitalen Endgeräten erfolgt am dritten Tag des Lernens auf Distanz. Die Art
der Verteilung an die Schülerinnen und Schüler hängt vom jeweiligen Szenario und
von den rechtlichen Vorgaben durch das Gesundheitsamt ab.
Die Ergebnisse der schulinternen Erhebung verdeutlichen, dass vielen Schülerinnen
und Schülern unserer Schule zu Hause kein digitales Endgerät zur Verfügung steht.
Um alle Vereinbarungen einhalten zu können, benötigen diese jedoch ein digitales
Endgerät, welches über ein schulisches Ausleihsystem zur Verfügung gestellt werden
müsste. Falls diese Möglichkeit bis zu einer nächsten Phase des Lernens auf Distanz
nicht vorhanden ist bzw. es noch keine Regelung zur Verteilung der Endgeräte gibt,
11wird der mit dem Padlet erstellte Wochenplan ausgedruckt und dem Arbeitsmaterial
beigelegt. Weiterhin stehen Lehrerinnen mit den Kindern, die aufgrund fehlender
technischer Mittel nicht an den Videokonferenzen teilnehmen können, telefonisch in
Kontakt.
Bei angeordneter Quarantäne seitens des Gesundheitsamtes sind verschiedene Fälle
und damit auch Vorgehensweisen zu unterscheiden. Deshalb haben wir einige
Modelle, welche das Lernen auf Distanz und die damit verbundenen Voraussetzungen
berücksichtigen, antizipiert:
• Klasse in Quarantäne Distanzunterricht
1 • Klassenlehrerin gesund
• Klasse in Quarantäne Distanzunterricht
2 • Klassenlehrerin erkrankt
• Klasse im Präsenzunterricht
3 • Klassenlehrerin erkrankt
• Teile der Klasse in Quarantäne Präsenz- und Distanzunterricht
4 • Klassenlehrerin gesund
• ? unbekanntes Szenario
5
1.Fall: Klasse in Quarantäne - Lehrerin gesund
Gemeinsamer Start um 9 Uhr via Video-Klassenmeeting über SchoolFox
Selbstständiges Arbeiten in den orangenen Mappen oder am Wochenplan (nach
Absprache mit der Klassenlehrerin)
Lehrerin ist über SchoolFox erreichbar
Individuelle Absprachen mit Familien, für die Videomeetings nicht möglich sind
Gemeinsamer Abschluss um 12 Uhr über SchoolFox – Zeit für Fragen, Feedback
und Wertschätzung der Arbeit der Schülerinnen und Schüler
2. Fall: Klasse in Quarantäne - Lehrerin erkrankt
Vorgehen wie in Fall 1 und Stufen- oder Teamkollegin (s. Vertretungskonzept)
übernimmt die Aufgaben der Klassenlehrerin
Fall: Klasse im Präsenzunterricht - Lehrerin erkrankt
Präsenzunterricht wird durch eine Stufen- oder Teamkollegin übernommen (s. Ver-
tretungskonzept)
3. Fall: Klasse im Präsenzunterricht - Lehrerin erkrankt
Präsenzunterricht wird durch eine Stufen- oder Teamkollegin übernommen (s. Ver-
tretungskonzept)
124. Fall: Teil der Klasse in Quarantäne - Lehrerin gesund
Selbstständiges Arbeiten in den orangenen Mappen oder am Wochenplan (nach
Absprache mit der Klassenlehrerin)
Ab dem 3. Fehltag in der Schule sollen Erziehungsberechtigte das Arbeitsmaterial
in der Schule abholen
4.2 Perspektivische Erweiterung der methodisch-didaktischen Leitlinien
Im Präsenz- und Distanzunterricht wechseln sich Formen des synchronen Lernens in
der Schule mit asynchronen Lernformen ab. Diese werden durch die Lehrkräfte
angeleitet und von den Schülerinnen und Schülern zu Hause selbstständig durch-
geführt. Inhaltlich soll der Präsenzunterricht hauptsächlich die Lernphasen des
Einführens, Erarbeitens und Informierens haben. Auch der direkte Austausch mit den
Schülerinnen und Schülern und deren Austausch untereinander sollte möglich
gemacht werden. Während des Distanzunterrichts sollten die Schülerinnen und
Schüler überwiegend üben, vertiefen und wiederholen. Ist eine Einführung oder
Erarbeitung eines neuen Lerninhaltes im Distanzunterricht dennoch erforderlich, weil
möglicherweise die Zeitspanne dies erforderlich macht, so müssen digitale Tools (z.B.
Erklärvideos) genutzt werden.
Präsenzunterricht Distanzunterricht
einführen üben
erarbeiten vertiefen
austauschen austauschen
informieren wiederholen
Häufig steht in der Organisation des Distanzlernens die Technik im Vordergrund. In
den didaktischen Hinweisen für Lehrerinnen und Lehrer und Seminarausbilderinnen
und Seminarausbilder zum Distanzlernen von Krommer, Wampfler und Klee (MSB,
2020) werden darüber hinausgehende Impulse für methodisch-didaktische Entschei-
13dungen gesetzt: „Beim Distanzlernen stehen nicht Tools und Apps im Mittelpunkt, son-
dern die Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern sowie die Begleitung ihrer Lern-
prozesse. Tools und Apps verändern jedoch die Rahmenbedingungen, unter denen
diese Lernprozesse stattfinden.“
Damit haben digitale Medien die wichtige Funktion, vielfältige Kanäle, die für die Kom-
munikation auf der Beziehungsebene genutzt werden können, zu eröffnen. „Das Ler-
nen mit E-Mails, Chats, Lernplattformen, Videokonferenzen, Tablets und Smartphones
folgt anderen didaktischen Regeln als der traditionelle Präsenzunterricht. Daher sollte
man den »Präsenzunterricht« nicht einfach digital abbilden“ (MSB 2020, S. 2).
In den Phasen des Distanzlernens sollten Schülerinnen und Schüler auf vertraute
Hard- und Software zurückgreifen können, die sie im Unterricht bereits genutzt haben.
Deshalb ist eine hinreichende Ausstattung mit schulischen iPads, welche über ein Aus-
leihsystem den Schülerinnen und Schülern im Lernen auf Distanz zur Verfügung ge-
stellt werden, unumgänglich. Eine Ankündigung ohne konkrete Terminierung des
Rollouts ist von Seiten des Schulamtes für die Stadt Bonn im September 2020 erfolgt.
Eine Evaluation der jeweiligen organisatorischen und methodisch-didaktischen Maß-
nahmen wird unmittelbar nach Durchführung eines erforderlichen Lernens auf Distanz
erfolgen.
4.3 Systematische Unterrichtentwicklung bei der Verknüpfung von
Präsenz- und Distanzunterricht
Ausgelöst durch die Covid-19-Pandemie und die damit verbundene Schließung der
Schulen, lässt sich die Prozessentwicklung des Präsenz- und Distanzunterrichts als
eine Umwandlung einer disruptiven Unterrichtsentwicklung der Lock-down-Phase in
eine evolutionäre Unterrichtsentwicklung beschreiben: Nach spontanen Lösungen in
akuten Herausforderungen folgen geplante und abgestimmte Vorgehensweisen für
unterschiedliche Szenarien (vgl. Kapitel 4.1).
Die Weiterentwicklung des Unterrichts unter diesen Gegebenheiten muss den Aufbau
von Selbststeuerungskompetenz noch stärker in den Fokus nehmen. Das bedeutet:
Im Präsenzlernen müssen Selbststeuerungskompetenzen entwickelt und gefördert
werden, damit die Schülerinnen und Schüler im Distanzlernen auf Selbststeuerungs-
kompetenzen zurückgreifen können. Die Weiterentwicklung und Förderung dieser
Kompetenzen müssen somit in alle Unterrichtsfächer einfließen und bedürfen einer
umfassenden Förderplanung.
Die aufschließenden Hinweise zu dieser langfristigen Weiterentwicklung der Unter-
richtsqualität bietet der neue Referenzrahmen v.a. durch die Erweiterung der
Dimension 2.10 Lernen im digitalen Wandel. Perspektivisch ist diese bereits im
Fortbildungskonzept, Medienkonzept und Schulprogramm unserer Schule hinterlegt.
14Abb. 6: Screenshot aus MSB 6/2020, Referenzrahmen, S. 46
15Abb. 7 Screenshot aus MSB 6/2020, Referenzrahmen, S. 47
164.4 Aspekte der Sprachförderung von Schülerinnen und Schülern mit dem
Förderschwerpunkt Sprache im Distanzunterricht
„Zentrales Anliegen unserer Schule ist die sprachlich-kommunikative Förderung
unserer Schülerinnen und Schüler im Rahmen der fachlichen Wissensvermittlung, also
in Verbindung mit den regulären Kompetenzerwartungen der Fächer der Grundschule.
Die Arbeit auf und an den verschiedenen Sprachebenen ist zentraler Bestandteil
unseres Unterrichts. Unsere Schülerinnen und Schüler benötigen dabei, basierend auf
einer individuellen Förderdiagnostik, einerseits einen Unterricht, der gezielte
Sprachlernprozesse ermöglicht und fördert, und andererseits gezielte, spezifische
individuelle Fördermaßnahmen, auch in Kleingruppen oder Einzelsetting. Wir folgen
damit dem Verständnis von einem sprachheilpädagogischen Unterricht der Münchner
Schule. […] Sprachheilpädagogischer Unterricht ist dabei ein Oberbegriff, der sowohl
allgemeine Maßnahmen der Sprachförderung als auch einen spezifisch
sprachtherapeutischen Unterricht beinhaltet“ (Auszug aus dem Schulprogramm der
Astrid-Lindgren-Schule, 2020, S. 12).
Bezogen auf das Lernen auf Distanz bedeutet dies, dass wir schon bei der Auswahl
der digitalen Medien die relevanten Sprachförderaspekte berücksichtigen müssen.
Abbildung 8 verdeutlicht entsprechende Auswahlkriterien.
Abb. 8 Reber & Wildegger-Lack 2020, S. 30
Durch den Schulträger wird die Hardware (iPad) und damit auch das Betriebssystem
(iOS) vorgegeben. Laut Reber (2020) bietet ein Tablet die im Folgenden aufgelisteten
Vorteile für die Anwendernutzung (Abb. 9).
17Abb. 9 Reber (2020) dgs-Online Kongress (PPP)
Eine Erweiterung der angebotenen Apps durch den Schulträger ist für die
Förderschule mit dem Schwerpunkt Sprache erforderlich, damit auch im
Distanzunterricht Prinzipien des sprachheilpädagogischen Unterrichts berücksichtigt
und damit die sprachliche Förderung der Schülerinnen und Schüler gewährleistet
werden können. Die Empfehlungen von Reber und Kaiser-Mantel (2020) sind hierbei
eine gute Orientierung für die Auswahlentscheidung (s.a. Abb. 10).
Abb. 10 Reber (2020) dgs-Online Kongress (PPP)
Perspektivisch wird es eine Aufgabe der Fachkonferenzen sein, weitere Apps und
andere digitale Angebote (Erklärvideos, Filmbeiträge etc.) für die verschiedenen
Unterrichtsfächer unter den Gesichtspunkten des selbständigen Lernens sowie des
sprachheilpädagogischen Unterrichts zu sichten und geeignete Anwendungen in die
schulinternen Curricula aufzunehmen.
185 Literatur
Astrid-Lindgren Schule (2020). Schulprogramm. Bonn
Bezirksregierung Köln (2020). Handreichungen Schulleitungen, 2020-08-31
(PPT)
Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen,
MSB / Krommer , A., Wampfler, P. & Klee, W. (2020). Impulspapier Lernen
auf Distanz. Online verfügbar unter: www.schulministerium.nrw.de/system/fi-
les/media/document/file/impulspapier_lernen-auf-distanz.pdf
Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen,
MSB (08/2020). Handreichungen zur lernförderlichen Verknüpfung von Prä-
senz- und Distanzunterricht. Online verfügbar unter: www.schulministe-
rium.nrw.de
Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen,
MSB (06/2020). Referenzrahmen Schulqualität NRW, Schule in NRW Nr.
9051.
Reber, K. & Kaiser-Mantel, H. (2020). Apps für Schule und Therapie. Sonder-
pädagogik – Inklusion – Förderschwerpunkt Sprache – Sprachtherapie. Online
verfügbar unter: https://karin-reber.de/2018/10/28/appliste/
Reber, K. & Wildegger-Lack, E. (2020). Sprachförderung mit Medien: Von real
bis digital. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.
Reber, K. (2020). Sprach-und Schriftsprachförderung mit digitalen Medien.
Workshop im Rahmen des dgs-Online-Kongresses am 26.9.2020 (PPP).
196 Anhang
2021
Sie können auch lesen