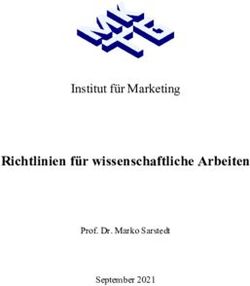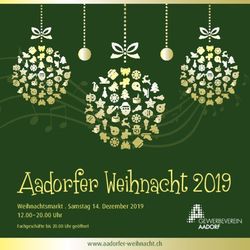Literarisches Schreiben im Deutschunterricht Ein Fortbildungsprogramm für Deutschlehrkräfte aller weiterführenden Schularten in ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Literarisches Schreiben im Deutschunterricht Ein Fortbildungsprogramm für Deutschlehrkräfte aller weiterführenden Schularten in Mecklenburg-Vorpommern Oktober 2018 bis Januar 2020 „Weltenschreiber – Das Literaturvermittlungsprogramm für Kinder und Jugendliche“ ist ein Programm der Robert Bosch Stiftung GmbH. Zentrale Bausteine des Programms sind Schreibwerkstätten mit bekannten Autoren, die im regulären Deutschunterricht an Schulen unterschiedlicher Schulformen stattfinden, und eine 18-monatige Fortbildung für Lehr- kräfte zum Literarischen Schreiben. Neben den Kultusministerien in Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen unterstützen die Stiftung Niedersachsen, die Klosterkammer Hannover und die VGH-Stiftung das Programm. Weitere Partner sind die Otto-Friedrich-Universität Bamberg, die Universität Rostock und die Georg-August-Univer- sität Göttingen, die die Lehrkräftefortbildung fachdidaktisch begleiten, sowie das Deutsche Literaturarchiv Marbach (DLA), an dem die beteiligten Autoren für ihre Zusammenarbeit mit Schülern und Lehrern geschult werden. Eine Kooperation mit dem Goethe-Institut ermög- licht darüber hinaus deutschen Auslandsschulen in zehn weiteren Ländern, am Programm teilzunehmen. Umgesetzt wird das Programm von den Literaturhäusern in Stuttgart und Rostock und vom Literarischen Zentrum Göttingen. www.bosch-stiftung.de/weltenschreiber
Ein Angebot des Literaturhauses Rostock im Rahmen des bundesweiten Programms „Weltenschreiber – Das Literaturvermittlungsprogramm für Kinder und Jugendliche“ der Robert Bosch Stiftung GmbH. Unterstützt durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern und das Institut für Qualitätsentwicklung M-V. In Kooperation mit dem Lehrstuhl für Fachdidaktik Deutsch der Universität Rostock. Redaktion | Dr. Agnieszka Nyenhuis Gestaltung und Satz | Florian Bähler Fotos | Dürig: Björn Hänssler; Hesse: Silke Winkler; Preiwuß, Nußbaumeder, Nyenhuis: Reiner Mnich Herausgeber Literaturhaus Rostock e.V. Literaturhaus Rostock Doberaner Straße 21 18057 Rostock Telefon | 0381. 492 55 81 Web | www.literaturhaus-rostock.de
Inhalt
1 Grußwort des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft
und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern
2 Grußwort der Robert Bosch Stiftung
3 Vorwort des Literaturhauses Rostock
4 Fortbildungsprogramm: Aufbau, Konzept und Ziele
6 Elemente der Fortbildung
7 Terminübersicht
8 Fortbildungsmodul
8 A Prosa und Lyrik
12 B Szenisches Schreiben
16 Didaktische Begleitung
17 Anmeldung
17 Anfahrt
18 Hinweise auf relevante Publikationen
19 KontaktGrußwort
Birgit Hesse
Ministerin für Bildung,
Wissenschaft und Kultur des Landes
Mecklenburg-Vorpommern
Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
Gedichte, Fabeln, Novellen – sich für das Fach Deutsch
zu entscheiden, hängt meist auch an der eigenen
Begeisterung für Literatur. Diese Freude am geschriebenen Wort im Unterricht weiterzugeben,
funktioniert umso besser, je mehr Sie selber einen Zugang haben: zum Schreiben, zum Redigieren,
zum Bewerten von Texten.
Mit der Fortbildung „Literarisches Schreiben im Deutschunterricht“ als Teil des Projektes
„Weltenschreiber – Das Literaturvermittlungsprogramm für Kinder und Jugendliche“ haben Sie die
Chance, unter hochkarätiger Anleitung das Schreiben und Lesen literarischer Texte neu zu erfah-
ren – und das zuerst ohne den Fokus auf Ihren Unterricht. In einem zweiten Schritt übertragen Sie
dann das Gelernte auf das Lehren, sprich: auf die Gestaltung und Bereicherung Ihres Unterrichts.
Die Fortbildung zeigt nicht zuletzt, welche Spielräume Ihnen offen stehen, um Literatur, kreatives
Schreiben und Ihre eigenen Erfahrungen auf diesem Feld gewinnbringend in den (Deutsch-)
Unterrichtsalltag einzubringen. Das Literaturhaus Rostock, die Universität Rostock und das
IQ M-V ziehen dafür an einem Strang.
Zücken Sie also die Feder: Anmelden lohnt sich.
Birgit Hesse
1Grußwort
Uta-Micaela Dürig
Geschäftsführerin der Robert Bosch Stiftung
Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
das Literarische Schreiben fördert nicht nur die Sprach- und
Ausdrucksfähigkeit junger Menschen. Es kann Kinder und
Jugendliche dazu befähigen, sich selbst, aber auch vermeintlich
fremde Denk- und Sichtweisen mit anderen Augen zu betrach-
ten und darüber in den Dialog zu treten. Es kann ihnen den Zugang zu neuen Handlungs- und Gestal-
tungsperspektiven eröffnen und ihnen damit auch die Möglichkeit geben, aktiv an unserer Gesellschaft
teilzunehmen und diese bewusst mitzugestalten.
Dieses Potential möchten wir mit unserer Arbeit bei der Robert Bosch Stiftung nutzbar machen. Als eine
der großen unternehmensverbundenen Stiftungen in Europa folgen wir seit über 50 Jahren dem Ver-
mächtnis von Robert Bosch und setzen sein soziales und gesellschaftliches Engagement in zeitgemäßer
Form fort. Gerade heute – in Zeiten großer gesellschaftlicher Veränderung – ist es uns wichtig, Zusam-
menhalt, Offenheit und Vielfalt zu stärken und allen Menschen die gleichberechtigte Teilhabe an unserer
Gesellschaft zu ermöglichen.
Mit dem Programm „Weltenschreiber – Das Literaturvermittlungsprogramm für Kinder und Jugendliche“
wollen wir junge Menschen für das Literarische Schreiben begeistern und die künstlerische Praxis lang-
fristig an Kulturinstitutionen und Bildungseinrichtungen verankern. Ein zentrales Modul des Programms
ist die Lehrkräftefortbildung „Literarisches Schreiben im Deutschunterricht“. Bewährtes Vorbild hierfür ist
das Angebot des von uns geförderten Literaturpädagogischen Zentrums Stuttgart (LpZ), das seit 2017 vom
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg finanziell unterstützt wird. In Mecklen-
burg-Vorpommern – neben Baden-Württemberg und Niedersachsen einer der drei Standorte, an denen
das Programm „Weltenschreiber“ in der nun anlaufenden Pilotphase durchgeführt wird – arbeiten wir eng
mit dem Literaturhaus Rostock zusammen, dessen langjährige Arbeit und großes Engagement im Bereich
der Literaturvermittlung für Kinder und Jugendliche wir sehr schätzen.
Besonderer Dank gilt an dieser Stelle außerdem dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
des Landes Mecklenburg-Vorpommern und dem Institut für Qualitätsentwicklung für die hervorragende
Zusammenarbeit sowie dem Lehrstuhl für Fachdidaktik Deutsch am Institut für Germanistik der Univer-
sität Rostock für die wissenschaftliche Begleitung der Fortbildung.
Gemeinsam wünschen wir Ihnen eine lehrreiche Fortbildung.
Wir sind gespannt auf Ihre Erlebnisse und Erfahrungen und hoffen,
dass auch Sie Ihr kreatives Potential (neu) entdecken.
Uta-Micaela Dürig
2Vorwort
Dr. Agnieszka Nyenhuis
Projektkoordination
„Weltenschreiber“ in M - V
Das Literaturhaus Rostock engagiert sich seit über zehn
Jahren als Koordinationsstelle für eine landesweite Lese-
und Sprachkompetenzförderung für Kinder und Jugend-
liche in Mecklenburg-Vorpommern. In unserem jährli-
chen Kinder- und Jugendliteraturprogramm gehen AutorInnen, IllustratorInnen, ÜbersetzerInnen,
Liedermacher und ReferentInnen auf Lese- und Vortragsreisen. Mit einem stetig wachsenden
Netzwerk aus über 80 Bildungs- und Jugendeinrichtungen realisieren wir jährlich ca. 420 Literatur-
veranstaltungen in Mecklenburg-Vorpommern. Auch Schreibwerkstätten für Kinder und Jugend-
liche sind seit langem ein fester Bestandteil unseres Programms. Um die Nachhaltigkeit unserer
Angebote zu sichern, haben wir – basierend auf dem Stuttgarter Konzept „Unterricht im Dialog“
– eine Fortbildung für die Deutschlehrkräfte entwickelt. Die DeutschlehrerInnen sind diejenigen,
die jeden Tag aufs Neue die Literatur mit Kindern und Jugendlichen erschließen und sie an das
Literarische Schreiben heranführen. Mit unserer Fortbildung möchten wir den Deutschlehrkräf-
ten wieder Raum für eigenes Schreiben und das Erleben von Literatur verschaffen. Wir möchten
sie in ihrer Kompetenz, literarische Texte zu verfassen, stärken und sie in ihrer Persönlichkeits-
entwicklung, angeregt durch den Schreibprozess, begleiten. Die Kooperation mit dem Institut für
Qualitätsentwicklung M-V und dem Lehrstuhl für Fachdidaktik Deutsch der Universität Rostock
gewährleistet dabei ein hohes fachliches Niveau.
Die Fortbildung ist ein zentraler Baustein des Projektes „Weltenschreiber – Das Literaturvermitt-
lungsprogramm für Kinder und Jugendliche“, das von der Robert Bosch Stiftung GmbH entwickelt
und gefördert wird.
In der vorliegenden Broschüre möchten wir Ihnen unser Fortbildungsprogramm vorstellen,
das die DozentInnen Kerstin Preiwuß und Christoph Nußbaumeder in Zusammenarbeit mit
der Fachdidaktik Deutsch der Universität Rostock entwickelt haben.
Wir freuen uns, mit Ihnen gemeinsam neue Seiten aufzuschlagen.
Agnieszka Nyenhuis
3Fortbildungsprogramm
Aufbau, Konzept und Ziele
Die Fortbildung „Literarisches Schreiben im Deutschunterricht“ ist ein zentraler Baustein von
„Weltenschreiber – Das Literaturvermittlungsprogramm für Kinder und Jugendliche“
der Robert Bosch Stiftung GmbH. Das Literaturhaus Rostock entwickelt und führt diese ein-
einhalbjährige Fortbildung in Kooperation mit dem Lehrstuhl für Fachdidaktik der Universität
Rostock und dem Institut für Qualitätsentwicklung M-V für Lehrkräfte im Fach Deutsch aller
Schularten in M-V durch.
Die Fortbildung ist thematisch in zwei Schwerpunkte
gegliedert, die parallel angeboten und einzeln belegt
werden können:
A Erzählendes und Lyrisches Schreiben mit der Prosaautorin
und der Lyrikerin Kerstin Preiwuß
B Szenisches Schreiben mit dem Autor und
Dramatiker Christoph Nußbaumeder
Ein Jahr lang schreiben die DeutschlehrerInnen unter der Begleitung von Kerstin Preiwuß oder
Christoph Nußbaumeder literarische Texte. Dabei lernen sie Techniken und Verfahren kennen, um
Texte zu gestalten, zu überarbeiten und sich über Kriterien und Aspekte der Bewertung zu verstän-
digen. Möglichkeiten des kritischen Dialogs über eigene und fremde Texte sollen hier erprobt und
erfahren werden. Der schulische Kontext spielt zunächst eine untergeordnete Rolle. Im Mittelpunkt
der ersten Phase stehen die TeilnehmerInnen und ihre persönliche Erfahrung in der Textprodukti-
on und Textgestaltung.
Nach dieser Phase, die sich über ein Jahr erstreckt, rücken der didaktische Aspekt und damit der
Transfer des Gelernten auf den eigenen Unterricht in den Fokus der Fortbildung. In enger Zusam-
menarbeit mit dem Lehrstuhl für Fachdidaktik Deutsch der Universität Rostock werden Unter-
richtskonzepte entwickelt, um die Erfahrungen des eigenen Schreibens in die Unterrichtsgestaltung
einzubringen, das Literarische Schreiben als Unterrichtsbestandteil zu integrieren und dabei an
Vorgaben des Rahmenplans sinnvoll anzuschließen.
4Zielsetzung
„Schüler merken es sehr schnell, wenn ein Lehrer nur
oberflächliches Wissen hat. Wenn Antworten auf Fragen
nur sehr zögerlich kommen, wenn sie im Vagen enden oder
wenn klar wird, dass dieses Wissen nicht einer Erfahrung
entspringt, sondern angelesen ist.“
(Abschlussbericht zur Evaluation des Fortbildungsprogramms „Literarisches Schreiben im
Deutschunterricht“. Wissenschaftliche Begleitung und Evaluation: Prof. Dr. Ulf Abraham,
Dr. Ina Brendel-Perpina, M. A. Christian Thierau)
Unter dem Begriff Kompetenz verstehen wir mehr als reine Sachkenntnis. Kompetenz zeigt sich im
Tiefenverständnis für einen Prozess und seine Anforderungen. Unser Fortbildungskonzept ist dar-
auf angelegt, eine Kompetenz der Textproduktion, Textgestaltung und Textbewertung zu erzeugen,
die nicht an der Oberfläche bleibt, sondern in der Lage ist, sich den Fragen der Schüler zu stellen,
ihnen im Problemfall wirklich weiterhelfen zu können und ihnen vielleicht sogar in einer Art ge-
genüberzutreten. Dies setzt das (Durch- und Er-)Leben des gesamten Schreibprozesses voraus, von
seiner Initiierung, Motivationserweckung und ihrer Aufrechterhaltung bis zur Verständigung über
die Urteilskriterien.
Ein anderer wichtiger Aspekt unserer Lehrkräftefortbildung zielt darauf, die Freude der Lehrkräfte
an der Literatur und am Schreiben in Erinnerung zu rufen und das innere Feuer für das Schreiben
(wieder) zu erwecken. Deshalb bieten wir den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein vielseitiges,
sowohl zeitlich als auch inhaltlich großzügig angelegtes Fortbildungskonzept, entwickelt von einer
renommierten Schriftstellerin und Lyrikerin und von einem der deutschlandweit am häufigsten
gespielten Dramatiker, deren Lebensinhalt das Schreiben ist.
5Elemente der Fortbildung
Schreibtage | „eintauchen“
Mit ihrer Anmeldung entscheiden sich die TeilnehmerInnen für eine Werkstattform.
Die Teilnehmerzahl je Schreibwerkstatt ist auf 15 Personen beschränkt. An insgesamt
zehn ganztägig angelegten Fortbildungseinheiten im Schuljahr 2018/19 wird zunächst
das Literarische Schreiben erprobt.
Es werden Schreibmotivationen ergründet und Schreibimpulse gegeben – der Mut zum
Ausprobieren steht im Vordergrund. Die eigenen Erfahrungen mit Verfahren und Tech-
niken des Schreibens, die mithilfe der/des jeweiligen Werkstattleiterin/-leiters (Kerstin
Preiwuß oder Christoph Nußbaumeder) erlernt werden, bilden die Grundlage für
die Reflexion des eigenen Schreibens und gegenseitigen Austausch.
Transfertage | „umsetzen”
Die Transfertage unterstützen die TeilnehmerInnen darin, ihre eigenen Erfahrungen
mit dem Literarischen Schreiben für die eigene Praxis in der Schule fruchtbar zu
machen. Unterrichtspraktische Konzepte und Verfahren werden gemeinsam mit
Prof. Dr. Tilman von Brand und M. A. Susanne Tanejew vom Lehrstuhl für Fachdidaktik
Deutsch, mit Kerstin Preiwuß und Christoph Nußbaumeder reflektiert, auf ihre Einsetz-
barkeit innerhalb der eigenen Unterrichtsprozesse überprüft und weiterentwickelt.
Ziel ist es, Schreibinspirationen und Strategien, die in der eigenen Werkstattarbeit als
selbstwirksam erfahren wurden, schulalltagstauglich zu machen: Denn während die
eigenen Erfahrungen und Erkenntnisse in der Werkstattarbeit im von allen Zwängen
befreiten Rahmen einer geschützten Kleingruppe von sprach- und literaturbegeisterten
LehrerInnen stattfindet, vollzieht sich unterrichtliches Lehren und Lernen klassenöffent-
lich in großen und heterogenen Gruppen in einem begrenzten räumlichen und zeitli-
chen Rahmen und unter den Vorgaben von Curricula und Leistungsbewertung.
6Terminübersicht
Schreibtage
26. / 27. Oktober 2018
30. November / 01. Dezember 2018
11. / 12 Januar 2019
15. / 16. März 2019
17. / 18. Mai 2019
21. Juni 2019 – Präsentation der Ergebnisse
Transfertage
30. / 31. August 2019
25. / 26. Oktober 2019
17. / 18. Januar 2020
Freitag von 10:00 bis 18:00 Uhr
Samstag von 9:30 bis 17:30 Uhr
7Fortbildungsmodule
A Prosa und Lyrik
Didaktische Begleitung
B Szenisches Schreiben
A Prosa und Lyrik
Erzählendes und Lyrisches
Schreiben im Deutschunterricht
Kerstin Preiwuß, 1980 in Lübz geboren, aufgewachsen in
Plau am See und Rostock, lebt als freie Autorin mit ihrer
Familie in Leipzig. Sie studierte Germanistik, Philoso-
phie und Psychologie in Leipzig und Aix-en-Provence,
promovierte über deutsch-polnische Städtenamen und
ist Absolventin des Deutschen Literaturinstituts Leipzig.
2006 debütierte sie mit dem Gedichtband „Nachricht
von neuen Sternen“. 2008 erhielt sie das Hermann-Lenz-
Stipendium. Von 2010 – 2012 war sie Mitherausgeberin
der Literaturzeitschrift Edit. 2012 erschien ihr zweiter
Gedichtband „Rede“, der von der Deutschen Akademie
für Sprache und Dichtung in die Liste der Lyrikempfeh-
lungen des Jahres aufgenommen wurde. Zuletzt erhielt sie den renommierten Lyrikpreis Meran [2018].
2014 erschien ihr Roman „Restwärme“ im Berlin Verlag, 2016 folgte dort der Gedichtband „Gespür für
Licht“. 2017 erscheint der Roman „Nach Onkalo“ und war im selben Jahr für den Deutschen Buchpreis
nominiert. Kerstin Preiwuß ist Mitglied des P.E.N.
8Erzählendes und Lyrisches Schreiben im Deutschunterricht
Wer schreibt, sieht die Welt anders. Wer schreibt, löst keine Aufgaben, sondern stellt sich die Auf-
gabe selbst. Wer schreibt, stellt Fragen an das, was schon geschrieben ist. Wer schreibt, liest. Wer
lernt, Worte nach eigenem Ermessen zu setzen, wird die Worte, die ihm begegnen, anders deuten,
selbstbewusster; er wird sie befragen und in seine Welt übersetzen. Wer seine eigenen Worte setzt,
kann nicht mehr gleichgültig sein gegenüber den Worten Anderer, er muss sie lesen, er will, weil
er weiß, dass sie ihm etwas zu sagen haben. Alle Aufgaben, die das Schreiben einem stellt, löst
man freiwillig. Das ist, kurz gesagt, was das Schreiben bewirken kann. Wie aber geht das, wie geht
Schreiben? Und wie setzt man diesen Prozess bei sich und seinen Schülern in Gang und hält ihn
aufrecht, damit daraus eine Fähigkeit entsteht?
Mittels einer Fülle von Schreibansätzen, von denen keiner richtig ist, aber alle zusammen vielfältig.
Als Reservoir an Praxen, die auch die Künstler nutzen, als Spieltrieb, der nebenbei den Umgang mit
Regeln übt. Dichten als Wahrnehmung und Experiment, als Ausdruck des Verhältnisses von Selbst
und Welt. Erzählen als Finden und Erfinden von Geschichten und den dafür notwendigen Perspek-
tiven. Sprache als stete Übersetzung von Gedanken in Form.
Die zweijährige Fortbildung setzt sich zusammen aus Werkstatt- und Seminareinheiten. In den
Schreibwerkstätten wird das eigene Schreiben als Erfahrungswert wie auch das anschließende
Gespräch über die Texte und ihre literarische Weiterentwicklung im Mittelpunkt stehen. Schreiben
kann (und muss) man üben, die Übungen reflektieren. Die Seminareinheiten dienen zur Vertiefung
entstehender Fragen, die praktischer wie theoretischer Natur sein können. Anhand von Beispielen
aus kanonischer wie gegenwärtiger Literatur helfen sie, Begriffe zu klären wie etwa Autor, Erinne-
rung, Experiment, Gattungen, Handwerk, Kritik, Literatur, Material, Motiv, Mündlichkeit, Norm,
Poetik, Prozess, Sprache, Stil, Stoff, Text, Ton, Tradition, Wertung etc. Im zweiten Jahr soll es um
die konkrete Anwendung im Deutschunterricht gehen, um die Fragen und Probleme, die durch
den Perspektivwechsel entstehen, wenn man nicht mehr nur der ist, der schreibt, sondern das
Schreiben lenkt.
9Schreibwerkstätten Überblick
Phasen
Schreiben beginnt weit vor dem ersten Wort und es dauert lang. Es ist ein steter Prozess mit unge-
wissem Ausgang, dessen Ergebnis immer nur vorläufig ist. Oft wird er unterbrochen, beschleunigen
kann man ihn nicht. Aber man kann versuchen ihn zu verstehen, es gibt Phasen, durch die man
geht. Um einen Text zu schreiben, braucht es eine Idee. Aber wie findet man zu „seiner“ Idee, was
macht man sich zu eigen und woher kommt das Material dafür? Auf welche Probleme trifft man
während des Schreibakts und wie löst man sie? Was braucht es an Formulierungsschritten, damit
aus der Idee ein Text entsteht, der nicht nur persönlich ist, sondern etwas zu sagen hat? Zeigt man
diesen Textentwurf dann, und wenn ja, wem, und wie geht man mit der Bewertung um? Wie fühlt
sich die Erfahrung an, dass ein Text, den man für fertig hielt, immer noch ein Manuskript darstellt?
Findet man über das Textgespräch zu einem Abstand, dass man ihn überarbeiten kann? Und wenn
der Text seine endgültige Gestalt gefunden hat, wie und wem präsentiert man ihn dann? Es kann
auch passieren, dass man stecken bleibt und abbricht, weil der Prozess nicht gelingt, weil der Text
verhindert bleibt. Dann hilft nur Zeit und ein Neuansatz und schon ist man wieder ganz am An-
fang der unsichtbaren Arbeit, die lange vor dem ersten Wort beginnt und immer freiwillig ist. Das
ist in etwa der Kreislauf, in den man eintritt. Die Reihenfolge ist nicht zwingend, Phasen können
sich vertauschen oder wiederholen. Nur der Orientierung wegen seien sie als Tätigkeitsformen
benannt:
WAHRNEHMEN Sowohl Welt als auch Sprache stellen Quellen für das Schreiben dar.
Versucht man Welt und Wörter wahrzunehmen wie zum ersten Mal, erfährt man, wie viel man
mit ihnen anstellen kann.
WISSEN Hat man eine Idee, kann das Schreiben beginnen. Aber woher kommen die Ideen?
Über was für Stoffe und Motive verfügt man? Woher holt man sich das für die Geschichten und
Gedichte notwendige Wissen und wie recherchiert man?
LESEN Lesen ist Teil des Schreibens. Oft möchte man schreiben, was man gern gelesen hat.
Sich den eigenen Kanon bewusst zu machen, seine Vorbilder zu kennen, hilft bei der Suche nach
dem eigenen Ton. Es gibt aber auch die Texte, die aus Texten erst entstehen, die überschrieben
werden. Hier ist Lesen bereits Teil des Schreibspiels.
EMPFINDEN Wie kommen Gefühle in den Text und sind sie immer an ein Ich gebunden?
Wie ist das Verhältnis von Erlebnis, Empfindung und sprachlicher Wiedergabe? Und wie trifft man
den Ton, der Gefühle nicht nur formelhaft in Phrasen presst?
10ERFINDEN Man kann alles erfinden, auch den Autor. ICH kann genauso gut ein Anderer
sein, wie es kein Anderer ist. Wie autobiographisch ist dann autobiographisches Schreiben über-
haupt? Und welche Möglichkeiten gibt es für das Biographische? Sicher ist nur: ICH ist im Text
immer anders als man selbst.
ERINNERN Erinnerung gilt als verlässliche Quelle für das Schreiben. Wer sich erinnert,
verfügt über Zeit. Aber das Schreiben greift auch in die Erinnerung ein und verändert sie zu Guns-
ten des Textes. Zeitformen spielen eine wesentliche Rolle dabei. Die erzählte Zeit kann rückwärts
gewandt in die Vergangenheit reichen oder sich auf die Zukunft erstrecken. Die Übergänge sind
fließend.
ÜBERSETZEN Bereits das zur Sprache Kommen der Gedanken ist eine Übersetzung. Bilder
werden beschrieben, Sprache bemüht sich um Bilder, Metaphern entstehen. Es gibt viele Sprachen
in einer, und die eigene Sprache ist nur eine von vielen. Bedeutungen wandern zwischen den Spra-
chen hin und her und werden beschrieben.
ÜBERARBEITEN Ein Text bleibt lange Manuskript. Für einen selbst wird er irgendwann
zum blinden Fleck. Letztendlich muss man auf Distanz zu ihm gehen, um ihn überarbeiten zu
können. Hierfür braucht es den Blick von außen im geschützten Raum. Den leistet das Lektorat.
PRÄSENTIEREN Irgendwann kommt der Moment, an dem man entscheiden muss, ob
man für die Schublade schreibt oder ob man das Geschriebene zeigt. Damit geht einher, dass man
seinen Text der Öffentlichkeit aussetzt. Für wie viel Wettbewerb ist man bereit und wie geht man
mit den Reaktionen um, die es geben wird?
Formen
Schreiben ist nicht nur Prozess, sondern auch Spiel, und wie für jedes Spiel stehen auch hier Regeln
zur Verfügung, nach denen geschrieben wird. Die Spiele können alt oder neu sein, ihre Regeln
erleichtern das Ausprobieren und erhellen das Handwerk von Schriftstellern in Vergangenheit
wie Gegenwart. Barocke Verfahrensweisen wie Akrostichon oder Anagramm laden genauso zum
Selbstversuch ein wie Erasure oder Mimikry. Wörterbücher sind ein gefundenes Fressen für jeden
Dichter und phantastische Literatur erfindet sich gern ihre eigene Enzyklopädie. Man kann einen
Text auch ohne Sprache schreiben, sich in ihm bewegen oder sich ihn mündlich erzählen. Manch-
mal hilft die Suchmaschine, um etwas zusammenzuschreiben, manchmal reichen die Grammatik
und die Bedeutung der Wörter. Vielleicht wird es einen Text einmal als App geben oder als
Computerspiel. Experimente sind dazu da, gemacht zu werden, die Herausforderung besteht darin,
sich die jeweilige Versuchsanordnung auszudenken.
11B Szenisches Schreiben
Szenisches Schreiben
im Deutschunterricht
Christoph Nußbaumeder, 1978 im niederbayeri-
schen Eggenfelden geboren, arbeitete nach Abitur
und Zivildienst zunächst in der Fabrik eines Auto-
mobilherstellers in Pretoria/Südafrika. Er studierte
Rechtswissenschaften, Germanistik und Geschichte in
Berlin. Seit 2004 arbeitet er als freiberuflicher Autor.
Seine Theaterstücke wurden bei den Ruhrfestspielen-
Recklinghausen, in den Berliner Sophiensaelen und an
vielen weiteren Orten uraufgeführt. (U.a.: „Mit dem
Gurkenflieger“ UA: 3. Juni 2005, Ruhrfestspiele Recklinghausen / Landestheater Linz, Regie: Bernarda
Horres; „Mutter Kramers Fahrt zur Gnade“ UA: 15. Mai 2013, Ruhrfestspiele Recklinghausen / Schau-
spielhaus Bochum, Regie: Heike M. Goetze; „Von Affen und Engeln“ UA: 13. Mai 2015, Ruhrfestspiele
Recklinghausen / Sophiensaele Berlin, Regie: Bernarda Horres; „Meine gottverlassene Aufdringlichkeit“
(Monolog) UA: 18. September 2012, Sophiensaele Berlin, Regie: Bernarda Horres; „Ich werde nicht
sterben / In meinem Bett“ (Kurzmonolog), UA: 16. Mai 2007, Schauspielhaus Bochum, Regie: Burghart
Klaußner; „Eisenstein“ UA: 26. September 2010, Schauspielhaus Bochum, Regie: Anselm Weber; „Das
Fleischwerk“ UA: 12. September 2015, Schauspielhaus Bochum, Regie: Robert Schuster; „Mörder-
Variationen“ UA: 10. Mai 2008, Schauspiel Köln, Regie: Florian Fiedler; „Die Kunst des Fallens“ UA:
3. Juni 2010, Schauspiel Köln, Regie: Katja Lauken; „Im Schatten kalter Sterne“ UA: 6. Oktober 2018,
Theater und Orchester Heidelberg, Regie: Bernhard Mikeska und an vielen weiteren Orten urauf-
geführt.) Zahlreiche Nachspiele erfuhr insbesondere sein Stück „Eisenstein“, das 2010 uraufgeführt
wurde.
Einige Preise und Auszeichnungen: International Residency for Emerging Playwrights des Royal Court
Theatre London (2005), Nominierung für den Nestroy-Theaterpreis (2005), Hausautor am National-
theater Mannheim (2007/8), Autorenpreis des KunstSalon Köln (2010), IBK-Förderpreis (2016)
Szenisches Schreiben Überblick
Ich zähle mich nicht zu denen, die viel theoretisieren, wenn es um das Schreiben von Theaterstü-
cken geht. Neben der Phantasie, einem sprachlichen Gespür und dem aufzubringenden Mut, die
vonnöten sind, um einen dramatischen Text zu schreiben, braucht es vor allem einen geerdeten
12Instinkt für dramatische Situationen sowie die Fähigkeit, sich in vielerlei Menschen hineinzuversetzen.
Darüber hinaus muss man einen unabdingbaren Drang verspüren, auf diese spezifische Art und Weise
erzählen zu wollen.
Insofern glaube ich nicht daran, dass szenisches Schreiben im eigentlichen Sinne „gelehrt“ werden kann;
dennoch ist es möglich, einige handwerkliche Kniffe zu erlernen und den Blick auf zeitlose Regeln zu
lenken. Zudem sollten die SchülerInnen ermutigt werden, auf ihre eigene Gedanken- und Erfahrungswelt
zu vertrauen, und selbige beständig in die Handlung einzubringen.
Der Versuch, ein Stück zu schreiben
Dramatik ist auch ein Erkenntnisinstrument, ein Weg, Fragen an sich und die Welt zu stellen. Mei-
ne Aufgabe wird es nun sein, anhand von Gesprächen und praktischen Übungen zu helfen, diese
Fragen präzise zu stellen und das richtige Maß an Einfallsreichtum und Struktur zu koordinieren.
Hierfür wird uns die aristotelische Erzählweise die Grundlagen liefern – Aristoteles‘ „Poetik“ ist so-
zusagen die Urmutter des Storytelling, dessen Auswüchse fest in unserer Gegenwart verankert sind.
Insofern werden wir versuchen, eine Geschichte zu kreieren, die über einen Anfang, einen Mittelteil
und ein Ende verfügt, wobei postdramatische Elemente selbstverständlich mit einfließen dürfen.
Aus dem Grund werden wir hauptsächlich die Handlung und ihren Aufbau untersuchen. Und um
das ganze Unterfangen innerhalb des zeitlich abgesteckten Rahmens einzuhegen, möchte ich folgen-
dermaßen vorgehen:
1. Suchen Sie sich einen relevanten Grundkonflikt,
der durch aneinandergeratende Menschen darstellbar ist.
2. Wählen Sie ProtagonistInnen, die Sie mögen
(was nicht deckungsgleich mit „sympathisch“ sein muss).
Jedenfalls muss sie oder er Empathie auslösen.
3. Behandeln Sie ein Thema, mit dem Sie
grundsätzlich vertraut sind.
13Begleitend zu dem Vorhaben, dass alle TeilnehmerInnen ein Stück
schreiben sollen, werden an den Seminartagen Schwerpunkte
dramatischen Schreibens in den Fokus gerückt:
KörpeR Um zu begreifen, dass es im Wesentlichen Körperhaltungen sind, mit denen Menschen
aufeinander reagieren, werden wir mit Körper- und Bewegungsübungen einsteigen.
MenschenbilD „Das Kriterium für den Faschisierungsgrad einer Gesellschaft ist:
Je gelassener sich die Menschen in ihr vor Augen halten, dass es in ihnen auch etwas Gemeines,
Tierisches und Schablonenhaftes gibt, desto weniger faschistisch ist sie.“
Anhand dieses Zitats von Philippe Sollers werde ich zu erklären versuchen, weshalb es neben allen
Schreibtechniken erst einmal wichtig ist zu begreifen, dass ein Theaterstück nur gelingen kann, wenn man
seine Figuren nicht nur auf Funktionsträgerschaft reduziert, sondern sie als Menschen mit nachvollziehba-
ren Motiven erkennt. Der Autor darf sich nicht „über“ seine Figuren stellen.
AntinomiE Der Grundkonflikt ist die eigentliche Substanz des Dramas. Dieser muss so aufge-
laden sein, dass sich das Recht nicht eindeutig auf eine Seite zu schlagen vermag. Beide Konfliktparteien
haben in moralischer Hinsicht einen berechtigten Anspruch auf die Erfüllung ihres Willens.
Wir werden nach Normen suchen, die im Konflikt nahezu gleichberechtigt aufeinanderstoßen. Es geht
darum, persönliche wie gesellschaftliche Widersprüche anzunehmen und auszuhalten. Antigone zum
Beispiel, jene Theaterfigur von Sophokles, die ihren toten Bruder gegen den Willen ihres Onkels Kreon
begraben will: Man muss sich klarmachen, dass beide moralisch auf Augenhöhe sind. Eine Lesart, dass nur
Antigone im Recht ist, weil sie eine junge wütende Frau ist, wäre unzureichend, dann würde es das Drama
gar nicht geben.
DialoG Hauptsächlich besteht ein Drama aus Dialogen. Aus zueinander gesprochenen Worten kon-
stituiert sich die Handlung. Im Dialog wird der Konflikt ausgefochten. Wir werden sehen, wie man einen
Dialog führt. Für den Autor muss klar sein, welche Figur welche Motive hat und welche Taktik sie verfolgt,
um an ihr Ziel zu kommen.
Exposition Wir werden uns vergegenwärtigen, wie man eine Exposition (Einführung in die
Ausgangssituation) baut. Der „Held“ beziehungsweise die „Heldin“ wird zunächst in ihrer normalen
Welt gezeigt. Was aber ist wichtig zu zeigen, wie kann man eine Hauptfigur mit einfachen Bemerkungen
charakterisieren? Wie könnten Initialmomente aussehen, weshalb der Held/die Heldin eine „Reise“, die
sogenannte „Heldenreise“ antritt?
14RecherchE Es ist wichtig, dass der Autor von einer Welt zu berichten weiß, die er kennt, ansons-
ten läuft man Gefahr, Klischees auszubrüten. Wir werden daher in die Stadt gehen, um Menschen kennen-
zulernen. Dramatisches Schreiben heißt auch: absehen von sich selbst.
Peripetie Wir werden uns Wendungen beziehungsweise zentrale Umschlagsmomente in bekann-
ten Filmen und Dramen anschauen, um eine Sensibilisierung für solche Kippmomente zu erlangen. Die
Handlung wird dadurch in eine völlig andere Richtung getrieben.
Exkurs TraumdramaturgiE Wir untersuchen eigene Träume sowie literarische
Traumsequenzen berühmter Autoren. Träume bieten die Möglichkeit, poetische Sprachbilder zu entwer-
fen. Unterdrückte Eigenschaften führen im Menschen ein Eigenleben und finden Ausdruck in Träumen
und Phantasien. Im Drama können sie wichtig sein, um eine Figur elegant zu charakterisieren.
Das EndE Der wahrscheinlich wichtigste Teil an einem Drama ist der Schluss. Er erzeugt die
Stimmung, in die der Zuschauer entlassen wird. Mit dem letzten Eindruck des Stücks sinniert er über das
ganze Stück. Ein missratener Schluss wird deshalb die geglückten Stellen (selbst wenn sie deutlich über-
wiegen) überlagern und in Mitleidenschaft ziehen. Wie also baut man ein gutes – und dem Stück entspre-
chendes – Ende, worauf sollte man vor allem Acht geben?
Präsentieren Irgendwann kommt der Moment, in dem wir Szenen vorstellen, in einer
sogenannten szenischen Lesung. Damit geht einher, dass man seine selbstverfassten Texte der Öffentlich-
keit aussetzt. Dafür werden wir proben. Beim lauten Lesen (mit verteilten Rollen) wird man noch mal
gesondert feststellen, wie und ob der Text „funktioniert“. Stimmmodulationen, Pausen und kleine Gesten
werden den Worten beigefügt. Für alle AutorInnen wird das sehr aufregend werden. Ferner werden wir
versuchen, die Reihenfolge der Texte so anzuordnen, dass wir für den Abend eine organische Dramaturgie
entwerfen.
15Didaktische Begleitung
Prof. Dr. Tilman von Brand war Gymnasiallehrer
für die Fächer Deutsch und Sozialkunde und lehrt
seit 2012 als Professor für Didaktik der deutschen
Sprache und Literatur an der Universität Rostock.
Zu seinen Arbeitsschwerpunkten gehören Litera-
turdidaktik, Individualisierung – Differenzierung
– Inklusion, historisch-politisches Lernen sowie Me-
thodik des Deutschunterrichts. Er ist Mitherausgeber
der Zeitschrift „Praxis Deutsch“ und u. a. Autor der
Bücher „Deutsch unterrichten“ und „Stundenpla-
nung Deutsch“. Zusammen mit Susanne Tanejew
verantwortet er den fachdidaktischen Teil des
Fortbildungsprogramms.
Susanne Tanejew, 1981 in Berlin geboren, ist wis-
senschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für die
Didaktik der deutschen Sprache und Literatur der
Universität Rostock und Lehrerin am Alexander-
von-Humboldt-Gymnasium in Greifswald.
Ihre Schwerpunkte in Lehre und Forschung sind das
literarische Lernen in heterogenen Lerngruppen,
Leseförderung, Medien und Orte des
Literaturunterrichts.
Die Deutschdidaktik übernimmt im Rahmen des Fortbildungsprojekts vor allem die Vermitt-
lungsperspektive und unterstützt die Lehrkräfte dabei, Konzepte für den Unterricht zu entwi-
ckeln, um Schülerinnen und Schülern das Literarische Schreiben näherzubringen. Dabei werden
pragmatische Dimensionen wie die curriculare Anbindung, die Problematik der Leistungsbewer-
tung oder die konkrete Unterrichtsplanung ebenso in Angriff genommen wie ästhetische
Fragestellungen oder solche zur Anbindung des Konzeptes an herkömmliche Zielsetzungen
literarischen Lernens. Gemeinsam soll ausgelotet werden, welche Funktionen das Literarische
Schreiben für die Erschließung von Literatur und für die Entwicklung von Schreibfertigkeiten
und -fähigkeiten erfüllen kann.
16Weitere Informationen
Anmeldung
Mit Ihrer Anmeldung wählen Sie verbindlich eines der zwei angebotenen Module,
A Prosa und Lyrik oder B Szenisches Schreiben.
Offizieller Anmeldeschluss ist der 7. September 2018.
Anmeldungsformularen finden Sie auf der Homepage des Literaturhauses
(Kurzlink: http://bit.ly/welten-hro) und auf der Seite des Bildungsservers M-V
(https://www.bildung-mv.de/lehrer/fort-und-weiterbildung/externe-fortbildungsangebote).
Reise- bzw. Übernachtungskosten
Bei Reise- und ggf. Übernachtungskosten müssen die TeilnehmerInnen zunächst in Vorleistung gehen.
Lehrkräfte der öffentlichen Schulen können die Rückerstattung der anfallenden Kosten beim IQ M-V
beantragen. Bei der Suche nach einem geeigneten Hotel vor Ort sind wir Ihnen gern behilflich.
Fortbildungskosten / Verpflegung vor Ort / Materialien
Im Rahmen des zweijährigen Fortbildungsprogramms entstehen Ihnen Kosten von 150 €.
Diese werden bei den TeilnehmerInnen der öffentlichen Schulen vom IQ M-V übernommen.
Mit diesem Teilnahmebeitrag werden Ihre Verpflegung im Rahmen der Fortbildungstage
(Mittagessen, Kaffee, Tee etc.) sowie Aufwendungen für Materialien etc. finanziert.
Anfahrt Zug
Wenn Sie mit dem Zug anreisen, verlassen Sie nicht den Bahnhof, sondern nehmen Sie die Straßenbahn-
linie 3 oder 6 Richtung Neuer Friedhof oder die Straßenbahnline 2 Richtung Rostock Reutershagen und
steigen Sie am Doberaner Platz aus. Danach die Doberaner Straße, Richtung Rostocker Brauerei hügelauf-
wärts gehen. Das Literaturhaus befindet sich im Peter-Weiss-Haus, Doberaner Str. 21, direkt neben
der Rostocker Brauerei, auf der linken Straßenseite.
Parken
1) Parkplatz Am Stadthafen 1,– Std., Tagestarif 6,–
Mo – So, 8 – 20 Uhr Fußweg zum Literaturhaus ca. 8 Minuten
2) Parkhaus Doberaner Hof / Rewe 1,– Std. max. Tagestarif 10,–
Mo – So, 6 – 24 Uhr Fußweg zum Literaturhaus ca. 3 Minuten
17Hinweise auf relevante
Publikationen
Ulf Abraham / Ina Brendel-Perpina: „Literarisches Schreiben im Deutschunterricht“
Produktionsorientierte Literaturpädagogik in der Aus- und Weiterbildung, Klett Verlag 2015.
José F.A. Oliver: „Lyrisches Schreiben im Unterricht“ Vom Wort in die Verdichtung, Klett Verlag 2013.
Tilman Rau: „Journalistisches Schreiben im Unterricht“ Das Reporter-Ich,
Meinungsfindung, Nachrichten und Journale, Klett Verlag 2017.
Thomas Richhardt: „Szenisches Schreiben im Unterricht“
Minidramen, Szenen, Stücke selber schreiben, Klett Verlag 2011.
Jörg Roche / Gesine Lenore Schiewer (Hrsg.): „Identitäten – Dialoge im Deutschunterricht“
Schreiben – Lesen – Lernen – Lehren, Narr Francke Attempto Verlag, Tübingen 2017.
Jörg Roche / Gesine Lenore Schiewer (Hrsg.): „Emotionen – Dialoge im Deutschunterreicht“
Schreiben – Lesen – Lernen – Lehren, Narr Francke Attempto Verlag, Tübingen 2018.
Ulrike Wörner / Tilman Rau / Yves Noir: „Erzählendes Schreiben im Unterricht“
Werkstätten für Skizzen, Prosatexte, Fotografie, Klett Verlag 2012.
18Kontakt
Literaturhaus Rostock e.V.
Dr. Agnieszka Nyenhuis
Weltenschreiber
Projektkoordination in M-V
Adresse / Doberaner Straße 21, 18057 Rostock
Telefon / + 49 (0) 381– 4909199
Fax / + 49 (0) 3222 – 3717441
E-Mail / nyenhuis@literaturhaus-rostock.de
Website / www.literaturhaus-rostock.de
Ein Projekt des Literaturhauses Rostock
und der Robert Bosch Stiftung GmbH.
Unterstützt durch das Ministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern.
In Kooperation mit dem Lehrstuhl für Fachdidaktik Deutsch der
Universität Rostock und dem Institut für Qualitätsentwicklung M-V.
19Sie können auch lesen