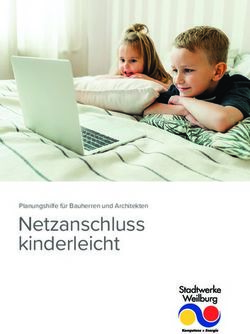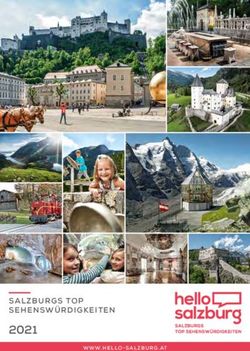Lyrik und Rhetorik Robert Walsers Gedicht Zu philosophisch und Bertolt Brechts Gleichnis des Buddha vom brennenden Haus - Kritische Robert ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
WOLFRAM GRODDECK
Lyrik und Rhetorik
Robert Walsers Gedicht Zu philosophisch und Bertolt Brechts
Gleichnis des Buddha vom brennenden Haus
Der Frage nach der Wirksamkeit rheto- Zunächst liest man Walsers Gedicht als ei-
rischer Strukturen in lyrischen Texten ne philosophische Reflexion auf das ly-
möchte ich anhand von zwei sehr unter- rische Ich und bemerkt dabei, dass der
schiedlichen Gedichten nachgehen. Zu- Sinn des kurzen Gedichts, seine ‚Aussa-
nächst sei ein Gedicht von Robert Walser ge‘, keineswegs einfach zu fassen ist. Die
genauer betrachtet, das 1899 in der Wiener Überschrift „Zu philosophisch“ scheint das
Rundschau erschienen ist. Es ist die erste Gedicht auch gleich selbst zu disqualifizie-
namentlich gezeichnete Publikation des ren, indem es eine mögliche Kritik daran
21-jährigen Dichters und trägt die Über- vorwegnimmt – jedenfalls wenn man von
schrift: Zu philosophisch. Das zweite Ge- der traditionell romantischen Vorstellung
dicht, das Gleichnis des Buddha vom bren- ausgeht, dass Lyrik Gefühle und nicht Ge-
nenden Haus, ist ein Agitationsgedicht von danken zum Ausdruck zu bringen habe.1
Bertolt Brecht, das 1939 in den Svendburger Das Gedicht ist formal auf die Dreizahl hin
Gedichten veröffentlicht wurde. stilisiert: Es besteht aus drei Strophen in
regelmäßig alternierenden dreihebigen
1. Jamben, und auch in der inhaltlichen Dar-
stellung zeigt sich die Dreizahl wieder.
Zu philosophisch Die erste Strophe ist verwirrend, indem sie
eine eigentümliche Auflösung des Ichs im
Wie geisterhaft im Sinken Gedicht zur Darstellung bringt. Es beginnt
und Steigen ist mein Leben. mit einer Aussage über das eigene Leben,
Stets seh ich mich mir winken, das „im Sinken / und Steigen“ (V. 1 f.)2 dem
dem Winkenden entschweben. Ich des Gedichtes „geisterhaft“ (V. 1) vor-
kommt. In der sinkenden und steigenden
5 Ich seh mich als Gelächter,
Bewegung seines Lebens scheint das Sub-
als tiefe Trauer wieder,
jekt des Gedichtes weniger das Wirken ei-
als wüsten Redeflechter;
nes philosophisch begreifenden Geistes
doch alles dies sinkt nieder.
wahrzunehmen, sondern eher das eines
Und ist zu allen Zeiten unwirklichen Gespenstes. Im dritten Vers
10 wohl niemals recht gewesen. sieht sich das lyrische Ich in drei ‚Fälle‘ ver-
Ich bin vergessne Weiten strickt bzw. in die drei grammatischen Ka-
zu wandern auserlesen. sus: Nominativ (ich), Akkusativ (mich) und
(Walser 2021, 105) Dativ (mir). Das Ich im Nominativ ‚sieht‘,
wie das Ich im Akkustativ dem Ich im Da-
(1) Binder (1976, 83 – 90) gibt die bisher gründlichste und theoretisch versierteste Auseinandersetzung mit
Walsers Gedicht, indem er das Gedicht als reflektierende „Gedankenlyrik“ liest. Binder konfrontiert Zu phi-
losophisch auf erhellende Weise mit dem Gedicht Welten (Walser 2021, 63).
(2) Caduff (2016, 45) unterzieht das Gedicht Zu philosophisch exemplarisch einer poetologischen Lektüre. So
erkennt er in den „substantivierten Verben ‚Sinken‘ und ‚Steigen‘, die sich in der Rhythmik des jambischen
Versfußes spiegeln“, eine „poetologische Dimension“.
Der Deutschunterricht 1/2022 17tiv ‚zuwinkt‘, wobei das Ich im Akkusativ bildung genoss, überhaupt mit der Tradi-
sich in einen Dativ wandelt („dem Win- tion der Rhetorik in Kontakt gekommen
kenden“ [V. 4]) und dem Nominativ-Ich als sein? Dazu wäre zu bemerken, dass bis
‚entschwebendes‘ erscheint. Den drei Zu- ins 20. Jahrhundert hinein Rhetorik – oft
ständen eines dergestalt sich entziehen- verkappt als ‚Aufsatzlehre‘ – allgemeiner
den lyrischen Ichs entspricht kein festes, Schulstoff war und dass Robert Walser in
souveränes Ich mehr. Vielmehr wird das seinem ersten Buch Fritz Kochers Aufsätze
Ich selbst „geisterhaft“ (V. 1) und schwebt die stilistischen Regeln des Schulaufsat-
auf und nieder, um dann zu „entschweben“ zes kunstvoll parodiert hat (vgl. Walser
(V. 4). Diese eigenartige Denkbewegung – 2010; generell dazu Müller 2007).
Gronau (2006, 146) nennt sie eine „meta- Allerdings sieht oder bekennt sich das
phorische Halluzination“, Binder (1976, 86) Ich des Gedichtes zugleich als „wüsten
spricht von einer „Aporie der Selbstrefle- Redeflechter“.5 Das Adjektiv „wüst“, das in
xion“ – wirkt wie ein spitzfindiges, sophis- der Verbindung mit einer Rede durchaus
tisches Verfahren, oder wie eine Art von auch ‚öde‘ oder ‚leer‘ bedeuten kann, ist
sprachphilosophischem Hütchenspiel. hier zunächst im Sinn von ‚hässlich‘ oder
In der zweiten Strophe ist das Ich denn gar ‚unanständig‘ zu verstehen.6 Nicht nur,
auch prompt wieder da und bestimmt weil diese Bedeutung von ‚wüst‘ im Schwei-
sich erneut als Instanz der Selbstbeob- zerdeutschen vorherrscht, sondern auch
achtung: „Ich seh mich als […]“ (V. 5). Al- weil das Adjektiv in der Gedichtsammlung
lerdings ist das Gesehene nun metony- von 1909 noch einmal in den Schlussver-
misch objektiviert. Und dies wieder in sen des sprachkritischen Gedichts Heim-
drei Zuständen: als „Gelächter“ (V. 5), als kehr in diesem Sinn verwendet wird:
„tiefe Trauer“ (V. 6) und als „Redeflech-
ter“ (V. 7). Während „Gelächter“ und „Ich geh’ vorbei, den Blick zum Schnee
„tiefe Trauer“ eher als Metonymien der gesenkt, an meiner Wange ist
Wirkung von Rede (oder sprachlichem nichts, als erinnrungsheißes Rot,
Handeln überhaupt) aufzufassen sind, ist mich mahnend an die wüste Sprach.“
„Redeflechter“ eine subjektive Bezeich- (Walser 2021, 83, V. 14–17)
nung: Mit „Gelächter“ und „tiefe[r] Trau-
er“ erkennt sich das Ich des Gedichtes als Dieses Gedicht thematisiert ein sprachli-
Produzent, als „Redeflechter“. ches Ungeschick („auf meiner Lippe bebt
Das Wort „Redeflechter“ ist ein Neolo- es noch, / weil ich mein Herz ihr übertrug
gismus Walsers3 und es ist hier absolut / zum Sprechen“, V. 2–5) und semantisiert
sinnvoll. Indem sich das Ich des Gedich- in der Korrespondenz zur Gedichtausga-
tes als „Redeflechter“ sieht, bezeichnet es be von 1909 den „wüsten Redeflechter“ als
sich nämlich als ‚Texter‘ von Rede; denn eine sprachskeptische Figur oder auch als
das lateinische Wort „textus“ bedeutet Figur einer Sprach-Scham. Die „Sprach“
ursprünglich ‚Geflecht‘.4 Und so behaup- des Dichters wird „wüst“, wenn sie unkon-
tet sich das Gedicht in seiner Mitte als trolliert sagt, was vom „Herz“ kommt. Was
ein ausdrücklich rhetorisch produzier- dem lyrischen Ich im Gedicht Heimkehr die
ter Text. Aber konnte der junge Robert Schamröte auf die „Wange“ bringt, bewirkt
Walser, der nur eine einfache Schulaus- in Zu philosophisch „Gelächter“ und „tiefe
(3) Das Wort „Redeflechter“ findet sich auch in Walsers Werk nur in diesem einen Gedicht, es ist also nicht nur
ein Neologismus, sondern auch ein sogenanntes Hapaxlegomenon, d. h. ein ‚Ein-einziges-Mal-zu-Lesendes‘.
(4) Der vermutlich früheste Beleg für das Wort textus, das im Wortsinn ‚das Gewobene‘, ‚das Geflecht‘ bedeu-
tet, als Bezeichnung eines sprachlichen Zusammenhangs findet sich in Quintilians Rhetorik im 9. Buch, 4.
Kapitel, das von der Wortfügung handelt: „verba [...] in textu iungantur“ (Quintilianus 2015, 2. Teil, 370 [IX
4, 13]). Inzwischen ist die ‚textile‘ Metaphorik für literarische Texte längst habitualisiert und signalisiert
meistens die Dimension poetischer Selbstbezüglichkeit.
(5) Den „wüsten Redeflechter“ findet man nur im Erstdruck des Gedichts von 1899 und in der bibliophilen
ersten Auflage der Gedichte von 1909. In der zweiten Auflage von 1919 wird er – möglicherweise durch den
Eingriff eines Lektors – zu einem „wilden Redeflechter“ umbenannt und findet sich so in fast allen späte-
ren Abdrucken des Gedichts (vgl. Walser 2021, 104 f. und 173 f.).
(6) Vgl. den Artikel „wüst, adj.“ im Deutschen Wörterbuch. Der Artikel umfasst 22 Spalten und zeigt eine Be-
deutungsbreite von ‚leer‘, ‚öde‘, ‚unbewohnt‘ bis zu ‚abscheulich‘, ‚schmutzig‘, ‚hässlich‘.
18 Der Deutschunterricht 1/2022Trauer“. Der vierte Vers der zweiten Stro- der ‚zu philosophischen‘ Gedanken im Ge-
phe von Zu philosophisch nivelliert jedoch dicht löst die Erinnerung daran aus, dass
solche Sprachverzweiflung: „doch alles es überhaupt „vergessne Weiten“ gibt.
dies sinkt nieder“ und stellt mit dem Sin- Aber man kann hier gleich noch einen
ken auch wieder die Korrespondenz zum Schritt weiter gehen: Die memoria als
Anfang des Gedichts her. vierter Teil der Rhetoriklehre hängt mit
Die dritte Strophe knüpft mit dem ellipti- ihrem ersten Teil, der inventio (der Lehre
schen Satz in V. 9 f. direkt an „alles dies“ von der ‚Erfindung‘ der Rede), insofern zu-
aus V. 8 an: „Und ist zu allen Zeiten / wohl sammen, als die ‚zu findenden‘ Gegenstän-
niemals recht gewesen.“ Damit ist in ei- de einer Rede an bestimmten locis oder
nem dritten Schritt die „Aporie der Selbst- „Orten“ aufzusuchen sind, nämlich – so
reflexion“ ebenso wie die Sprachskepsis der große Rhetoriksystematiker Heinrich
gewissermaßen beiseitegeschoben, und Lausberg in einer etwas gewagten Meta-
das Gedicht schließt in einer Art Synthese pher – „im Unterbewußtsein“ des Redners
mit einem seltsam abstrakten Bild: (Lausberg 1971, 24). Anders gesagt: Erin-
nerung und Erfindung setzen einander vo-
„Ich bin vergessne Weiten raus und gehen ineinander über.
zu wandern auserlesen.“ Nachdem das Ich des Gedichts mit der
abstrakten Selbsterkenntnis geschei-
Die Schlusswendung des Gedichts hat Le- tert ist, wird es sich als ein „zu wan-
serinnen und Leser Walsers immer wie- dern auserlesen[es]“ Subjekt in den
der fasziniert.7 Ihre poetisch suggestive „vergessne[n] Weiten“ der Welt (wieder)
Wirkung erklärt sich nur zum Teil aus erfinden. So scheint es, dass die philoso-
der rhetorischen Figuration des Satzes, phische „Aporie der Selbstreflexion“ im
in welchem die syntaktische Umstellung Gebiet der Rhetorik ausgetragen wird und
– die Anastrophe – mit der Schlussstellung dabei ins Offene weist. Denn Walsers Ge-
des Verbs eine gewisse Spannung erzeugt, dicht geht mit dem adjektivischen Titel
sondern vor allem durch die rätselhafte Zu philosophisch und dem Neologismus
Metapher „vergessne Weiten“. vom „Redeflechter“ über Philosophie
Das Ich des Gedichts sieht sich nun nicht und Rhetorik hinaus und wählt den neu-
mehr als ein ‚entschwebendes‘ Subjekt, en Weg der Dichtung.
sondern weiß selbstbewusst, dass es „aus- Wie könnte man sich nun den Weg die-
erlesen“ ist „zu wandern“.8 Doch die Re- ses Wanderers, die „vergessne[n] Weiten“,
de von den „vergessne[n] Weiten“ konter- anschaulich vorstellen? In derselben Ge-
kariert den Topos oder das Klischee von dichtsammlung, in der Zu philosophisch
einem, der ‚in die weite Welt‘ aufbricht. und Heimkehr stehen, findet sich auch
Warum und von wem sind diese „Weiten“ ein Gedicht Schnee,10 dessen dritte Stro-
‚vergessen‘? Als „vergessne“ sind es Reali- phe lautet:
täten, die sich dem individuellen und dem
kollektiven Bewusstsein entzogen haben, „Das gibt dir, ach, eine Ruh, eine Weite,
aber dennoch existieren. Indem die „Wei- die weißverschneite Welt macht mich
ten“ als „vergessne“ im Text des Gedichtes schwach.“
auftauchen und damit wieder erinnert wer- (Walser 2021, 77)
den, gemahnen sie an den Bereich der Me-
moria (der Lehre vom Gedächtnis) in der So ist es zum einen die im Gedicht bis-
klassischen Rhetorik.9 Das ‚Niedersinken‘ her vergessene „Welt“, zum anderen eine
(7) So etwa Gronau (2006, 147): „Ein eigentümlicher Zauber leuchtet aus diesem Satz.“ Bernhard Böschen-
stein verwendet diese Verse als Überschrift seiner Würdigung des Komponisten Heinz Holliger, der 12 frü-
he Gedichte von Walser vertont hat, darunter auch Zu philosophisch“ (vgl. Böschenstein 1996).
(8) Caduff (2016, 45) deutet die Verben „wandern“ und „auserlesen“ als Reflexion auf den Rezeptionsprozess:
„wandern“ als ‚schreiben‘ und „auserlesen“ als ‚gelesen werden‘. – Binder (1976, 88) liest „vergessne Weiten“
als „Wiederentdeckung der Objektwelt“.
(9) Zu den fünf Teilen der Rhetoriklehre, den rhetorices partes vgl. Groddeck (2020, 95–115).
(10) Gronau (2006, 147) sieht ebenfalls einen motivischen Bezug der „vergessne[n] Weiten“ zum Gedicht
Schnee.
Der Deutschunterricht 1/2022 19leere „Weite“, in die das Ich nun aufbre- Bertolt Brecht dar. Das Gedicht entstand
chen soll.11 Das Bild der weißen, leeren 1937 im dänischen Exil des Dichters, der
Schneelandschaft ließe sich – vergleich- aus dem nationalsozialistischen Deutsch-
bar der leeren Leinwand für den Maler land geflohen war. Es wurde 1939 in den
oder dem weißen Blatt für den Schriftstel- Svendborger Gedichten im Kontext von ei-
ler – als eine transzendentale Metapher nerseits sehr persönlichen, andererseits
für Krise und Beginn schöpferischer Tä- auch kommunistisch-agitatorischen Ge-
tigkeit verstehen. dichten veröffentlicht.12 Das Gleichnis des
Buddha vom brennenden Haus ist nota be-
ne das einzige Gedicht in Brechts Gesamt-
werk, in dem von Buddha die Rede ist.
Den Stoff zum Gedicht hat Brecht of-
fenbar dem Roman von Karl Gjellerup
Der Pilger Kamanita entnommen.13 Das
„Gleichnis“ vom „brennenden Haus“ ist
keine authentisch überlieferte Rede Bud-
dhas, sondern sehr wahrscheinlich eine
Erfindung Gjellerups.
Bestimmend für die poetische Gestalt
des Gedichtes ist der Begriff „Gleich-
nis“, der im Titel und im Mittelteil des
Gedichts genannt wird. Mit dem Wort
„Gleichnis“ assoziiert man zunächst
vielleicht die Gleichnisse Jesu aus dem
Neuen Testament. Das „Gleichnis“ ist
aber auch ein mit Vergleich und Meta-
pher verwandtes rhetorisches Mittel, das
schon in der Rhetorik des Aristoteles be-
dacht wird. Aristoteles kennt zwei „Be-
weismittel“ des Redners: das „Beispiel“
und das „Enthymem“ oder die logische
Schlussfolgerung (Aristoteles 2018, 243
[1393a]); zu den Gleichnissen zählen
die „Aussprüche des Sokrates“ (ebd.,
245 [1393b]) – sie dienen dem Redner
Abb. 1: Radierung von Robert Walsers Bruder zur anschaulichen Exemplifikation ei-
Karl Walser. Abdruck mit freundlicher Geneh- nes schwierigen Sachverhalts.
migung der Robert Walser-Stiftung Bern. In: Das „Gleichnis“ in der Überschrift von
Robert Walser (1909): Gedichte, Berlin: Bruno Brechts Text betrifft das Thema und
Cassirer Verlag, 17. ebenso die Form des Gedichts: Es er-
zählt ein Gleichnis und ist zugleich sel-
ber ein Gleichnis, indem es die Erzäh-
2. lung, unter welchen Umständen Buddha
Ganz anders stellt sich die Wechselwir- sein „Gleichnis“ erzählt, zum Gleichnis
kung von Lyrik und Rhetorik im Gleich- für die politische Entscheidungssituati-
nis des Buddha vom brennenden Haus von on in der Gegenwart macht.14
(11) Die Schneelandschaft ist im Übrigen auch ein durchgehendes Thema im Werk Robert Walsers, von den
frühen Gedichten über Geschwister Tanner und zahlreiche Prosastücke bis hin zu den spätesten Gedichten
aus der psychiatrischen Anstalt Waldau.
(12) Zum historischen Hintergrund des Gedichts vgl. Detering (2014, 222 f.).
(13) Vgl. Brecht 1988b, 369. – Die Quellenfrage behandelt am ausführlichsten Kuschel (2018). Er gibt auch
den vollständigen Wortlaut des Gleichnisses bei Gjellerup wieder (ebd., 511 f.).
(14) Sowohl Detering (2014, 224) als auch Kuschel (2008, 512) thematisieren die „Schachtelung“ in der Kom-
position des Gedichts, ohne den rhetorisch-literarischen Formbegriff „Gleichnis“ weiter zu verfolgen.
20 Der Deutschunterricht 1/2022Gleichnis des Buddha vom brennenden Haus
Gothama, der Buddha, lehrte
Die Lehre vom Rade der Gier, auf das wir geflochten sind und empfahl
Alle Begierde abzutun und so
Wunschlos einzugehen ins Nichts, das er Nirwana nannte.
5 Da fragten ihn eines Tags seine Schüler:
Wie ist dies Nichts, Meister? Wir alle möchten
Abtun alle Begierde, wie du empfiehlst, aber sage uns
Ob dies Nichts, in das wir dann eingehen
Etwa so ist wie dies Einssein mit allem Geschaffenen
10 Wenn man im Wasser liegt, leichten Körpers, im Mittag
Ohne Gedanken fast, faul im Wasser liegt oder in Schlaf fällt
Kaum noch wissend, daß man die Decke zurechtschiebt
Schnell versinkend, ob dies Nichts also
So ein fröhliches ist, ein gutes Nichts, oder ob dies dein
15 Nichts nur einfach ein Nichts ist, kalt, leer und bedeutungslos.
Lange schwieg der Buddha, dann sagte er lässig:
Keine Antwort ist auf euere Frage.
Aber am Abend, als sie gegangen waren
Saß der Buddha noch unter dem Brotbaum und sagte den andern
20 Denen, die nicht gefragt hatten, folgendes Gleichnis:
Neulich sah ich ein Haus. Es brannte. Am Dache
Leckte die Flamme. Ich ging hinzu und bemerkte
Daß noch Menschen drin waren. Ich trat in die Tür und rief ihnen
Zu, daß Feuer im Dach sei, sie also auffordernd
25 Schnell hinauszugehen. Aber die Leute
Schienen nicht eilig. Einer fragte mich
Während ihm schon die Hitze die Braue versengte
Wie es draußen denn sei, ob es auch nicht regne
Ob nicht doch Wind ginge, ob da ein anderes Haus sei
30 Und so noch einiges. Ohne zu antworten
Ging ich wieder hinaus. Diese, dachte ich
Müssen verbrennen, bevor sie zu fragen aufhören. Wirklich, Freunde
Wem der Boden noch nicht so heiß ist, daß er ihn lieber
Mit jedem andern vertauschte, als daß er da bliebe, dem
35 Habe ich nichts zu sagen. So Gothama, der Buddha.
Aber auch wir, nicht mehr beschäftigt mit der Kunst des Duldens
Eher beschäftigt mit der Kunst des Nichtduldens und vielerlei Vorschläge
Irdischer Art vorbringend und die Menschen lehrend
Ihre menschlichen Peiniger abzuschütteln, meinen, daß wir denen, die
40 Angesichts der heraufkommenden Bombenflugzeuggeschwader des Kapitals noch allzulang fragen
Wie wir uns dies dächten, wie wir uns das vorstellten
Und was aus ihren Sparbüchsen und Sonntagshosen werden soll nach einer Umwälzung
Nicht viel zu sagen haben.
(Brecht 1988b, 36 f.)
Der Deutschunterricht 1/2022 21Brechts Buddha-Gleichnis unterscheidet alisiert sich der Vers (und damit die Vers-
sich nicht nur in manchen inhaltlichen dichtung überhaupt); denn so entsteht im
Details von der Vorlage, sondern auch in Text eine formale Dynamik im Widerstreit
der Transposition der Prosaform in ein zwischen Verseinheit und syntaktischer
reimloses Gedicht in freien Metren. Das Einheit: „Der Vers bestätigt in eben dem
scheint immer noch nicht ohne Irritati- Augenblick, da er die syntaktische Ver-
on rezipierbar zu sein: bindung sprengt, seine Identität“ (ebd.,
23). Dieser Moment bedingt ein kurzes
„Einerseits erzählt es seine lehrhafte Ge- Innehalten im Ablauf der Verse. Brecht
schichte in reimlosen und metrisch nicht selbst entwickelt in seinem Aufsatz Über
geregelten Sätzen, die sich unschwer wie reimlose Lyrik mit unregelmäßigen Rhyth-
eine kurze Geschichte in Prosa (vor-)lesen men von 1938, in dem er eigene frühe-
lässt. Anderseits gibt es diesen Sätzen re Gedichte untersucht, eine Theorie des
durch den Zeilenumbruch den Charakter Verse-Sprechens, die dem Versübergang
von Versen, so dass man sie auch wie ei- ebenfalls diese Funktion zuweist: „Das
nen reimlosen Verstext sprechen kann“ Ende der Verszeile bedeutet immer eine
(Detering 2014, 224). Zäsur“ (Brecht 1993, 362). Und genau dies
ist in Brechts Buddha-Gedicht der Fall,
Allerdings ist das rein optische Merk- wobei sich die Enjambements – oder mit
mal „Zeilenumbruch“ keine ausreichen- Brecht zu reden: die Zäsuren – in Hinsicht
de Bestimmung für einen „Verstext“. Was auf die Bedeutungsverdichtung der pro-
als Prosatext gelesen wie ein nüchternes saischen Aussage schwächer oder stärker
Resümee klingt, zeigt bei Beachtung der auswirken können.
Versifikation einen subtilen Rhythmus: Schon im Übergang vom ersten zum zwei-
Das zeigt sich schon im ersten Abschnitt ten Vers wird die Figura etymologica „lehr-
des Gedichts (V. 1–4), der die Lehre des te / Die Lehre“ durch das Enjambement
Buddha in einem einzigen Satz zusam- gleichsam gedehnt und macht eine ei-
menfasst. Ausgehend von der Anfangs- gentümliche Selbstbezüglichkeit im Be-
betonung des Wortes „Gothama“ liest sich griff der „Lehre“ spürbar (wobei auch das
der erste Vers trochäisch und regelmäßig Wort ‚Leere‘ mitgehört werden darf). Die
alternierend, der zweite dagegen weitge- Beseitigung der „Begierde“ ist Vorausset-
hend daktylisch. Im dritten und vierten zung, um „so / Wunschlos“ im „Nichts“ zu
Vers werden die Versbetonungen wieder verschwinden.
alternierend. Damit ist ein Rhythmus vor- Im zweiten Abschnitt (V. 5 –15) fragen die
gegeben, der im Gedicht ständig variiert Schüler den Gothama nach dem Wesen
wird. des „Nichts“: „Wie ist dies Nichts, Meis-
Entscheidend für den „Verscharakter“ des ter?“ Sie stellen damit eine im Prinzip un-
Ganzen ist jedoch der Zeilensprung oder sinnige Frage; denn „Nichts“ kann nicht
das Enjambement, das nicht erst Giorgio sein. Aber die ausschweifende Frage der
Agamben als das bestimmende Merkmal Schüler ist bemerkenswert eloquent: Ein
von Versdichtung erkannt hat; doch for- einziger Satz bringt in gedrängter Form,
muliert er es auf prägnante Weise: „Es ist von Nebensatz zu Nebensatz gleitend, die
des Nachdenkens wert, daß es keine be- „Begierde“ der Schüler nach Glück gleich-
friedigende Definition des Verses gibt, au- sam performativ zum Ausdruck – „ob dies
ßer der, die ihn durch die Möglichkeit des Nichts also / So ein fröhliches ist, ein gu-
Enjambements, das der Prosa ermangelt, tes Nichts“.15 Durch das Enjambement mit
bestimmt.“ (Agamben 2003, 21) Erst mit „also / So“ wird ein Stocken, fast ein Stot-
der „Möglichkeit des Enjambements“ re- tern im Fragefluss spürbar, als ahnten die
(15) Sowohl Kuschl (vgl. 2018, 527) als auch Detering (vgl. 2014, 233) verweisen in Bezug auf die Verse 6 bis
15 auf Entsprechungen im Lebensgefühl zu Brechts frühen Gedichten, insbesondere in Vom Schwimmen in
Seen und Flüssen (Brecht 1988a, 72f.). Dass Brecht damit auch auf sein eigenes Frühwerk reflektiert, ist ein
interessanter poetologischer Aspekt des Buddha-Gedichtes, auch wenn ich die etwas voreilige Schlussfol-
gerung von Detering „Zu diesen Schülern zählt auch der Sprecher des Gedichts selbst“ nicht teilen möchte.
22 Der Deutschunterricht 1/2022Schüler selber schon, dass sie die Lehre scheint das Wort ‚nichts‘, nachdem es zu-
Buddhas missverstehen. Zum Ende der vor – allerdings nicht von Buddha selbst –
langen Periode der Schülerfragen kommt sieben Mal zur substantivierten Form des
dann auch die ernüchternde Alternative: „Nichts“ hervorgehoben wurde, zuletzt
„oder ob dies dein / Nichts nur einfach ein als bloß funktionales Indefinitpronomen.
Nichts ist, kalt, leer und bedeutungslos“ Während die Passage mit dem „Gleichnis“
(V. 14 f.). In der Rede der Schüler wird das (V. 21– 32) aus insgesamt zehn kurzen Sät-
Wort „Nichts“ sechsmal wiederholt und zen besteht, die an keiner Stelle mit der
nähert sich mit dem letzten Wort, dem Verszeile zusammenfallen, besteht die
Wort „bedeutungslos“, dem an, was Bud- Schlusspassage des Gedichts (V. 36 – 43)
dha „Nirwana“ (V. 4) nennt. Wieder ist es – eingeleitet wiederum mit einem „Aber“
das Enjambement, das mit der Zuschrei- – aus einem einzigen Satz. Zwar besteht
bung des „Nichts“ in Buddhas ‚Lehre‘ die auch die drängende Frage der „Schüler“
Leere des „Nichts“ spürbar macht: „dies (V. 6 –15) aus nur einem Satz, doch wäh-
dein / Nichts“ (V.13 f.). rend dieser sich hypotaktisch gleitend
Das lange Schweigen des Buddha auf die bis zum Wort „bedeutungslos“ hinzieht,
Frage endet mit einem „lässig“ formulier- ist der Schlusssatz des Gedichts wie eine
ten Satz – dem einzigen im ganzen Ge- klassische rhetorische Periode gebaut.16
dicht, bei dem Syntagma und Vers kon- Die einzelnen Abschnitte des „Gleichnis“-
gruent sind: „Keine Antwort ist auf euere Gedichts unterscheiden sich auffällig in
Frage“. (V. 17) ihrer – mit Brecht zu reden – „Versarchi-
Die folgende Sequenz (V. 18 – 35) beginnt tektur“ (Brecht 1993, 358).
mit einem gewichtigen Einschnitt, einem Das syntaktische Gerüst des Schlusssatzes
„Aber“, das durch mehrfache Alliteratio- „Aber auch wir […] meinen, daß wir de-
nen hervorgehoben ist: „Aber am Abend, nen, die […] fragen […] Nicht viel zu sagen
als […]“. Buddha erzählt nun „denen, die haben“, stimmt genau mit der Haltung
nicht gefragt hatten“ jenes „Gleichnis“, Buddhas überein. Die Differenz zur bud-
das dem Gedicht den Titel gibt. Buddha dhistischen Lehre wird erst in den einge-
betritt ein brennendes Haus, um die darin schobenen Nebensätzen, den Hyperbata,
weilenden Menschen zu retten. Doch die deutlich. In diesen Einschüben wird der
„Leute“, aufgefordert, das Haus zu verlas- Bezug des ganzen Gedichts zur historisch-
sen, begreifen die Gefahr nicht und fra- politischen Gegenwart der späten 1930er-
gen, wie es „draußen denn sei“ (V. 28). Da Jahre hergestellt: Der drohende Zweite
sie nicht „zu fragen aufhören“, verzichtet Weltkrieg, der vom nationalsozialisti-
Buddha auf die Antwort und überlässt sie schen Deutschland ausgehen wird und
dem Feuertod. Sein „Gleichnis“ erläutert 1939, im Jahr der Veröffentlichung des
er mit den Worten: Gedichts, bereits Realität ist, wird durch
das Bild der „Bombenflugzeuggeschwa-
„Wem der Boden noch nicht so heiß ist, der des Kapitals“ auf den politischen Be-
daß er ihn lieber griff gebracht: Auf der Basis von Lenins
Mit jedem andern vertauschte, als daß er Schrift Der Imperialismus als höchstes Stadi-
da bliebe, dem um des Kapitalismus (1916 und 1917) lehrt
Habe ich nichts zu sagen.“ (V. 33–35) die marxistische Theorie, dass der Kapita-
lismus (bei Buddha die „Lehre vom Rade
Damit beantwortet Buddha die nicht ge- der Gier“) notwendig zu Imperialismus
stellte Frage nach seiner Nichtbeantwor- und schließlich zu Faschismus und Welt-
tung der Fragen der „Schüler“ (V. 5) nach kriegskatastrophe führt.
dem Wesen des „Nichts“ mit der Aussage, Der Vers 40, der das sperrige Mehrfach-
dass er „nichts zu sagen“ habe. Hier er- kompositum „Bombenflugzeuggeschwa-
(16) Eine rhetorische Periode besteht in der syntaktischen Komposition eines einzigen, in der Regel sehr
langen Satzes. Die Konstruktion einer Periode wird vom Sprechen und vom Atmen her gedacht und ist im
Prinzip den Phrasierungsregeln in der Musik vergleichbar. Zur ästhetischen Bedeutung der Periode in der
antiken Rhetorik vgl. Groddeck (2020, 74 f.).
Der Deutschunterricht 1/2022 23der“ enthält, ist mit 26 Silben der längs- (V. 6 –15) wirken emotional aufgeregt;
te Vers im ganzen Gedicht. Beim Vortrag Buddhas Erzählung vom brennenden
des Verses wird man diesen überlangen Haus (V. 21– 35) zeigt ein zurückgehalte-
Vers intuitiv in gesteigertem Tempo spre- nes, auf kurze Sätze reduziertes Pathos;
chen und hören. und der Schlussabschnitt erzeugt mit der
Der letzte Vers ist dagegen ein dreihebi- grandiosen Periode ein auf Wirkung kal-
ger Jambus und ist mit 7 Silben der kür- kuliertes Pathos. Die poetische Brisanz
zeste im Gedicht. Er schließt den kompo- des Gedichts zeigt sich in der Verwen-
sitorischen Bogen zum ersten, vierhebig dung des Wortes „Nichts“, in den auf-
trochäischen Vers, welcher mit 8 Silben fälligen Negationen im Textverlauf und
der zweitkürzeste ist. in der Pointe, dass der Text nach all den
Die Pointe im Schlussvers, wonach „wir“ rhetorischen Kunststücken an seinem
denen, die im Status quo der Gesellschaft Ende „nicht viel zu sagen“ hat. Denn sein
verharren, „nicht viel zu sagen“ zu haben, Sinn und seine Wirkung liegen jenseits
ist zugleich eine indirekte Aufforderung von Erzählung und Gleichnis.
zur politischen Aktion an jene, welche die
„Umwälzung“, d. h. die Revolution, als not- 3.
wendig erkennen. Beide Gedichte, das geheimnisvoll grüb-
Damit wendet sich der Text an die Rezi- lerische Gedicht Zu philosophisch von Ro-
pienten des Gedichts. In der Theorie der bert Walser ebenso wie das vielschich-
alten Rhetorik wird der Vortrag in einem tige Buddha-Gedicht von Bertolt Brecht
eigenen (dem fünften) Arbeitsgang des überschreiten am Ende den geschlosse-
Redners abgehandelt, dem der Actio. Die nen Text-Raum: Walsers Gedicht, indem
Kapitel über die Actio bei Quintilian kön- es unbekannte, „vergessne Weiten“ eröff-
nen als antike Schauspiellehre verstan- net, Brechts Gedicht, indem es – ohne es
den werden. Die von Cicero und Quinti- zu sagen – auf die Tat, die Aktion jenseits
lian entwickelten Vorschriften über den von Frage und Antwort drängt.
angemessenen Vortrag einer Rede betref- Damit sind aber beide Gedichte, die sich
fen die Artikulation, die Gestik und die rhetorischer Mittel bedienen, sie aber
Körperhaltung des Redners.17 Das Wich- am Ende verwerfen, bedeutungsoffen
tige ist, dass der antike Redner seine Rede wie alle großen poetischen Texte.
auswendig vorzutragen hatte, dass er sie Das ist für den Deutschunterricht kein
beim Vortrag also gleichsam verkörperte. Nachteil, sondern ein Geschenk für
Ähnliches schwebt Brecht mit seinem Schülerinnen und Schüler und vielleicht
Begriff des ‚gestischen Sprechens‘ vor,18 auch für die Lehrkräfte. Indem beide Ge-
das er von der Theaterarbeit übernimmt, dichte „nichts zu sagen haben“, aber zu-
aber auch von Sprechchören auf De- gleich Lust machen, immer genauer le-
monstrationen oder gar von den Wer- sen und denken zu wollen, ermöglichen
besprüchen der Straßenhändler (Brecht sie den Bezug auf die aktuelle Situati-
1993, 361 f.). Das Buddha-Gedicht entfal- on der Lernenden selbst: in Zu philoso-
tet seinen Sinn erst im laut gesproche- phisch die Auseinandersetzung mit der
nen Vortrag. Dabei werden in den Se- je eigenen, individuellen Situation; mit
quenzen des Gedichts unterschiedliche dem Gleichnis des Buddha vom brennenden
Zustände zwischen Nüchternheit und Haus die Diskussion über die allgemei-
Erregung nachvollziehbar: Die konsta- ne Situation der eigenen Gegenwart mit
tierend erzählerischen Passagen (V. 1– 4 ihren „brennenden“ Problemen wie die
und 16 – 20) sind nüchtern referierend Kriegsgefahr, das Flüchtlingselend oder
gehalten; die drängenden Schülerfragen der beginnende Klimawandel.
(17) In Quintilians Rhetorik ist es das 3. Kapitel im Buch XI (Quintilianus 2015, 2. Teil, 609 – 681); vgl, auch
Groddeck (2020, 92 f. und 114 f.).
(18) Brecht betont, „daß ich meine Hauptarbeit auf dem Theater verrichte; ich dachte immer an das Spre-
chen. Und ich hatte mir für das Sprechen (sei es der Prosa oder des Verses) eine ganz bestimmte Technik
erarbeitet. Ich nannte sie gestisch.“ (Brecht 1993, 359).
24 Der Deutschunterricht 1/2022Literatur
Primärliteratur
Brecht, Bertolt (1988a): Große kommentierte Böschenstein, Bernhard (1996): „Ich bin ver-
Berliner und Frankfurter Ausgabe. Hg. von gessne Weiten zu wandern auserlesen.“ An-
Werner Hecht u. a. Bd. 11: Gedichte 1. Samm- merkungen zu Robert Walsers Gedichten in
lungen 1918–1938. Bearb. von Jan Knopf und Heinz Holligers Zyklus „Beiseit“. In: Annet-
Gabriele Knopf. Frankfurt/M. te Landau (Hg.): Heinz Holliger. Komponist,
Brecht, Bertolt (1988b): Große kommentierte Ber- Oboist, Dirigent, 131–139.
liner und Frankfurter Ausgabe. Hg. von Wer- Caduff, Marc (2016): Revision und Revolte. Zu Ro-
ner Hecht u. a. Bd. 12: Gedichte 2. Sammlungen bert Walsers Frühwerk. Paderborn.
1938 –1956. Bearb. von Jan Knopf. Frankfurt/M. Detering, Heinrich (2014): Brecht und der Bud-
Brecht, Bertolt (1993): Große kommentierte dha. Eine kurze Geschichte. In: Heinrich De-
Berliner und Frankfurter Ausgabe. Hg. von tering/Maren Ermisch/Pornsan Watanangura
Werner Hecht u. a. Bd. 22.2, Teil 1: Schriften (Hg.): Der Buddha in der deutschen Dichtung.
1933 –1942. Bearb. von Inge Gellert/Werner Zur Rezeption des Buddhismus in der frühen
Hecht. Frankfurt/M. Moderne. Göttingen, 220 – 238.
Walser, Robert (2010): Kritische Ausgabe sämtli- Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und
cher Drucke und Manuskripte. Hg. von Wolf- Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im
ram Groddeck/Barbara von Reibnitz. Abt. I, Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital
Bd. 1: Fritz Kocher’s Aufsätze. Hg. von Hans- Humanities, Version 01/21, https://www.wo-
Joachim Heerde/Barbara von Reibnitz/Matthi- erterbuchnetz.de/DWB?lemid=W29830.
as Sprünglin. Basel/Frankfurt/M. Groddeck, Wolfram (2020): Reden über Rheto-
Walser, Robert (2021): Kritische Ausgabe sämtli- rik. Zu einer Stilistik des Lesens. Frankfurt/M.
cher Drucke und Manuskripte. Hg. von Wolf- Gronau, Peter (2006): „Ich schreibe hier deko-
ram Groddeck/Barbara von Reibnitz. Abt. I, Bd. rativ ...“. Essays zu Robert Walser. Würzburg.
10: Gedichte 1909/1919. Die Gedichte. Komödie. Kuschel, Karl-Josef (2018): Im Fluss der Dinge.
Hg. von Wolfram Groddeck/Barbara von Reib- Hermann Hesse und Bertolt Brecht im Dia-
nitz/Matthias Sprünglin. Basel/Frankfurt/M. log mit Buddha, Laotse und Zen. Ostfildern,
505 – 536.
Sekundärliteratur Lausberg, Heinrich (1971): Elemente der literari-
Agamben, Giorgio (2003): Idee der Prosa. Aus schen Rhetorik. 4. Aufl. München.
dem Italienischen von Dagmar Leupold und Müller, Andreas Georg (2007): Mit Fritz Kocher
Clemens-Carl Härle. Frankfurt/M. in der Schule der Moderne, Studien zu Robert
Aristoteles (2018): Rhetorik. Griechisch/Deutsch. Walsers Frühwerk. Tübingen/Basel.
Übers. u. hg. v. Gernot Krapinger. Stuttgart. Quintilianus, Marcus Fabius (2015): Ausbildung
Binder, Thomas (1976): Zu Robert Walsers frü- des Redners. Zwölf Bücher in zwei Teilen. La-
hen Gedichten. Eine Konstellation von Ein- teinisch und Deutsch. Hg. u. übers. v. Helmut
zelanalysen. Bonn. Rahn. 6. Aufl. Darmstadt.
Der Deutschunterricht 1/2022 25Sie können auch lesen