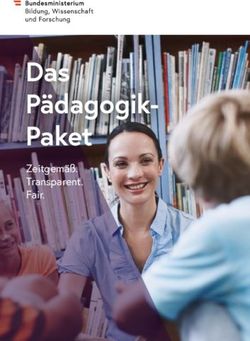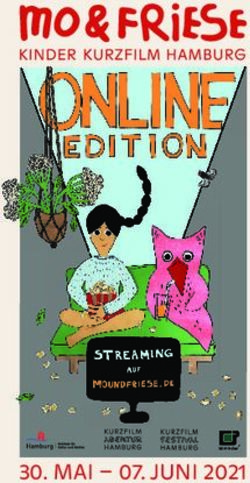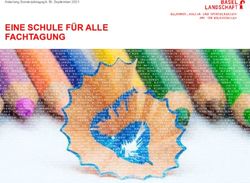MATHE MACHT STARK - DOKUMENTATION ZUM PILOTPROJEKT
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
MATHE MACHT STARK
EIN KONZEPT VON PROF. DR. AISO HEINZE | AUSGEZEICHNET MIT DEM POLYTECHNIK-PREIS 2011
Polytechnik-Preis
für die Didaktik der DOKUMENTATION
ZUM PILOTPROJEKT
Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften
und TechnikINHALT
03 MIT »MATHE MACHT STARK«
AUFHOLEN
Wie leistungsschwache Schüler das
Selbstvertrauen in ihre mathematischen
Fähigkeiten stärken können – Erfahrungen
aus dem Pilotprojekt
04 ANGSTFACH MATHE
LEICHT GEMACHT
Warum »Mathe macht stark«
gebraucht wird und wie es funktioniert
09 ERGEBNISSE UND
ERFAHRUNGEN
Das lehrt uns die Praxis
14 EMPFEHLUNGEN
Was bei der Umsetzung bedacht
werden sollte
15 IMPRESSUM3 VORWORT
MIT »MATHE MACHT
STARK« AUFHOLEN
Wie leistungsschwache Schüler das Vertrauen in ihre mathematischen
Fähigkeiten stärken können – Erfahrungen aus dem Pilotprojekt
Von Schülern hört man öfter: »Mathe, das ist mein
Horrorfach!«. Und Erwachsene kokettieren damit:
»Mathematik? Die habe ich noch nie verstanden. Aber
aus mir ist doch trotzdem etwas geworden.« Bei
genauer Betrachtung unseres Alltags stellen wir
jedoch fest: Nur ein sicherer Umgang mit Zahlen,
eine solide Vorstellung von Größen und Mengen
sowie ein räumliches Vorstellungsvermögen erlau-
ben es, dass wir uns in der Welt zurechtfinden. Natur-
wissenschaftliche und technische Erkenntnisse und
deren Umsetzung sind ohne Mathematik nicht vor-
stellbar. Mathematik gehört zur Allgemeinbildung.
Und wenn Schülern der Umgang mit der Mathema-
tik doch schwerfällt? Das mit dem Polytechnik-Preis
2011 ausgezeichnete Förderkonzept »Mathe macht
Dr. Wolfgang Eimer ist Bereichsleiter der
stark« zielt darauf ab, leistungsschwachen Schülern Abteilung Wissenschaft und Technik der
der Klassen fünf bis acht die individuelle Aufarbei- Stiftung Polytechnische Gesellschaft.
tung mathematischer Grundvorstellungen zu ermög-
lichen. Damit die Schüler in Frankfurt von diesem
ausgezeichneten Konzept profitieren können, hat
die Stiftung Polytechnische Gesellschaft gemeinsam
mit dem Landesschulamt und Lehrkräfteakademie
Hessen sieben Schulen bei der Implementierung von
»Mathe macht stark« unterstützt.
In dieser Dokumentation möchten wir Ihnen die
Ergebnisse und Erkenntnisse der Pilotschulen vor-
stellen. Damit wollen wir es Ihnen leicht machen,
das individuelle Förderkonzept »Mathe macht stark«
auch an Ihrer Schule einzuführen.
Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre!
Dr. Wolfgang Eimer4 VORSTELLUNG »MATHE MACHT STARK«
ANGSTFACH MATHE
LEICHT GEMACHT
Warum »Mathe macht stark« gebraucht wird und wie es funktioniert
Schlechte Erinnerungen an den Mathematikunter- Als Ursachen für mathematische Verständnisblocka-
richt haben viele. Doch was macht dieses Fach so den identifizierte die empirische Bildungsforschung
problematisch? Und wie groß sind die Mathematik- zu hohe Lerntempi, zu wenige kooperative Lern-
Probleme deutscher Schüler wirklich? Die jüngste formen und die zu spärliche Vermittlung multipler
PISA-Studie der Organisation für wirtschaftliche Zu- Lösungswege. Außerdem nimmt der Unterricht zu
sammenarbeit und Entwicklung (OECD) zeigte 2012: selten auf individuelle Unterschiede der Schüler
Nur 17,5 Prozent der deutschen Schüler können stra- Rücksicht, und es besteht ein Mangel an alltagsnahen
tegisch denken und Modelle für die Lösung komple- Übungsaufgaben.
xerer Aufgaben finden. Und 17,7 Prozent meistern
ihre Rechenaufgaben nur dann, wenn einfache For- Ausgehend von diesen Diagnosen hat Prof. Dr. Aiso
meln und Schritte zur Anwendung kommen. Dieses Heinze seit 2009 »Mathe macht stark« (MMS) ent-
Ergebnis ist zwar besser als in früheren PISA-Studi- wickelt. Heinze, der am Leibniz-Institut für die Päda-
en, teils gar besser als der OECD-Durchschnitt, den- gogik der Naturwissenschaften und Mathematik und
noch ist das »Mathe-Problem« nicht gelöst. Auf- an der Christian-Albrechts-Universität Kiel arbeitet,
fallend ist vor allem der Geschlechterunterschied: wendet sich damit an Schüler der Sekundarstufe I,
Jungen sind im Schnitt besser als Mädchen und die Schwierigkeiten mit der Veranschaulichung und
rücken deshalb leichter in die Spitzenleistungsgrup- dem Transfer abstrakter Mathematik haben. Ausge-
pe auf. Die Mädchen sind der Mathematik gegen- hend von Phänomenen des Alltags hilft ihnen »Mathe
über negativer und ängstlicher eingestellt, was ihre macht stark« beim individuellen Aufarbeiten von
Lernausdauer und das Vertrauen in die eigenen Wissensrückständen und beim Verinnerlichen mathe-
mathematischen Fähigkeiten herabsetzt. matischer Grundvorstellungen.
VERLAUF DES PILOTPROJEKTS
Start von »Mathe Abschluss-
macht stark« veranstaltung
Auftaktveranstaltung Zwischenbilanz und
mit Lehrerfortbildung Lehrerfortbildung
»Einsatz und Umgang »Einsatz und Umgang
mit dem Material« mit der Materialkiste«
Lehrerfortbildung
»Feedback im Unterricht«
Lehrerfortbildung
»Das diagnostische
Gespräch«
2012 2013 2014
09.2012 11.2012 02.2013 07.2013 02.2014 10.20145
» Ich liebe die ›Mathe macht stark‹-Stunden. Ich finde es gut,
wenn wir Themen wiederholen. In kleinen Gruppen kann
man sich besser konzentrieren und die Lehrerin hat mehr Zeit
und Ruhe, die Themen zu erklären. Im Unterricht sind meine
Mitarbeit und das Rechnen an der Tafel viel besser geworden. «
Zara Mackic ist Schülerin der
Friedrich-Ebert-Schule.6 VORSTELLUNG »MATHE MACHT STARK«
Fachliche Grundlage sind aktuelle Erkenntnisse der gefühl und Selbstbewusstsein werden zur Basis
Lehr- und Lernforschung sowie klassische Ansätze für Handlungsmotivation und Leistungsvermögen.
der Mathematikdidaktik. Anknüpfend an die Moti- Mit dem optisch attraktiven Material und einem in
vationsforschung werden Lern- und Leistungssitu- weiten Teilen selbstgesteuerten Lernen wird den
ation entkoppelt, um ein positives Leistungsverständ- Schülern zugleich Wertschätzung entgegengebracht
nis aufzubauen. Die Schüler werden so zu aktiven und Eigenverantwortung eingefordert. Letzteres
Lernern: Für sie stehen der Erkenntnisgewinn beim symbolisiert die Metapher der »Bergbesteigung«,
Testen unterschiedlicher Lösungswege und das Hin- die sich als roter Faden durch das Materialkompen-
terfragen eigener Vorstellungen im Vordergrund. So dium zieht und nicht zuletzt auch dafür steht, dass
lernen sie, Mathematik als Werkzeug zum Problem- sich Leistung lohnt.
lösen zu nutzen.
In Schleswig-Holstein ist »Mathe macht stark« inzwi-
Den Lehrern erleichtern themenbezogene Arbeits- schen dank der Unterstützung des Instituts für Qua-
materialien auf drei Niveaustufen und mit unter- litätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holsteins
schiedlichen Lernzugängen die Arbeit. Gegliedert (IQSH) in über 160 Schulen angekommen und stößt
nach sieben Themenbereichen und aufgeteilt in bis bei Lehrern wie Schülern als praktikables, niedrig-
zu 13 Unterabschnitte formen sie ein umfangreiches schwelliges Angebot auf hohe Akzeptanz. Das Land
Paket: unterstützt das Förderprojekt durch zusätzliche
Unterrichtsstunden und Fortbildungen, und die Eva-
– Der Schülerordner umfasst Aufgaben zu den Themen- luation der ersten Kohorte 2009 / 10 mit 2.000 Teil-
bereichen »Brüche«, »Ganze Zahlen«, »Prozente«, nehmern belegte, dass »Mathe macht stark«-Schüler
»Flächen und Körper«, »Messen«, »Zuordnungen wieder in die Leistungsmitte der Klassen aufsteigen
und Daten« sowie zwei themenübergreifende Auf- und erfolgreich am Regelunterricht teilnehmen können.
gabenpakete zum Rechentraining und zum Rech-
nen im Alltag. Das Pilotprojekt in Frankfurt am Main
In Frankfurt unterstützt die Stiftung Polytechnische
– Den handlungsorientierten Erwerb mathematischer Gesellschaft seit 2012 den Auf- und Ausbau von
Grundvorstellungen erleichtert die Materialkiste. »Mathe macht stark«. Im Jahr zuvor war das Förder-
Sie enthält Hilfsmittel für Experimente (siehe Seite konzept mit dem von der Stiftung ausgelobten Poly-
12), die abstrakte Begriffe und Prozesse konkret technik-Preis für die Didaktik der Mathematik, Infor-
veranschaulichen. matik, Naturwissenschaften und Technik ausge-
zeichnet worden. Dass die preisgekrönten Angebote
– Speziell für die Lehrkräfte bietet der Lehrerordner anschließend in die Praxis der Schulen transferiert
didaktische Kommentare, Lösungsbögen und dia- werden, um ihre Wirkung auch bei Kindern in und
gnostische Tests. um Frankfurt zu entfalten, gehört zum Konzept des
Preises. Daher wurde gemeinsam mit dem Amt für
Auf dieser Basis lässt sich das Unterrichtsmaterial Lehrerbildung (seit 1. Januar 2013 Landesschulamt
individuell für jeden Schüler zusammenstellen, und Lehrkräfteakademie) und dem Staatlichen Schul-
immer angepasst an dessen momentanen Lern- amt Frankfurt am Main ein Pilotprojekt ausgeschrie-
stand und abgestimmt auf seine spezifische kogni- ben, um das sich Schulen bewerben konnten.
tive und motivationale Ausgangssituation. Dabei
hilft dem Lehrer eine differenzierte Diagnostik. Insgesamt wurden sieben Schulen ausgewählt, das
Häufiges Feedback hilft beim Erkennen der Lern- Konzept ab dem Schuljahr 2012 / 13 für zwei Jahre
fortschritte und bei der Gestaltung des individu- zu erproben und bei Erfolg fest in ihr Mathematik-
ellen Lernprozesses. Der sich mit der Zeit füllende Curriculum zu implementieren. Alle Schulformen –
Schülerordner führt jedem Teilnehmer immer wie- Hauptschule, Realschule, Gesamtschule und Gym-
der die eigenen Erkenntnisfortschritte vor Augen. nasium – waren vertreten, rund 160 Schüler konnten
So umgeht »Mathe macht stark« die Gefahr der angesprochen werden. Je nach schulspezifischen
Überforderung, die im Regelunterricht zum Hemm- Bedingungen fand der Förderunterricht meist ein-
nis werden kann. Für den Schüler bleibt das Gefühl bis zweimal pro Woche für mindestens 45 Minuten
des Abgehängtseins aus – stattdessen wird die Selbst- im Klassen- oder Projektraum statt. Die Gruppen
wirksamkeitsüberzeugung gestärkt und Selbstwert- bestanden aus bis zu 15 Schülern. An der Anne-7 VORSTELLUNG »MATHE MACHT STARK«
Einsatz des Geobretts im »Mathe macht stark«-Unterricht
Frank-Schule wurde das Förderkonzept auch im Klas- » DIE PILOTSCHULEN «
senverband erprobt. Insgesamt nahmen etwa 50 Pro-
zent mehr Mädchen als Jungen an dem Förder- – Anne-Frank-Schule (Realschule, Frankfurt-
unterricht teil. Dornbusch)
– Friedrich-Ebert-Schule (Integrierte Gesamt-
Die Schulen verpflichteten sich, »Mathe macht stark« und Ganztagsschule, Frankfurt-Seckbach)
in mindestens zwei Lerngruppen über den gesam- – Heinrich-von-Kleist-Schule (Kooperative
ten Förderzeitraum umzusetzen und dazu ein Team Gesamtschule, Eschborn)
aus Mathematik-Lehrkräften sowie einen schulinter- – Hostatoschule (Grund- und Hauptschule,
nen Koordinator zu benennen. Zur Unterstützung Frankfurt-Höchst)
wurden den beteiligten Lehrern Lernmaterialien – IGS Herder (Integrierte Gesamtschule,
finanziert sowie Fortbildungen und Austauschtref- Frankfurt-Ostend)
fen im Netzwerk der Pilotschulen angeboten. Im – Kaiserin-Friedrich-Gymnasium (Gymnasium,
Gegenzug verpflichteten sie sich, die erzielten Ergeb- Bad Homburg)
nisse zusammenzufassen und ihre Erkenntnisse und – Wöhlerschule (Gymnasium, Frankfurt-Dornbusch)
Erfahrungen an interessierte Schulen weiterzugeben.
Begleitet sowie fachlich und fachdidaktisch bera-
ten wurden sie dabei von einem Projektkoordinator » DAS TEAM «
und drei erfahrenen Ausbildern der Studiensemi-
nare Frankfurt und Oberursel. – Projektkoordinator Christoph Maitzen
– Ausbilder Katharina Schenk, Richard Menzel
Stephan M. Hübner ist Bereichsleiter, Miriam Mandryk und Uwe Steeger
PR-Assistentin in der Abteilung Information und Kommunikation
der Stiftung Polytechnische Gesellschaft.8 FORSCHENDES LERNEN IN KINDERGARTEN UND MATHE MACHT STARK
GRUNDSCHULE
» Es haben sich bei den allermeisten Schülern positive Effekte
gezeigt! Das Selbstvertrauen in Bezug auf die mathemati-
schen Fähigkeiten steigt, vor allem die mündliche Mitarbeit
im Mathematikunterricht, aber auch die schriftlichen Leis-
tungen haben sich deutlich verbessert! «
Katharina Schenk ist Lehrerin für Mathematik
an der Friedrich-Ebert-Schule und Betreuerin im
Projekt »Mathe macht stark«.9 ERGEBNISSE UND ERFAHRUNGEN
ERGEBNISSE UND
ERFAHRUNGEN
Das lehrt uns die Praxis
Sieben Schulen verschiedener Schulformen haben allen Schulen fest, dass nahezu alle teilnehmenden
sich für zwei Jahre auf den Weg begeben, das För- Schüler wieder einen Zugang zur Mathematik gefun-
derkonzept »Mathe macht stark« (MMS) zu erproben den hatten. Sie waren motiviert, am Förderunterricht
und Gelingensbedingungen für eine erfolgreiche und teilzunehmen, erlangten ein größeres Vertrauen in
langfristige Implementierung an ihrer Schule zu iden- die eigenen mathematischen Fähigkeiten und ge-
tifizieren. Ist es möglich, Schülern die Angst vor dem wannen nachweislich an Selbstwertgefühl. Diese Ver-
Fach Mathematik zu nehmen? Kann durch das För- änderung führte direkt zu einer stärkeren mündlichen
derkonzept ihr mathematisches Grundverständnis Beteiligung im regulären Mathematikunterricht.
soweit gestärkt werden, dass die Schüler, die den Nach spätestens eineinhalb Jahren war bei einem
Anschluss in Mathematik verloren haben, dem regu- Großteil der Schüler auch eine Leistungsverbesse-
lären Mathematikunterricht wieder folgen können, rung zu beobachten, die sich in den schriftlichen
sich aktiv einbringen und erfolgreich beteiligen? Wie Arbeiten und in der Schulnote widerspiegelte. Dass
lässt sich »Mathe macht stark«, unter Berücksichti- diese Leistungssteigerung einen erheblichen Zeit-
gung der unterschiedlichen unterrichtlichen und raum in Anspruch nimmt, ist leicht nachvollziehbar.
Die Schüler müssen im ersten Schritt wieder eine
»Wichtig war es, alle Beteiligten positive Einstellung zur Mathematik bekommen.
Danach sind sie bereit und in der Lage, ihre oftmals
über die Ziele des Konzeptes und
weitreichenden Defizite aufzuarbeiten. Die fachliche
die sich daraus ergebenden Auf- Aufarbeitung der Grundlagen beansprucht Zeit, bis
gaben zu informieren.« der Anschluss an den regulären Mathematikunter-
richt für die Schüler wiederhergestellt ist.
Katharina Schenk, Betreuerin
Das »Mathe machst stark« -Unterrichtskonzept
organisatorischen Rahmenbedingungen, stabil in die Die positive Entwicklung der Schüler ist unter ande-
Unterrichtsorganisation einbauen? Die Pilotschulen rem darauf zurückzuführen, dass in kleinen Gruppen
haben ihre Ergebnisse für jedes Schulhalbjahr doku- gearbeitet wurde und den Schülern individuelle Zu-
mentiert und die gewonnenen Erfahrungen in die gänge aufgezeigt wurden. In dieser Konstellation
weitere Umsetzung von »Mathe macht stark« ein- konnte rasch eine vertrauensvolle sowie tragfähige
fließen lassen. Die Erkenntnisse aus der zweijährigen Beziehung zwischen Schülern und Lehrenden auf-
Pilotphase lassen sich wie folgt zusammenfassen: gebaut werden. Das lernwirksam gestaltete und hoch-
wertige Material verschaffte den Schülern Erfolgser-
Wirkung bei den Schülern lebnisse, die ihnen im Regelunterricht versagt blieben.
Zu Beginn waren alle teilnehmenden Schüler durch Die Arbeitshefte in jeweils drei Schwierigkeitsstufen
ihre bisherigen Erfahrungen im Mathematikunter- und das Arbeiten mit der Materialkiste bieten unter-
richt verunsichert oder sogar verängstigt. Im Laufe schiedliche Lernzugänge zu den einzelnen mathe-
des ersten Projekthalbjahres – oftmals schon nach matischen Themen. Diese Zugänge erlauben den
wenigen Förderstunden – stellten die Lehrkräfte an Schülern eine zweite Begegnung mit einem ihnen10 ERGEBNISSE UND ERFAHRUNGEN
bekannten Thema, bei dem sie noch Schwierigkeiten mathematischen Grundlagen als entlastend empfun-
hatten. Durch das haptische Arbeiten eigneten sich den und neue Zusammenhänge zwischen fachlichen
die Schüler anschauliche Rechenverfahren und Inhalten entdeckt. Generell sollte so früh wie mög-
-methoden mit dem Ziel an, eine tragfähige Grund- lich mit der Fördermaßnahme begonnen werden,
vorstellung auszubilden. Sind die Verfahren und um Lücken frühzeitig zu schließen.
Methoden verstanden, können auf der symbolischen
Ebene die konkreten Rechenverfahren mit oder ohne »Mathe macht stark« wurde in den teilnehmenden
haptische Hilfen (z. B. Hunderterfeld, Geobrett) Schulen ganz unterschiedlich umgesetzt. Die schul-
durchgeführt werden. Diese Hilfen ermöglichen den formspezifischen Bedingungen steckten dabei den
Schülern jederzeit auf ein ihnen vertrautes und ver- Rahmen ab. An der Anne-Frank-Schule, einer Real-
standenes Verfahren zurückzugreifen und geben schule, wurde eine ganze achte Klasse ausgewählt,
ihnen so mehr Sicherheit. in der nahezu alle Schüler Schwächen in Mathematik
in verschieden stark ausgeprägter Form aufwiesen.
»Die Schüler fühlen sich durch das Neue Themen wurden immer gemeinsam begonnen.
Die Schüler arbeiteten dann einzeln oder in Partner-
Material wertgeschätzt und sie ge- schaften, die bei großen Fortschrittsunterschieden
nießen die zusätzliche intensive aus einem schwachen und einem starken Schüler
Zeit mit der Mathelehrerin.« bestanden. Zeichneten sich bei vielen Schülern
Schwierigkeiten im Verständnis ab, so erfolgte Fron-
Katharina Schenk, Betreuerin talunterricht oder die Erarbeitung des Themas im
Rahmen von Unterrichtsgesprächen. Die Lehrkraft
Auswirkungen auf den regulären Mathematik- überprüfte kontinuierlich den individuellen Lernfort-
unterricht schritt. So fand ein qualifizierter, binnendifferen-
Die Schüler, die in den Fördergruppen ihr Basis- zierter Unterricht statt. Trotzdem stellte die Hetero-
wissen festigen und ihr Selbstvertrauen stärken genität der Schüler eine Herausforderung dar.
konnten, haben sich im regulären Mathematikunter- Deshalb wurde im zweiten Jahr eine kleine Förder-
richt geöffnet, sich mehr zugetraut und intensiver gruppe, bestehend aus zwölf Schülern aus zwei neun-
mitgearbeitet. Die Lehrkräfte waren davon angetan, ten Klassen, gebildet. Das Arbeiten dieser Gruppe
wie Schüler, die sich vorher anscheinend in Mathe- war auf Grund der größeren Homogenität leichter
matik aufgegeben hatten, zu mehr Aktivität im und auch erfolgreicher.
Unterricht fanden. So waren neben positiven Verän-
derungen auf der motivationalen Ebene auch Leis- An den anderen Schulen wurden kleine Fördergrup-
tungssteigerungen bei den Schülern festzustellen. pen mit sechs bis 15 Schülern gebildet. In der Mit-
Ganz wesentlich für den Erfolg von »Mathe macht telstufe der Gesamtschulen war eine Doppelsteckung
stark« ist die vom Leistungsdruck befreite Lern- möglich, die es erlaubte, dass die Fördergruppe von
atmosphäre in den Fördergruppen. Nicht das Iden- einer Lehrkraft betreut wurde und gleichzeitig in der
tifizieren von Defiziten, sondern das Entdecken von Klasse Unterricht stattfand. Der Förderkurs »Mathe
Stärken steht im Vordergrund. Die Lehrkräfte neh- macht stark« wurde sowohl parallel zum regulären
men gegenüber den Schülern die Rolle eines Lern- (Mathematik-) Unterricht gelegt als auch in der Lern-
begleiters ein und geben konstruktives Feedback. zeit angesiedelt oder als freiwillige Nachmittagsver-
Diese veränderte Rolle der Lehrkraft eröffnet einen anstaltung angeboten. Die praktische Umsetzung
ganz anderen Zugang zu den Schülern und führt zu war aus schulorganisatorischer Sicht nicht immer
einer raschen Stärkung des Selbstkonzeptes. einfach. Da die teilnehmenden Schüler aus verschie-
denen Klassen eines Jahrgangs kamen, gestaltete
Schulformspezifische Umsetzung sich das Finden gemeinsamer Freiräume teilweise
Das Förderkonzept MMS wurde in den Schulen von schwierig. Handelte es sich beim Parallelunterricht
Klasse sechs bis neun erprobt. In allen Klassenstu- nicht um Mathematik sondern um ein anderes Fach,
fen haben die Schüler von MMS profitiert. Eine dif- so kam es vor, dass die Förderschüler bei Klassen-
ferenzierte Betrachtung nach Schulformen zeigt, dass arbeiten oder besonderen Lernanlässen nicht an
die Aufgaben von den Schülern an den Gymnasien, »Mathe macht stark« teilnehmen konnten.
vornehmlich in den Klassen sieben und acht, als zu
leicht wahrgenommen wurden. Gleichzeitig haben An den beiden Gymnasien wurde »Mathe macht
sie die Zeit und den Raum für die Wiederholung der stark« außerhalb des normalen Stundenplans ange-11 ERGEBNISSE UND ERFAHRUNGEN
» Ich bin fest davon überzeugt, dass allein die veränderte
Sichtweise der Schüler auf das Fach langfristig zu einer
Verbesserung der Leistungen führen muss. Voraussetzung ist
eine kontinuierliche Anwendung des Konzepts. «
Ralf Nürnberger ist Lehrer für
Mathematik an der Anne-Frank-Schule.12 MATHE MACHT STARK
16
14
15
12
08
11
13
10
07
07
07
07
09
06
17
05
03
01
04
02
»Mathe macht 01 Geobrett und Gummibänder zur 07 Mehrsystemblöcke zur Einsicht in 13 Hundertertafel zur Orientierung im
stark« - Unter- Darstellung von Brüchen u. a. das Zehnersystem (Stellenwerte) Hunderterraum
richtsmaterialien
02 Winkelscheibe zum Darstellen und 14 Folien mit Zentimeterraster und
(Auswahl) 08 10-flächige Würfel zur Durchführung
Ablesen von Winkeln Folienkreuz zur Flächeninhaltsbe-
von Zufallsversuchen
stimmung
03 Steckwürfel zur Unterstützung bei
09 Ziffernkarten zur Zahlendarstellung
Addition und Subtraktion und zur 15 Register und Inhalte des Schülerordners
Darstellung von Brüchen 10 Thermometer zur Darstellung und mit themenspezifischen Lernausgangs-
zum Ablesen von ganzen Zahlen tests und Einstiegsaufgaben
04 Kreisel (beschreibbar) zur Durchfüh-
rung von Zufallsversuchen 11 Spielwürfel zur Durchführung von 16 Spielgeld zur Unterstützung von
Zufallsversuchen kontextgebundenen Aufgaben
05 Wendeplättchen zur Unterstützung
bei Addition und Subtraktion 12 Themenheft »Prozente». Aufgaben- 17 Winkellehre mit beweglichen
angebote mit steigendem Anforde- Schenkeln zum Abbilden, Einstellen
06 Holzwürfel zur Schulung der Raum-
rungsniveau und Schätzen von Winkelgrößen
vorstellung13 ERGEBNISSE UND ERFAHRUNGEN
» Die veränderte Herangehensweise bei ›Mathe macht stark‹,
mit weniger Druck, spielerischer und anschaulicher als im
täglichen Unterricht zu arbeiten sowie das Abholen der Schüler
von ihren Leistungsniveaus tragen zu einer anderen, posi-
tiveren Sicht auf das Fach bei. «
Ralf Nürnberger, Lehrer
boten. Die freie Lernzeit war zumeist in der siebten Lehrerfortbildungen und Austausch
oder achten Stunde angesiedelt. An der Wöhlerschule Die Lehrkräfte wurden in begleitenden Fortbildungen
gibt es einen Matheraum, der für alle Schüler zugäng- mit den Elementen des Förderkonzepts vertraut ge-
lich ist. Einmal in der Woche wurden die MMS-Schüler macht. Dabei ging es nicht alleine darum, die viel-
dort von einer Lehrkraft für eine Stunde intensiv schichtigen Lernmaterialien kennenzulernen, sondern
betreut. Am Kaiserin-Friedrich-Gymnasium stand auch darum, die anspruchsvolle Rolle des Lehren-
den – auch als Lernbegleiter – zu verstehen. Durch
»Das Konzept sollte hessenweit Stärkenorientierung und systematische Fehlerarbeit
obligatorisch eingeführt werden.« sollte im Unterricht ein positives Leistungsverständ-
nis gepflegt werden. Den teilnehmenden Lehrkräften
Ralf Nürnberger, Lehrer wurde vermittelt, dass ein konstruktives Feedback
zur Steigerung der Unterrichtsqualität beiträgt. Da-
hingegen ein freies Klassenzimmer zur Verfügung. rüber hinaus wurde in einer weiteren Fortbildung
Die Teilnahme an »Mathe macht stark« bedeutete eine differenzierte Diagnostik vorgestellt, um das
für die Schüler eine höhere Präsenzzeit in der Schule. Angebot des Lehrmaterials möglichst genau auf den
Von wenigen Ausnahmen abgesehen, wurde das jeweiligen Kompetenzstand des Schülers abstimmen
Angebot durchgehend gerne wahrgenommen. zu können. Den über die Fortbildung hinausge-
henden, regelmäßig organisierten und schulform-
Einbindung der Eltern überfreifenden Austausch beurteilten die Lehrkräfte
An allen Schulen wurden den Eltern das Konzept und als sehr gewinnbringend.
die Zielsetzung ausführlich vorgestellt. Dadurch
konnte eine hohe Akzeptanz und Unterstützung Dr. Wolfgang Eimer ist Bereichsleiter der Abteilung Wissen-
erreicht werden. Die Information der Eltern erfolgte schaft und Technik der Stiftung Polytechnische Gesellschaft.
auf Elternabenden, in Form von Elternschreiben, in Christoph Maitzen ist Koordinator des Projekts »Mathe macht
Einzelgesprächen oder im Rahmen der halbjährlichen stark«.
Zeugnisgespräche. Dabei war es wichtig zu verdeut-
lichen, dass die positiven Auswirkungen des »Mathe
macht stark«-Unterrichtes nicht direkt bei der fol-
genden Mathearbeit zu erwarten sind, sondern dass
es sich um einen längerfristigen Aufbauprozess
handelt.14 EMPFEHLUNGEN
EMPFEHLUNGEN
Was bei der Umsetzung bedacht werden sollte
»Mathe macht stark« ist als Dauerkonzept für leistungsschwache Schüler sehr gut geeignet, um die beson-
deren Lücken in ihrem mathematischen Grundverständnis zu füllen. Das Material kann von Klasse sechs
bis acht in der Haupt- und Realschule sowie bis Mitte der siebten Klasse im Gymnasium eingesetzt werden.
Insgesamt gilt, dass so früh wie möglich mit der Förderung begonnen werden sollte. Für eine erfolgreiche
Implementierung von »Mathe macht stark« können aus dem Pilotprojekt folgende Empfehlungen abge-
leitet werden:
1. Angemessene zeitliche, räumliche und perso- liche Diagnose, eine zeitnahe Rückmeldung zu den
nelle Ressourcen zur Verfügung stellen, Lernfortschritten und eine schnelle Unterstützung
damit »Mathe macht stark« seine volle Wirkung ent- bei Schwierigkeiten benötigt.
falten kann. Das Förderkonzept sollte mindestens im
Umfang von einer Unterrichtsstunde pro Woche 4. Die Schüler gezielt auswählen,
angeboten werden. Um eine langfristige Leistungs- um die motivierten und leistungswilligen Lerner zu
verbesserung bei den Schülern zu erreichen, wird erreichen.
ein Förderzeitraum von mindestens zwei Jahren
benötigt. Separate, lernfördernde Räume müssen 5. Die Eltern über die Zielsetzung von »Mathe
zur Verfügung stehen. Da die Förderung nur einen macht stark« umfangreich informieren,
Teil einer Klasse bzw. einer Jahrgangsstufe betrifft, um ihre langfristige Unterstützung bei der Förder-
ist eine ausreichende personelle Ausstattung mit maßnahme zu erhalten. Eltern sollten verstehen, dass
Mathematikfachlehrkräften unerlässlich. Dazu kann kurzfristig sowohl eine Verbesserung der Motivation
unter anderem ein Kontingent aus dem Sozialindex als auch der Einstellung zur Mathematik erzielt wer-
herangezogen werden. den können. Eine messbare Leistungsverbesserung
in Form von Noten kann erst im zweiten Schritt er-
2. Alle beteiligten Lehrkräfte in »Mathe macht wartet werden. Die Schüler benötigen hierfür eine
stark« fortbilden, längerfristige Unterstützung.
um das Förderkonzept sicher und zielführend um-
setzen zu können. Die Lehrkräfte müssen mit dem 6. Das Konzept »Mathe macht stark« im Schul-
vielfältigen Lernmaterial vertraut gemacht werden. curriculum verankern,
Darüber hinaus ist sowohl ihre diagnostische Kom- um unter allen Beteiligten ein gemeinsames Ver-
petenz zu stärken als auch ihr Repertoire, konstruktive ständnis vom Konzept und der Zielsetzung zu errei-
lernwirksame Rückmeldungen zu geben, zu erweitern. chen. Die Einführung und die dauerhafte Verankerung
des Förderangebots in der Schule muss von der
3. Lerngruppen mit maximal acht Schülern ein- Schulleitung, den betroffenen Lehrkräften, den Schü-
richten, lern sowie deren Eltern getragen werden.
damit eine individuelle Begleitung und Förderung
möglich ist. Die Schüler müssen die Möglichkeit Dr. Wolfgang Eimer ist Bereichsleiter der Abteilung Wissen-
haben, entsprechend ihrem Leistungsvermögen ihre schaft und Technik der Stiftung Polytechnische Gesellschaft.
Defizite in mathematischen Grundvorstellungen indi- Christoph Maitzen ist Koordinator des Projekts »Mathe macht
viduell aufzuarbeiten. Hierzu wird eine kontinuier- stark«.15 DIE STIFTUNG AUF EINEN BLICK
DER POLYTECHNIK-PREIS
Mit dem Polytechnik-Preis für die Didaktik der
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und
Technik würdigt die Stiftung Polytechnische Gesell-
schaft herausragende Konzepte zur Vermittlung
mathematischer, naturwissenschaftlicher und tech-
nischer Grundlagen in der Schule und im Kinder-
garten. Der Preis unter Schirmherrschaft der Bundes-
ministerin für Bildung und Forschung, Prof. Dr.
Johanna Wanka, ist mit insgesamt 70.000 Euro dotiert
und wurde 2013 zum zweiten Mal vergeben. Ausge-
zeichnet werden Wissenschaftler für ein konkretes,
bereits in Bildungseinrichtungen erprobtes Konzept,
das neuartige und interessenfördernde Lernange-
bote liefert.
www.polytechnik-preis.de
Für das Konzept »Mathe macht stark« wurde Prof. Dr. Aiso Heinze (Dritter von links)
mit dem zweiten Preis des Polytechnik-Preises 2011 ausgezeichnet.
DIE STIFTUNG AUF EINEN BLICK
Eine »Werkbank« für die Frankfurter Stadtgesellschaft – das ist die
Stiftung Polytechnische Gesellschaft. 2005 wurde sie mit einem Kapi-
tal von 397 Millionen Euro von der Polytechnischen Gesellschaft e. V.
errichtet. Heute machen 18 sogenannte Leitprojekte den Kern ihrer
Arbeit aus.
Die Projekte sind Kristallisationspunkte drängender gesellschaftlicher
Aufgaben und verteilen sich auf folgende Arbeitsschwerpunkte: Fami-
lienbildung und Prävention, Sprachbildung, kulturelle Bildung, Hin-
führung zu Naturwissenschaft und Technik sowie Förderung des Bür-
gerengagements.
Immer steht dabei die Schulung der vielfältigen Fähigkeiten des Men-
schen im Mittelpunkt, die Förderung seiner fachlichen und persön-
lichen Bildung zum Nutzen des Gemeinwesens – genau wie es der
Begriff »polytechnisch« seit dem Zeitalter der Aufklärung ausdrückt.
Das Polytechniker-Haus in der Untermainanlage
ist das Domizil der Stiftung im Herzen Frankfurts.
Impressum Herausgeber: Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main, Untermainanlage 5, 60329 Frankfurt am Main, Telefon: 069 - 789 889 - 0,
E-Mail: info@sptg.de, www.sptg.de · Redaktion: Dr. Wolfgang Eimer, Stephan M. Hübner, Christoph Maitzen, Miriam Mandryk · Gestaltung: Büro Schramm
für Gestaltung, bueroschramm.de · Bildbearbeitung: Felix Scheu photo retouch · Bildnachweise: Dominik Buschardt (15 oben), Stephan Feder (15 unten),
Jérôme Gravenstein (3), Jürgen Lecher (7), Sebastian Schramm (Titelbild, 5, 8, 11, 12) · © Oktober 2014 · Aus Gründen der besseren Lesbarkeit schließt
die männliche Form die weibliche Form im vorliegenden Heft mit ein.Der Polytechnik-Preis ist ein Projekt der Untermainanlage 5 D - 60329 Frankfurt am Main Telefon 069 - 78 98 89 - 0 www.sptg.de
Sie können auch lesen