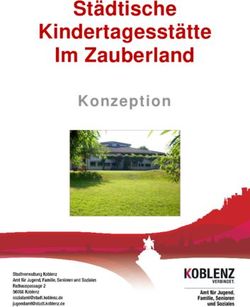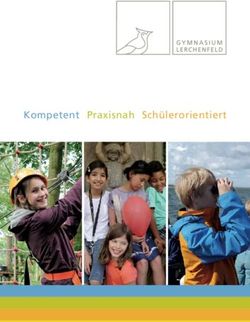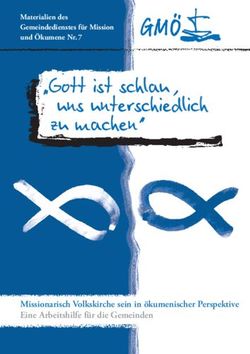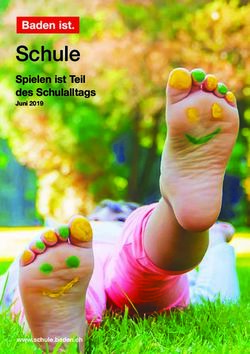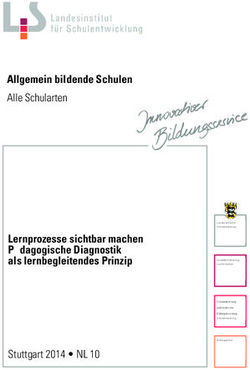Mehr interprofessionelle Zusammenarbeit an außerschulischen Lernorten wagen!
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
– Originalbeitrag –
Mehr interprofessionelle Zusammenarbeit
an außerschulischen Lernorten wagen!
Effekte eines Kooperationsprojekts für Biologie-Lehramtsstudierende
und angehende Landwirtschaftsmeister/innen auf Überzeugungen
und Werthaltungen im Kontext professioneller Kompetenz
Frank Rösch
Pädagogische Hochschule Ludwigsburg,
Institut für Biologie
ZUSAMMENFASSUNG
Außerschulisches Lernen wird nicht nur als sinnvolle Bereicherung, sondern auch als wesentliche Ergänzung von Biologieun-
terricht in Fachräumen oder Klassenzimmern angesehen. Kompetenzförderlich gestaltet und auch die Entwicklung von Ein-
stellungen und motivationalen Orientierungen von Lernenden in positiver Weise unterstützend, handelt es sich dabei um ein
wertvolles Qualitätsmerkmal guten Biologieunterrichts. Gerade an didaktisch-methodisch nicht aufbereiteten Lernorten kann
eine intensive Kooperation zwischen Biologielehrkräften und außerschulischen Berufsgruppen wertvolle Synergien schaffen:
Angesichts ihrer unterschiedlichen Expertisen können die Kooperationspartner/innen einander dabei ergänzen und unterstüt-
zen. Innovativen außerschulischen Unterricht bzw. zielgruppenspezifisch optimierte Öffentlichkeitsarbeit zu gestalten, sollte
Lehrkräften bzw. außerschulischen Fachleuten ein wichtiges Anliegen sein. Auf beiden Seiten erfordert dies nicht nur (fach)di-
daktisch-methodische und pädagogische Kompetenzen sowie domänenspezifisches und ortsbezogenes Wissen, sondern auch
die Bereitschaft, außerschulischen Unterricht miteinander zu verwirklichen.
Im kooperativen Ausbildungsprojekt „Landwirtschaft macht Schule“ wirken Biologie-Lehramtsstudierende und Jungland-
wirt/inn/e/n bei der Unterrichtsgestaltung in hohem Maß und über einen längeren Zeitraum zusammen: Gemeinsam entwickeln
sie nicht nur Lernstationen für eine Bauernhof-Erkundung, sondern entwerfen dafür auch eine angemessene Vor- und Nachbe-
reitung für den Biologieunterricht an der Schule. In einer quasiexperimentellen Interventionsstudie wurde der Einfluss der
hierbei von den teilnehmenden Lehramtsstudierenden (n = 20) gesammelten Erfahrungen sowohl auf deren fähigkeitsbezoge-
nen Überzeugungen hinsichtlich der Gestaltung außerschulischer Lernumgebungen als auch auf subjektive Einstellungen zur
interprofessionellen Zusammenarbeit mit angehenden Landwirtschaftsmeister/inne/n untersucht. Auf Seiten der teilnehmenden
Lehramtsstudierenden wurden fähigkeitsbezogene Überzeugungen zur Gestaltung außerschulischer Lernumgebungen und die
persönliche Bedeutung interprofessioneller Zusammenarbeit hypothesenkonform positiv beeinflusst. Darüber hinaus wurde
das Ausbildungsangebot als äußerst lernwirksam und motivierend evaluiert.
Schlüsselwörter: Lehrerbildung, Professionalisierung, professionelle Kompetenz von Lehrkräften, außerschulisches Lernen,
Kooperation, Bewertung, Kontextorientierung
110– Originalbeitrag –
Dare More Interprofessional Cooperation
at Out-of-school Learning Locations!
Effects of a collaboration project for prospective biology teachers
and future agriculture-masters on beliefs
and value committments in the context of professional competence
Frank Rösch
University of Education, Ludwigsburg,
Institute for Biology
ABSTRACT
Out-of-school learning is seen to be not only a meaningful enrichment but also an essential addition of biology education in
laboratories or class rooms at school. When it is appropriate to foster students‘ competencies and also the development of
important attitudes and motivational orientations, it is a valuable quality feature of high-class biology education. Especially at
learning locations, which are originally not didactically and methodically prepared, an intensive cooperation between biology
teachers and experts of extra-school occupational groups can create precious synergies: In view of their different expertises,
the cooperation partners are able to complement and to support eachother. For teachers respectively out-of-school professionals,
it should be an important aim to design and create innovative out-of-school lessons respectively public relations activities which
are geared for specific target groups. On either side, subject- and domain-related, location-specific, (subject-)didactic and me-
thodic, and pedagogic competencies are necessary for this. Additionally, this requires the willingness to prepare and conduct
the out-of-school lessons together.
In the cooperative educational project „Landwirtschaft macht Schule“ (in the sense of „Learning activities in the context of
agriculture“), prospective biology teachers and young agriculturalists work intensively and over a long period together: They
develop with eachother not only exploring and inquiry activities for a learning cycle on a farm, but create also adequate prepa-
ratory and post-processing school lessons. In a quasi-experimental intervention study, we analyzed the influence from the
experiences of the undergraduates (n = 20) both on their competence-related beliefs concerning the creation of out-of-school
learning environments, and on their attitude towards interprofessional cooperation with future agriculture-masters. We found
– according to our hypotheses – that the competence-related beliefs of the participating undergraduates concerning the develo-
pment of out-of-school learning environments and their subjectively perceived relevance of interprofessional cooperation have
been influenced positively by the treatment. Moreover, the participants considered the cooperation project very instructive and
motivating.
Key words: Teacher Education, Professionalisation, Professional Competence of Teachers, Out-of-school-Learning, Coope-
ration, Reasoning, Decision-Making, Contextualisation
111Rösch (2021)
1 Einleitung freuliche Auswirkungen auf die sozial-emotionale Ent-
wicklung von Lernenden berichtet (Amos & Reiss,
1.1 Bedeutung außerschulischen Lernens für den 2012).
Biologieunterricht Vor diesem Hintergrund kommt der Professionalisie-
Angesichts einer Vielzahl von Schnittbereichen zwi- rung von (künftigen) Biologie-Lehrkräften hinsichtlich
schen naturwissenschaftlichen und technologischen einer kompetenten und einsatzfreudigen Verwirkli-
Themen einerseits und gesellschaftlichen, politischen chung außerschulischen Lernens ein hohes Maß an Be-
und ökonomischen Belangen andererseits kommt der deutung zu. Hierzu zählen neben Professionswissen
Auseinandersetzung mit so genannten socio-scientific auch Überzeugungen, Werthaltungen und motivatio-
issues (SSI) im Rahmen problemorientierten und kon- nale Orientierungen, welche die Umsetzung des Biolo-
textbasierten Biologieunterrichts große Bedeutung zu gieunterrichts außerhalb der Schule auch hinsichtlich
(Bögeholz, Hößle, Höttecke & Menthe, 2018; Rafolt, der Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen vor
Kapelari & Kremer, 2019; Sadler, 2011). Eine ange- Ort begünstigen. Entsprechend von Erwartung(s-mal)-
messene Durchdringung komplexer Zusammenhänge Wert-Modellen im Kontext von Lernmotivation bzw.
und Wechselwirkungen wird durch einen mehrperspek- Handlungsregulation (Baumert & Kunter, 2006, Ur-
tivischen, fächerübergreifenden Zugang sowie durch hahne, 2008) ist davon auszugehen, dass eine Förde-
erfahrungs- und reflexionsbasierte Einblicke begünstigt rung des fähigkeitsbezogenen Selbstkonzepts bezüglich
(Fournés, 2008; Kuntze & Ralle, 2020; Paschold, 2015; erfolgreicher eigenständiger Planung und Durchfüh-
Schockemöhle, 2013). Diesbezüglich wird außerschuli- rung außerschulischen Biologieunterrichts (Erwartung)
schem Unterricht neben seiner motivierenden und inte- und positiver Einstellungen bzw. Überzeugungen hin-
resseförderlichen Wirkung (Prokop, Tuncer & Kvas- sichtlich interprofessioneller Kooperation mit außer-
ničák, 2007) ein hohes Bildungspotenzial beigemessen schulischen Bildungspartner/inne/n (Wert) die Wahr-
(Gülpen & Wenning, 2020; Stichmann & Dalhoff, scheinlichkeit erhöht, dass sich (angehende) Lehrkräfte
1996); dies gilt v. a. für jüngere und leistungsschwä- in diesem Bereich weiter intensiv engagieren (Baumert
chere Lernende (Rexer & Birkel, 1986). Außerschuli- & Kunter, 2006; Kunter & Pohlmann, 2015) und ihre
sche Lernorte weisen – gerade auch im Hinblick auf in- Kompetenzen in späteren Berufsphasen ausbauen, was
teressierende Organismen sowie Natur- und Umwelt- der Qualität außerschulischen Biologieunterrichts zu-
phänomene – ein hohes Maß an ökologischer Authenti- träglich ist. In diesem Zusammenhang ist aus biologie-
zität auf. Sie ermöglichen nicht nur die Weiterentwick- didaktischer Perspektive zu fragen, auf welche Weise
lung diverser Kompetenzen in allen Kompetenzberei- man diese Persönlichkeitsmerkmale bereits möglichst
chen des Faches Biologie (KMK, 2005), sondern auch früh in der Ausbildung von Lehrkräften fördern kann.
von Überzeugungen und Einstellungen wie etwa von re- In diesem Feld ist die hier vorgestellte Studie angesie-
gionaler Identität durch situiertes Lernen (Killermann, delt.
Hiering & Starosta, 2016; Lehnert & Köhler, 2012; Im Fokus des dabei untersuchten Kooperationsprojek-
Kuntze & Ralle, 2020; Mayer, 2018; Paschold, 2018; tes steht der außerschulische Lernort ‚Bauernhof‘ (in
Schockemöhle, 2013). Für die Umsetzung außerschuli- Verbindung mit dem Kontext „Nutztierhaltung“). Im
schen Lernens sprechen überdies Argumente aus lern- Folgenden wird daher immer wieder speziell auf diesen
psychologischer Perspektive in Zusammenhang mit be- Lernort sowie die dort arbeitenden Personen als außer-
deutsamen Unterrichtsprinzipien wie Lebensweltbezug, schulische Bildungspartner/innen eingegangen, um
Schüler- und Anwendungsorientierung (Killermann et exemplarisch Grundlegendes anschaulich zu erläutern.
al., 2016), Originalbegegnungen und Primärerfahrun-
gen (Paschold, 2015) sowie Kontextualisierung 1.2 Landwirtschaftliche Betriebe: Lernorte mit be-
(Schmiemann, Linsner, Wenning, Neuhaus & Sand- sonderem Potenzial
mann, 2011), welche die Effektivität der Lehr-Lernpro- Bauernhöfe zählen zu den mit einer gewissen, wenn
zesse positiv beeinflussen können (Bennett, Hogarth & auch moderaten Häufigkeit aufgesuchten (Pohl, 2008)
Lubben, 2003; Bennett, Lubben & Hogarth, 2006; und bei vielen Lernenden beliebten außerschulischen
Rösch, Bleher & Reinke, 2018). Des Weiteren werden Lernorten im Biologieunterricht (DJV et al., 2017;
von längerfristigen außerschulischen Aktivitäten er- Fröhlich, Goldschmidt & Bogner, 2013; Mayer, 2018).
ZDB ● Zeitschrift für Didaktik der Biologie - Biologie Lehren und Lernen 25. Jg. 2021 112
doi: 10.11576/zdb-4054Rösch (2021)
Außerschulisches Lernen auf landwirtschaftlichen Be- mänenspezifische Wissen vieler Lehrpersonen bezüg-
trieben in einem höheren Ausmaß als bisher umzuset- lich mancher außerschulischer Lernorte nicht selten be-
zen, wird in der Gesellschaft mehrheitlich als sinnvoll grenzt (Paschold, 2018; Schmidt, Di Fuccia & Ralle,
angesehen und gefordert (Schwintowski, 2014). Auch 2011), was oft auch auf didaktisch-methodische Kom-
aus fachlicher und fachdidaktischer Perspektive spre- petenzen in Zusammenhang mit außerschulischem Un-
chen zahlreiche Argumente dafür (Diersen, 2014): terrichten zutrifft (Klaes, 2008; Paschold, 2015, 2018)
Diese Betriebe sind wichtige Produktionsstätten, spie- – also einen wichtigen Bereich professioneller Hand-
len aber auch bei der Landschaftspflege eine Rolle. Im lungskompetenz von Biologielehrkräften (Baumert &
Zusammenhang mit Nutztierhaltung, Pflanzenanbau, Kunter, 2006). Dies ist v. a. im Hinblick auf sekundäre,
Stromerzeugung, Stoffeinträgen, Flächennutzung, Ag- also didaktisch-methodisch weder gestaltete noch auf-
rar- und Biotechnologie u. a. können zahlreiche Biolo- bereitete außerschulische Lernorte (Mayer, 2018) be-
gie- und weitere MINT-Themen anwendungsorientiert deutsam, für die Lehrkräfte oftmals unterstützende Hil-
erarbeitet (Mayer, 2018) und zugleich auch Aspekte der fen und Medien vermissen (Paschold, 2015).
Bildung für nachhaltige Entwicklung miteinbezogen Es ist evident, dass sich (künftige) Biologie-Lehrkräfte
werden (Brunner & Künzli David, 2013; Schocke- nicht nur mit der Didaktik und Methodik außerschuli-
möhle, 2013). Zudem sind Einblicke in diverse Arbeits- schen Lernens beschäftigen, sondern auch lernortsbezo-
felder der Berufsorientierung dienlich (Kuntze & Ralle, gene Sachkenntnisse mehrperspektivisch erwerben
2020; Mayer, 2018). Landwirtschaftsbezogene in der müssen, um in diesem Feld (bereits in den ersten beiden
Gesellschaft diskutierte Themenfelder eignen sich unter Ausbildungsphasen) erfolgreich konkrete eigene Erfah-
Einbezug außerschulischen Lernens nicht nur hervorra- rungen sammeln zu können.
gend zur Einübung naturwissenschaftlicher Erkenntnis- Sich nicht oder ungern auf einen außerschulischen
methoden (Mayer, 2018; Pohl, 2008): auch können Kri- Lernort – speziell auf berufliche Stätten – einzulassen,
tisches Denken – bezüglich rationaler und emotional- kann überdies in fehlerhaften Vorstellungen aufgrund
affektiver Komponenten (Rafolt et al., 2019) – sowie mangelnden Bezugs (Paschold, 2018), inadäquat ver-
Bewertungskompetenzen gefördert werden (Bögeholz einfachender Perspektiven oder gar Voreingenommen-
et al., 2018; Brunner & Künzli David, 2013; Rösch et heit (Schockemöhle, 2013; Vees, 2018) von Lehrperso-
al., 2018). nen gegenüber außerschulischen Berufsgruppen be-
Angesichts lückenhaften Vorwissens und nicht ange- gründet sein. Dies spricht dafür, möglichst frühzeitig
messener Vorstellungen bei vielen Lernenden (Brunner Begegnungen und direkte Einblicke zu ermöglichen so-
& Künzli David 2013) bietet sich somit eine lohnens- wie unmittelbar persönliche Bezüge herzustellen.
werte Gelegenheit, die so genannte agricultural literacy
(Fröhlich et al., 2013) zu fördern, wie es in der Bevöl- 1.4 Interprofessionelle Kooperation: Chancen zur
kerung auch mehrheitlich gefordert wird (i.m.a, 2013). Steigerung von Unterrichtsqualität
Eine ausführlichere Betrachtung des Potenzials land- Angesichts des hohen Werts außerschulischen Lernens
wirtschaftlicher Betriebe als qualitativ hochwertige au- u. a. für den Biologieunterricht (vgl. 1.1) dürfte es im
ßerunterrichtliche Lernorte nehmen u. a. Grenz (2020) Sinn von Schulen sein, dass Biologielehrkräfte außer-
und Paschold (2015) vor. schulische Lernorte im Rahmen fächerübergreifender
Ansätze (Kuntze & Ralle, 2020; Pohl, 2008), zwecks
einer spiralcurricularen Elaboration oder sogar für eine
1.3 Hürden hinsichtlich der Verwirklichung außer-
Profilentwicklung wiederholt in ihren Unterricht mit-
schulischen Unterrichts
einbeziehen (Schmidt et al., 2011). Hierfür spricht auch,
Dass außerschulischer Biologieunterricht nur moderat
dass sich unter Umständen erst eine größere Häufigkeit
häufig umgesetzt und dessen Potenzial oft nicht voll
von Aufenthalten an außerschulischen Lernorten mit
ausgeschöpft wird (Pohl, 2008; Wilhelm, Messmer & schülerorientierten Aktivitäten positiv auf nachhaltigen
Rempfler, 2011), resultiert aus einer Reihe von Grün- Wissenserwerb bzw. themenbezogene Interessensge-
den (Kuntze & Ralle, 2020): Viele Lehrkräfte sehen nese auswirkt (Bickel & Bögeholz, 2013; Paschold,
sich neben dem erhöhten Aufwand (Paschold, 2015), 2015; Wilhelm et al., 2011).
entstehenden Kosten u. a. mit organisatorischen und pä- In diesem Zusammenhang stellt die bereits seit Jahr-
dagogischen Hürden konfrontiert (Klaes, 2008). Dar- zehnten angestrebte institutionelle Öffnung von Schu-
über hinaus ist das kontext- und ortsbezogene sowie do- len hinsichtlich der Kooperation mit außerschulischen
ZDB ● Zeitschrift für Didaktik der Biologie - Biologie Lehren und Lernen 25. Jg. 2021 113
doi: 10.11576/zdb-4054Rösch (2021) Abbildung 1. Einbezug der sach- und ortsbezogenen Expertise außerschulischer Fachleute an einer Lernstation in einem Bullenmastbetrieb (Foto: Verfasser, 2020) Personen, Organisationen und Einrichtungen (Killer- rerseits gehen „Erwartungen [an die Landwirtschaft mann et al., 2016; Stichmann & Dalhoff, 1996; hinsichtlich einer verantwortungsvollen Arbeitsweise] Wodzinski, 2014) eine wichtige Zielsetzung dar. Ange- und die durch die Bürger wahrgenommenen Realitäten sichts der Expertise von außerschulischen Fachleuten [z. T.] auseinander“ (i.m.a, 2013). Des Öfteren wurde auf ihrem je eigenen lernortsbezogenen Gebiet (Pohl, und wird Landwirtschaft sowohl in der medialen Öf- 2008) kommt einer intensiven und respektvollen (Gül- fentlichkeit nicht angemessen dargestellt (Brunner & pen & Wenning, 2020), ggf. längerfristigen Zusammen- Künzli David, 2013; dpa, 2017; Vees, 2018; Wess & arbeit mit den Lehrkräften große Bedeutung zu (Rösch, Nellen, 2016) oder in letzter Zeit vermehrt pauschal dis- Reinke, Bleher & Schaal, 2017), wie Abbildung 1 zeigt. kreditiert (Nicht-Roth, 2017), als auch in manchen Un- Dabei handelt es sich um ein Beispiel von so genannter terrichtsmaterialien einseitig oder in anderer, z. T. sug- interprofessioneller Kooperation, also vom Zusammen- gestiver Weise inadäquat präsentiert (Grenz, 2020; z. B. wirken von Angehörigen unterschiedlicher Berufsgrup- im Kontext von Verbraucher- und Ernährungsbildung pen (Dizinger & Böhm-Kasper, 2019). Gegenseitige bei Hascher, Morgenstern, Nonnenmacher, Respondek, Wertschätzung der für eine Zusammenarbeit in Frage Schondelmaier, 2017, S. 57, schriftliche Mitteilung von kommenden Personengruppen und positive Überzeu- Andrea Bleher am 19.04.2021; sowie in Breithack, Eck, gungen bezüglich des (beidseitigen) Nutzens sind eine Ernst, Held, Jäger & Metzger, 2004, S. 188; Geiger & wichtige Grundlage für interprofessionelle Kooperation Paul, 2004, S. 24 f.). Angesichts dessen, dass Biologie- – jedoch nicht selbstverständlich: lehrkräfte immer noch häufig Schulbücher (Berck & So genießt beispielsweise die Berufsgruppe „Land- Graf, 2018; Härtig, Kauertz & Fischer, 2012) und an- wirt/in“ einerseits in weiten Teilen der Bevölkerung ein dere nicht selbst erstellte Medien zur Vorbereitung und recht hohes Ansehen (Benthin, 2020), und der Wunsch Gestaltung von Unterricht heranziehen, ist davon aus- nach größerer Transparenz landwirtschaftlicher Le- zugehen, dass auf diese Weise ein Risiko für die Quali- bensmittel- und Energieerzeugung sowie intensiverer tät von Biologie- und anderem Fachunterricht besteht. Behandlung landwirtschaftlicher Themen in der Schule Jene könnte auch unter einer voreingenommenen Sicht- wird vielfach artikuliert (Schwintowski, 2014). Ande- und Ausdrucksweise von Biologielehrkräften selbst lei- ZDB ● Zeitschrift für Didaktik der Biologie - Biologie Lehren und Lernen 25. Jg. 2021 114 doi: 10.11576/zdb-4054
Rösch (2021) den – z. B. gegenüber Landwirtschaft und den damit be- rufsgruppen möglich ist, Überzeugungen, Werthaltun- trauten Personen und Berufsgruppen (Vees, 2018; Wer- gen und motivationale Orientierungen positiv zu beein- ner-Gnann, 2018). flussen. Dies wäre letztlich eine ideale Ausgangsbedin- Werden allerdings außerschulische Fachleute z. B. bei gung, um Offenheit für weitere Kooperationen in späte- Führungen oder in Interviews mit Lernenden bei der ren Ausbildungsphasen und in der Berufspraxis zu ent- Wissensvermittlung miteinbezogen, können u. U. Män- wickeln und diese dann zu nutzen und weiter auszu- gel in der Expert/inn/en-Laien-Kommunikation be- bauen. obachtet werden (Klaes, 2008; Schmidt et al., 2011), was manche Lehrkräfte angesichts der Überforderung 1.5 Überblick über das Ziel der vorgestellten Studie ihrer Schüler/innen auf Abstand gehen lassen könnte. Die Ausbildung von Biologielehrkräften auf Grundlage Ergo sollte es – im vorgestellten Kontext – sowohl empirischer Erkenntnisse zu optimieren, ist ein erklär- Landwirt/inn/en selbst als auch Lehrkräften ein Anlie- tes Ziel biologiedidaktischer Forschung (Harms & gen sein, ein realistisches und differenziertes Bild von Riese, 2018; Spörhase, 2012). Angesichts dessen, dass moderner Landwirtschaft zu zeichnen (Drossel, 2019; die Zufriedenheit angehender Lehrkräfte, nach Ab- Gießübel, 2020), aufeinander zuzugehen und im Ideal- schluss ihres Studiums befragt, mit der Qualität der an- fall miteinander eine adressatenorientierte Lernumge- wendungs- bzw. praxisbezogenen Studienangebote al- bung inklusive gelingender Expert/inn/en-Laien-Kom- les andere als hoch ist (Statistisches Landesamt Baden- munikation zu gestalten. Lehrkräfte mit begrenzten Württemberg, 2018), besteht Forschungs- und Hand- landwirtschaftsbezogenen Kenntnissen bei gleichzeitig lungsbedarf, die erste Ausbildungsphase zu optimieren ausgeprägten inadäquaten Klischees über das „Was“ sowie entsprechende schulpraxisbezogene, auch aus und „Wie“ in der Landwirtschaft werden jedoch wo- hochschuldidaktischer Perspektive und hinsichtlich der möglich – auch angesichts der o. g. Hinderungsgründe professionsbezogenen Qualifizierung sinnvolle Lehran- (vgl. 1.3) – eher zögern, einen entsprechenden außer- gebote zu konzipieren und zu implementieren. schulischen Lernort in den Biologieunterricht einzubin- Eine Professionalisierung im Hinblick auf die an- den sowie mit Fachleuten aus der Landwirtschaft Kon- spruchsvolle, komplexe und herausfordernde Arbeit als takt aufzunehmen und mit diesen hinsichtlich außer- Biologielehrkraft umfasst zum einen u. a. pädagogi- schulischen Lernangeboten sowie deren unterrichtli- sche, fachliche und biologiedidaktisch-methodische chen Vor- und Nachbereitung (Klaes, 2008; Mayer, Handlungskompetenzen, zum anderen motivationale 2018) eng zusammenzuarbeiten. Komponenten sowie – vermittelt über Überzeugungen Angesichts dessen ist zu klären, wie man für gelingende und Werthaltungen – die Bereitschaft, entsprechende interprofessionelle Kooperation möglichst gute Voraus- Fähigkeiten, Fähigkeiten und Fertigkeiten auch einzu- setzungen schaffen kann. Zusammenarbeit anzubahnen setzen (Baumert & Kunter, 2006). und gegebenenfalls auszubauen sowie aufrechtzuhalten Im Rahmen der hier vorgestellten Interventionsstudie (Gropengießer, 2018), erfordert von allen Beteiligten wird untersucht, ob frühzeitig angebahnte Zusammen- ein hohes Maß an handlungsleitender Bereitschaft arbeit zwischen angehenden Biologielehrkräften in de- (Pohl, 2008). Von Bedeutung sind zudem „eine positive ren ersten Ausbildungsphase und jungen Land- Grundeinstellung zu ihrer jeweiligen Arbeit und die Be- wirt/inn/en eine positive Basis für spätere Kooperatio- reitschaft zur Offenheit und Veränderung […], Kritik- nen legen kann. Im Mittelpunkt stehen dabei zentrale fähigkeit, ausreichende Ressourcen, gemeinsame Ziele, Überzeugungen und Werthaltungen betreffende As- Arbeitsweisen und Regeln, Verbindlichkeit sowie klare pekte der Professionalisierung von Biologielehrkräften: Zuständigkeiten“ (Paschold, 2015, S. 173). zum einen das Konstrukt „persönliche Bedeutung inter- In diesem Kontext stellen sich verschiedene Fragen: professioneller Kooperation“, zum anderen das Kon- welche konzeptionellen Erfahrungen und empirischen strukt „fähigkeitsbezogene Überzeugungen“ im Zusam- Befunde aus der fachdidaktischen Forschung bereits zur menhang mit der Gestaltung außerschulischer Lernum- Förderung interprofessioneller Zusammenarbeit ge- gebungen. sammelt wurden, an welche Zielgruppen in welchen Vor diesem Hintergrund stellt diese Studie einen be- Ausbildungs- bzw. Berufsphasen sich die Angebote deutsamen Beitrag zur biologiedidaktischen Forschung richteten, und ob es schon zu einem frühen Zeitpunkt dar: sie beleuchtet hochschuldidaktische Möglichkei- der professionellen Qualifizierung der beteiligten Be- ten, „die notwendigen Voraussetzungen und Ressour- ZDB ● Zeitschrift für Didaktik der Biologie - Biologie Lehren und Lernen 25. Jg. 2021 115 doi: 10.11576/zdb-4054
Rösch (2021)
cen [positiv zu beeinflussen], die es Lehrkräften ermög- ten der Lehrerprofessionalität (s. u.) erforderlich sind,
lichen, guten Fachunterricht durchzuführen“ (Harms & damit erstgenannte Kompetenzen zielführend für die
Riese, 2018, S. 283). Hierzu zählt in besonderem Maß Steigerung von Unterrichtsqualität überhaupt erst ein-
auch hochwertiger Unterricht an außerschulischen gesetzt werden (Harms & Riese, 2018).
Lernorten (vgl. 1.1). Wird das allgemeine Modell von Baumert und Kunter
(2006) im Rahmen biologiedidaktischer Forschung ge-
2 Theoretischer Hintergrund nutzt, gilt es, dieses aus fachdidaktischer Sicht zu spe-
zifizieren. Gropengießer (2018, S. 215) stellt klar, dass
Um die erforderlichen Ressourcen und Voraussetzun- im Bereich des biologiedidaktischen Professionswis-
gen von Lehrkräften hinsichtlich der Gestaltung quali- sens auch „eine Vielfalt von Unterrichtsmethoden [tan-
tativ hochwertiger fachunterrichtlicher Lernumgebun- giert ist], wie sie in keinem anderen Unterrichtsfach
gen zu systematisieren, wurden in der allgemein- und in vorkommt“ – etwa Freilandarbeit und biologisches Be-
der fachdidaktischen Forschung verschiedene Rahmen- obachten im Gelände und an anderen außerschulischen
modelle postuliert (Baumert & Kunter, 2006; Harms & Lernorten. Dies optimal zu gestalten, erfordert spezifi-
Riese, 2018). Dieser Arbeit liegt das Modell professio- sche fachdidaktische und -methodische Handlungs-
neller Kompetenz von Baumert und Kunter (2006) zu- kompetenzen und auch motivationale Ressourcen, au-
grunde, das auch in der Naturwissenschaftsdidaktik oft ßerschulisches Lernen im Fach Biologie konkret anzu-
zur theoretischen Rahmung und Verortung von Facet- gehen.
ten der Lehrerprofessionalität herangezogen wird Zu den Werthaltungen und Überzeugungen werden u.
(Harms & Riese, 2018): a. „subjektive Theorien über das Lehren und Lernen“
Baumert und Kunter (2006) zufolge umfasst die profes- (Baumert & Kunter, 2006, S. 499) gerechnet. In diesen
sionelle Handlungskompetenz von Lehrkräften neben sind auch Einstellungen hinsichtlich der Bedeutung in-
dem mehrdimensionalen Konstrukt des Professionswis- terprofessioneller Kooperation bei der Planung und Ge-
sens und selbstregulativen Fähigkeiten zum einen Über- staltung außerschulischen Lernens verortet: (Inwiefern)
zeugungen („beliefs“) und Werthaltungen, zum anderen besteht ein Nutzen, mit außerschulischen Fachleuten
motivationale Orientierungen. Für eine interprofessio- zusammenzuarbeiten? Übersteigen der Benefit für die
nelle Kooperation zieldienliche Überzeugungen können Lernenden und die Synergieeffekte auf Seiten der Ko-
z. B. beliefs zu Relevanz und Nutzen einer Zusammen- operationspartner/innen den erhöhten Aufwand (vgl.
arbeit für die Steigerung von Unterrichtsqualität betref- 1.3)? Damit verbundene beliefs generieren eine Wert-
fen. Zu den in diesem Kontext förderlichen Werthaltun- haltung, die bei der Handlungsregulation eine Rolle
gen gehört mit Sicherheit auch gegenseitiges Vertrauen spielt (Kunter & Pohlmann, 2015; Urhahne, 2008). Seit
der miteinander kooperierenden Personen (Paschold, vielen Jahrzehnten besteht in der Biologiedidaktik Kon-
2015). Zu den motivationalen Orientierungen werden u. sens, dass eine positive Einstellung bezüglich interpro-
a. Enthusiasmus und (in früheren Werken) Selbstwirk- fessioneller Kooperation zu den zentralen Bereitschaf-
samkeitserwartungen gezählt (Baumert & Kunter, ten von Biologielehrkräften gehört (Gropengießer,
2006). Welche Bedeutung haben diese Dimensionen 2018).
bzw. Facetten professioneller Kompetenz im Hinblick Einen weiteren für die Nutzung der eigenen professio-
auf interprofessionelle Kooperation? Indem sich posi- nellen Handlungsfähigkeit zentralen Bereich stellen wie
tive Einstellungen, Überzeugungen, Werthaltungen, bereits erwähnt motivationale Orientierungen dar, die
intrinsische Motivation und Selbstwirksamkeitserwar- neben der expliziten Motivation für konkretes (außer-
tungen auf das professionelle Verhalten und konkrete schulisches und kooperatives) unterrichtliches Handeln
unterrichtliche Gestaltungshandeln der Biologielehr- – laut Baumert und Kunter (2006) – auch selbstbezo-
kräfte auswirken (Baumert & Kunter, 2006; Harms & gene Kognitionen wie Selbstwirksamkeitserwartungen
Riese, 2018), beeinflussen sie unter Umständen auch betreffen. Letztere meinen „die Überzeugung einer Per-
mittelbar die Lerneffekte und motivationalen Orientie- son, über die Fähigkeiten und Mittel zu verfügen, um
rungen auf Seiten der Lernenden. In diesem Zusam- diejenigen Handlungen durchführen zu können, die not-
menhang ist evident, dass sowohl kognitive Fähigkeiten wendig sind, um ein definiertes Ziel zu erreichen – und
und Professionswissen als auch Überzeugungen und zwar auch dann, wenn Barrieren zu überwinden sind“
Werthaltungen betreffende sowie motivationale Facet- (ebd., S. 502; s. auch Kunter & Pohlmann, 2015) – etwa
ZDB ● Zeitschrift für Didaktik der Biologie - Biologie Lehren und Lernen 25. Jg. 2021 116
doi: 10.11576/zdb-4054Rösch (2021)
bei der Gestaltung von Lernumgebungen an didaktisch- 3 Stand der Forschung
methodisch nicht aufbereiteten Lernorten. Daraus resul-
tieren begünstigende Effekte auf die Selbstregulation 3.1 Projekte zu interprofessioneller Kooperation an
bei der Vorbereitung und Durchführung von Unterricht außerschulischen Lernorten
(Baumert & Kunter, 2006; Kunter & Pohlmann, 2015). Eine sehr frühzeitige Begegnung von Angehörigen un-
Auch die unter dem Begriff „Selbstkonzept“ subsum- terschiedlicher Berufsgruppen mit dem Ziel, intensives
mierten Wahrnehmungen von sich selbst – etwa hin- Zusammenwirken im Kontext außerschulischen Biolo-
sichtlich kriterienbezogener eigener Ressourcen und gieunterrichts zur Optimierung von Lehr-Lernprozes-
Kompetenzen – wirken sich auf die Qualität des (außer- sen anzubahnen, ist keineswegs selbstverständlich. So
schulischen) Unterrichts aus (Harms & Riese, 2018). könnte man vermuten, dass erst erfahrene Fachleute in
Beide Konstrukte weisen sicherlich auch affektive der Lage wären, effektive Kooperation zu gestalten.
Komponenten auf, sind jedoch eher auf der kognitiven Viele existente Kooperationskonzepte wurden für er-
Ebene anzusiedeln. Kunter und Baumert (2006, S. 497, fahrene Fachleute unterschiedlicher Berufsfelder ent-
501) wiesen bereits darauf hin, dass es sich dabei ergo wickelt – so etwa für schon mitten im Berufsleben ste-
streng genommen um Teilaspekte des Systems subjek- hende Lehrkräfte und Landwirt/inn/e/n (Paschold,
tiver Überzeugungen handele, diese als „selbstbezo- 2015, 2018) oder Lehrkräfte und Förster/innen (Vogl,
gene Kognitionen“ jedoch „üblicherweise im Rahmen Mandl, Meixner & Klatt, 2015). Andere Projekte wie-
von Theorien der Handlungsmotivation untersucht“ derum stellen Lehramtsstudierenden bereits praktizie-
würden und ordneten sie im Modell noch den motivati- rende außerschulische Expert/inn/en zur Seite – etwa
onalen Orientierungen zu – auch angesichts des engen aus der Landwirtschaft (z. B. Bätzel, 2016; Grenz,
Zusammenhangs mit der professionellen Selbstregula- 2020; Zepp, 2016) oder im Rahmen eines Berufsfeld-
tion (ebd.). Manche neuere Beiträge (z. B. Kunter & praktikums Beschäftigte „an außerschulischen bil-
Pohlmann, 2015) jedoch verorten aus den genannten dungsorientierten Einrichtungen“ (Gülpen & Wenning,
Gründen die entsprechenden kognitiv geprägten und 2020, S. 354), wie Schülerlaboren, Museen, Zooschu-
beeinflussten Konstrukte nicht mehr im Bereich der len, Naturschutzzentren. Bei dem von Gülpen und Wen-
motivationalen Orientierungen der Professionalität von ning (2020) vorgestellten Konzept ist zu beachten, dass
Lehrkräften, sondern bei den Überzeugungen und Wert- die außerschulischen Fachleute im Bereich der Wis-
haltungen. Dieser Perspektive folgt auch der vorlie- sensvermittlung bereits zuvor zumindest grundlegende
gende Beitrag (vgl. 4.1). didaktisch-methodische Kompetenzen erworben haben
Verschiedene bundesweit geltende Ausbildungsstan- – ein gewichtiger Unterschied im Vergleich zu den
dards für angehende Lehrkräfte sprechen explizit Kom- meisten anderen außerschulischen interprofessionellen
petenzen und Einstellungen hinsichtlich der Koopera- Kooperationen an didaktisch-methodisch nicht aufbe-
tion mit Berufsgruppen im außerschulischen Bereich an reiteten Lernorten.
(KMK, 2019). Sie führen vor Augen, dass entsprechen- Lude und Vogl (2014) bringen zwar sowohl Biologie-
den Modellen professioneller Kompetenz von Lehrkräf- lehrkräfte als auch Förster/innen in deren ersten Ausbil-
ten nicht nur theoretische Bedeutung zukommt, sondern dungsphase im Rahmen einer Kooperation zusammen –
diese auch normative Funktion besitzen – etwa bei der allerdings ist diese wenig umfangreich und inkludiert
Gestaltung verbindlicher institutioneller Rahmenbedin- nicht eine gemeinsame Konzipierung vor- und nachbe-
gungen, z. B. bei der Ausbildung von Lehrkräften. In reitenden Unterrichts.
diesem Zusammenhang ist es nun Aufgabe fachdidakti- Eine weitere Forschungslücke liegt hinsichtlich der
scher Forschung zu untersuchen, welche Settings in den Analyse von Effekten entsprechender Kooperationen
drei Phasen der Lehrerbildung entsprechende Ressour- auf die Entwicklung von Facetten der professionellen
cen der (angehenden) Biologielehrkräfte positiv zu be- Kompetenz der beteiligten Kooperationspartner/innen
einflussen vermögen. vor: Bislang gibt es im deutschsprachigen Raum nur
wenige empirische Studien in der Biologie- bzw. Hoch-
schuldidaktik, welche systematisch die Wirkungen ei-
ner Intervention in Form eines Lehrangebots für Biolo-
gie-Lehramtsstudierende auf deren Überzeugungen und
Werthaltungen hinsichtlich interprofessioneller Koope-
ZDB ● Zeitschrift für Didaktik der Biologie - Biologie Lehren und Lernen 25. Jg. 2021 117
doi: 10.11576/zdb-4054Rösch (2021)
ration und ihres Selbstkonzepts bezüglich der eigen- trieb steht. Somit handelt es sich um ein Projekt mit be-
ständigen Umsetzung außerschulischen Unterrichts un- sonders umfangreicher interprofessioneller Koopera-
tersuchen. tion, das bereits während der frühen Qualifizierung der
beteiligten Berufsgruppen positive fähigkeitsbezogene
3.2 Effekte interprofessioneller Zusammenarbeit Überzeugungen zur eigenständigen Umsetzung außer-
auf die Kooperationspartner/innen schulischen Unterrichts sowie die nachhaltige Wert-
Interprofessionelle Kooperation stellt im Hinblick auf schätzung künftiger Zusammenarbeit intendiert.
die innovative Weiterentwicklung von (Biologie-)Un- Dabei bringen sich die Projektteilnehmenden beider
terricht nicht nur in der Theorie eine große Bereiche- Berufsgruppen mit ihren während der bisherigen Aus-
rung dar (Stichmann & Dalhoff, 1996; Wodzinski, bildung bereits erworbenen berufsfeldspezifischen
2014): Der subjektiv empfundene Benefit – z. B. hin- Kompetenzen aktiv mit ein und erarbeiten darüber hin-
sichtlich einer sowohl inhaltlichen als auch didaktisch- aus gemeinsam weitere Kenntnisse, Fähigkeiten und
methodischen Optimierung der Gestaltung außerschuli- Fertigkeiten im Hinblick auf die Gestaltung kompetenz-
scher Lernumgebungen und der besseren Einbettung und schülerorientierten sowie zielgruppengemäßen au-
außerschulischen Unterrichts in vor- und nachberei- ßerschulischen Unterrichts (s. Abb. 2). Dabei wird auch
tende Lernmodule bzw. einer verbesserten Öffentlich- die Entwicklung kooperativer und selbstregulatorischer
keitsarbeit – wird in diversen Studien empirisch belegt Kompetenzen angestrebt, was durch das interprofessio-
(u. a. Gülpen & Wenning, 2020; Vogl, Meixner, Mandl, nell zusammengesetzte Projektleitungsteam (Mitarbei-
Dobler & Klatt, 2015). So fand z. B. Paschold (2015, S. tende der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg, der
173), dass seine Intervention mit Lehrkraft-Land- Akademie für Landbau und Hauswirtschaft Kupferzell
wirt/in-Tandems „geeignet war, um die Nutzungshäu- sowie des Bauernverbands Schwäbisch Hall – Hohen-
figkeit, curriculare Integration und methodische Umset- lohe – Rems e. V., Projekt „Klassenzimmer Bauern-
zung außerschulischen Lernens auf landwirtschaftli- hof“) unterstützt wird – diese Variablen werden im
chen Betrieben zu verbessern“. Die Kooperation wirkte Kontext dieser Studie allerdings nicht empirisch unter-
sich zudem positiv auf „eine große Verbindlichkeit, ein sucht.
großes Wissen voneinander und Vertrauen zueinander“ In allen oben aufgeführten Beispielen für interprofessi-
aus (ebd.). onelle Kooperationen an außerschulischen Lernorten
Bestenfalls kann ein kommunales oder gar regionales mit Lehramtsstudierenden als eine der Zielgruppen
Netzwerk von Kooperationen mit weiteren außerschu- (vgl. 3.1) spielt reflexive und theoriefundierte Praxis
lischen Bildungspartner/inne/n durch engagiert Mitwir- (Messner, 2004), die in einem Projektseminar intensiv
kende entwickelt und nachhaltig etabliert werden vor- und nachbereitet wird, eine entscheidende Rolle
(Benthin, 2020; Fournés, 2008; Rösch et al., 2017; (Gülpen & Wenning, 2020; Rösch & Reinke, 2014 b,
Schockemöhle, 2013; Stichmann & Dalhoff, 1996; Wil- Rösch et al., 2018) so auch in unserer Ausbildungsko-
helm et al., 2011). operation.
Drei zentrale tragende Säulen charakterisieren und stüt-
3.3 Die interprofessionelle Ausbildungskooperation zen das Konzept von „Landwirtschaft macht Schule –
„Landwirtschaft macht Schule“ außerschulisches Lernen kooperativ gestalten“ und
Wie Lude und Vogl (2014) mit Lehramtsstudierenden können als unabhängige Variablen im Kontext dieser
und angehenden Förster/inne/n erprobte das Projektlei- Studie betrachtet werden: (a) die Erarbeitung projektre-
tungsteam um den Verfasser dieses Beitrags die Zusam- levanter landwirtschaftsbezogener Inhalte (z. B. Hal-
menarbeit der beteiligten Berufsgruppen bereits wäh- tungsformen, Tierwohl, Anatomie, Entwicklung und
rend deren ersten Ausbildungsphase: Lehramtsstudie- Fütterung, Kreislaufwirtschaft), (b) die Auseinanderset-
rende der Fächer Biologie (und teilweise auch Geogra- zung mit und die Einübung von didaktisch-methodi-
phie) entwickeln im Projekt „Landwirtschaft macht schen und rechtlichen Grundlagen außerschulischen
Schule“ gemeinsam mit angehenden Landwirtschafts- Unterrichtens, dessen Planung, Durchführung und Re-
meister/inne/n eine komplette Unterrichtseinheit (an- flexion sowie (c) eine intensive Zusammenarbeit zwi-
ders als bei Lude & Vogl, 2014), in deren Mittelpunkt schen Lehramtsstudierenden und Junglandwirt/inn/en.
der erkundende Lerngang einer Schulklasse (bislang Dabei diente der hochschuldidaktische Ansatz situier-
der Sekundarstufe I) auf einen landwirtschaftlichen Be- ten Lernens (Fölling-Albers et al., 2005) als Orientie-
ZDB ● Zeitschrift für Didaktik der Biologie - Biologie Lehren und Lernen 25. Jg. 2021 118
doi: 10.11576/zdb-4054Rösch (2021) Abbildung 2. Interprofessionelle Kooperation während der Vorbereitung außerschulischen Unterrichts (Foto: Ver- fasser, 2019) rungsrahmen – mit anfänglich intensiverer instruktiona- evaluiert sowie weiterentwickelt. Andere Beiträge ler Unterstützung und medialem Support, gefolgt von (Reinke & Rösch, 2015; Rösch et al., 2017) berichteten projektartiger Arbeit in gemischten Gruppen aus Stu- bereits über den – im Hinblick auf andere universitäre dierenden sowie Junglandwirt/inn/en, begleitet durch Lehrveranstaltungen – subjektiv als vergleichsweise Dozierende (Didaktik / Methodik, Tierhaltung, Bauern- hoch erlebten Lernfortschritt: dabei schätzen die Be- hof-Pädagogik). Dabei entwickelten die Projektteilneh- fragten den Wert und die Quantität des in der Lehrver- menden eine komplette Unterrichtseinheit für eine anstaltung Gelernten für ihre berufliche Qualifikation Schulklasse und erstellten Lehrerhandreichungen. Sie ein. Die studentischen Projektteilnehmenden gaben ih- betteten eine interaktive schülerorientierte Bauernhof- ren subjektiv erlebten Lernfortschritt am Ende des Se- erkundung mit Lernstationen in passende vor- und minars durchschnittlich mit einem starken Effekt (|d| = nachbereitende Stunden ein. 0.84) höher an (M = 4.50; SD = 0.48) als die Studieren- Ausführlichere Informationen über die beteiligten Insti- den in anderen Lehrveranstaltungen derselben Fakultät tutionen des Projekts „Landwirtschaft macht Schule“ (M = 3.71; SD = 0.94). Da im Rahmen der Lehrevalua- sowie dessen inhaltliche Schwerpunkte, didaktisch-me- tion der subjektiv erlebte Lernfortschritt jedoch nicht thodische Konzeption und den Ablauf werden bei differenziert betrachtet wurde und sich auf unterschied- Reinke und Rösch (2015), Rösch et al. (2018), Rösch et liche Facetten der Lehrerprofessionalität beziehen al. (2017) sowie Rösch und Reinke (2014 a, b) vorge- könnte, erscheint somit eine spezifischere Analyse not- stellt. Die von den Projektteilnehmenden bislang entwi- wendig. Dass dabei auf jeden Fall u. a. auch landwirt- ckelten Lehrerhandreichungen und Materialien finden schaftsbezogenes Domänenwissen erworben werden sich unter: https://www.lob-bw.de/lehrkraefte/lehrer- kann, spricht Paschold (2015) an. handreichungen-kooperationsprojekt-ph-ludwigsburg- und-alh-kupferzell.html (21.09.2021). 3.4 Forschungsdesiderate und Fokus der Studie Das seit 2014 alljährlich im Wintersemester stattfin- Angesichts des aktuellen Forschungsstandes ergibt sich dende und in beiden teilnehmenden Bildungsinstitutio- aus biologiedidaktischer Perspektive der Bedarf, die nen inzwischen curricular verankerte Lehrangebot hat Wirksamkeit interprofessioneller Kooperation auf Ein- bis dato sechs Projektzyklen zu verschiedenen landwirt- stellungen hinsichtlich der Zusammenarbeit und auf fä- schaftlichen Produktionsschwerpunkten im Kontext higkeitsbezogene Überzeugungen bereits in der ersten „Nutztierhaltung“ durchlaufen und wird, ganz im Sinne Ausbildungsphase zu untersuchen. Dies erscheint auch von Design-based Research-Prinzipien (Anderson & vor dem Hintergrund sinnvoll, dass die Ausbildungs- Shattuck, 2012), fortlaufend formativ und summativ phasen für Lehrkräfte im Sinne einer kumulativen Ent- ZDB ● Zeitschrift für Didaktik der Biologie - Biologie Lehren und Lernen 25. Jg. 2021 119 doi: 10.11576/zdb-4054
Rösch (2021)
wicklung der professionellen Kompetenz besser aufei- empfinden würden – im Vergleich zu Teilnehmenden
nander bezogen werden sollten (Messmer, 2004). Zu- eines als Kontrollgruppe fungierenden anderen fachdi-
dem wird einer möglichst frühen Auseinandersetzung daktischen Seminars. Baumert und Kunter (2006) zu-
mit außerschulischen Lernorten und deren Potenzialen folge beeinflussen während den Verläufen professionel-
sowie der Didaktik und Methodik außerschulischen Un- len Handelns Kompetenzerfahrungen die Selbstwirk-
terrichts im Rahmen der Professionalisierung große Be- samkeitserwartungen. Da auch bereits in den vorausge-
deutung beigemessen (Gülpen & Wenning, 2020). Wie gangenen Zyklen des kooperativen Ausbildungspro-
Befunde aus anderen Studien zeigen, ist die Wahrneh- jekts in intensiver Zusammenarbeit der beiden Berufs-
mung entsprechender kooperativer Angebote bezüglich gruppen kreative Lösungen für die Gestaltung außer-
Zufriedenheit und Nutzen auf beiden Seiten äußerst po- schulischer Lernangebote geschaffen, diese in überzeu-
sitiv (vgl. 3.2; Gülpen & Wenning, 2020; Paschold, gender Weise in vor- und nachbereitende Lernmodule
2015; Reinke & Rösch, 2015). für den schulischen Biologieunterricht eingebettet so-
wie gemeinsam eine umfangreiche Lehrerhandreichung
3.5 Forschungsfragen erstellt werden konnten, spricht viel dafür, dass auch bei
Von besonderem Interesse war, ob sich die an „Land- den in dieser Studie untersuchten Probanden ein positi-
wirtschaft macht Schule“ teilnehmenden Lehramtsstu- ver Effekt auf fähigkeitsbezogene Überzeugungen zu
dierenden nach Abschluss des Projekts (a) in ihren beobachten sein könnte.
Kompetenzen zur Planung und Durchführung außer- (b) Des Weiteren vermuteten wir, dass die an „Land-
schulischen Lernens gestärkt fühlen sowie (b) ob sie die wirtschaft macht Schule“ teilnehmenden Lehramtsstu-
Relevanz interprofessioneller Kooperation im Hinblick dierenden die Kooperation mit den außerschulischen
auf die Vorbereitung, Gestaltung und Nachbereitung Fachleuten in höherem Maß als zuvor und als Proban-
außerschulischen Unterrichts anders einschätzen als zu- den der Kontrollgruppe schätzen würden – im konkre-
vor. Zudem sollte (c) geklärt werden, ob die empirische ten Fall die Zusammenarbeit mit etwa gleichaltri-
Datenbasis für einen engen Zusammenhang der beiden gen Junglandwirt/inn/en nach deren Erstausbildung
abhängigen Variablen spricht, ob also angesichts eines und inmitten deren Qualifizierung zum/r Meister/in.
Kompetenzerlebens bei der kooperativen Gestaltung Für diese Annahme sprechen zum einen Befunde
außerunterrichtlichen Unterrichts höhere fähigkeitsbe- aus interprofessionellen Kooperationsprojekten, die in
zogene Überzeugungen mit einer höheren Wertschät- späteren Praxisphasen der zusammenarbeitenden Be-
zung der Zusammenarbeit mit außerschulischen Ex- rufsgruppen angesiedelt waren (Paschold, 2018; Vogl et
pert/inn/en einhergehen. al., 2015). Zum anderen liefert die Selbstbestimmungs-
theorie der Motivation Argumente dafür: Positives Er-
3.6 Hypothesen leben einer Kooperation, welche die Erfahrung von
Angesichts der didaktisch-methodischen Konzeption Kompetenz ermöglicht – gerade auch angesichts des
des kooperativen Ausbildungsprojekts wurden im Hin- Miteinander-Teilens von Expertisen und des sich ge-
blick auf die drei in der Experimentalgruppe bewusst meinsam Weiterentwickelns – kann Deci und Ryan
gestalteten unabhängigen Variablen (Erwerb inhaltli- (2000) zufolge die intrinsische Motivation erhöhen,
chen und lernortsbezogenen Wissens, Erarbeitung von solch eine Situation wieder zu teilen. Dies wiederum
didaktisch-methodischen und rechtlichen Grundlagen stellt eine Basis für die subjektive Bedeutung interpro-
außerschulischen Lernens sowie eigene Entwicklung fessioneller Kooperation dar. Ein vergleichsweise posi-
und Erprobung außerschulischer Unterrichtsbausteine tives Erleben der Kooperation im Ausbildungsprojekt
durch intensives Zusammenwirken der Berufsgruppen) war in früheren Projektzyklen bereits zu beobachten
à priori folgende Hypothesen formuliert: und manifestierte sich in einer sehr positiven emotiona-
(a) Zum einen gingen wir davon aus, dass die Lehramts- len Bewertung des Projektseminars im Rahmen der
studierenden aufgrund des Kompetenzerlebens wäh- Lehrevaluation (Reinke & Rösch, 2015; Rösch et al.,
rend der gemeinsamen intensiven Planung, Durchfüh- 2017).
rung und anschließenden Reflexion der Unterrichtsein- (c) Zudem erwarteten wir, dass ein hoher Zusammen-
heit inklusive Lernstationen auf einem landwirtschaftli- hang zwischen fähigkeitsbezogenen Überzeugungen
chen Betrieb höhere individuelle fähigkeitsbezogene und der subjektiv wahrgenommenen persönlichen Be-
Überzeugungen bezüglich der erfolgreichen Gestaltung deutung von Zusammenarbeit mit außerschulischen
außerschulischer Lernumgebungen als vor dem Projekt Fachleuten bestehen könnte, wenn man z. B. im Rah-
ZDB ● Zeitschrift für Didaktik der Biologie - Biologie Lehren und Lernen 25. Jg. 2021 120
doi: 10.11576/zdb-4054Rösch (2021)
men der Ausbildung intensiv kooperativ außerschuli- Subskalen aus diversen Quellen und theoretischer An-
sche Lernumgebungen vorbereitet und dabei den Be- nahmen erstens, dass nicht für alle abhängigen Variab-
darf an lernortsbezogener Expertise bewusst erfährt. len bereits Messinstrumente vorlagen und die interes-
Für diese Vermutung kann angebracht werden, dass die sierenden Konstrukte z. T. eine gewisse inhaltliche
Lehramtsstudierenden erst angesichts der sach- und Nähe aufweisen. Zweitens mussten schon in anderen
ortsbezogenen Kompetenzen der Junglandwirt/inn/e/n Zusammenhängen erprobte Items für den Kontext die-
und durch die gemeinsame kreative konzeptionelle Ge- ser Studie inhaltlich adaptiert werden. Es war nicht klar,
staltung von Lernstationen für die Bauernhof-Erkun- ob die theoriebasierte und in den jeweiligen Quellen er-
dung (inklusive deren Durchführung) und der vor- und probte Konstruktvalidität im neuen inhaltlich-kontextu-
nachbereitenden Unterrichtsstunden Selbstwirksam- ellen Zusammenhang empirisch angemessen sein
keitserfahrungen sammeln können (Rösch & Reinke, würde. Diesbezüglich sollte zunächst ein großer Item-
2014 b; Rösch et al., 2018). Für hohe subjektive Lern- pool generiert und anhand einer explorativen ‚Faktoren-
fortschritte liegt aus früheren Projektzyklen bereits em- analyse‘ erstmalig im neuartigen Kontext analysiert
pirische Evidenz vor (Reinke & Rösch, 2015; Rösch et werden.
al., 2017). Auch die Befunde aus anderen Kooperati- Als finale Subskalen ergaben sich eine sechs Items um-
onsprojekten stützen diese Annahme: dort gehen Hand- fassende Batterie „fähigkeitsbezogene Überzeugungen
lungsbereitschaft infolge von Kompetenzerleben und bezüglich der Gestaltung außerschulischer Lernumge-
Wertschätzung der Zusammenarbeit miteinander einher bungen (Fähigkeitsselbstkonzept und Selbstwirksam-
(Paschold, 2015, 2018; Vogl et al., 2015). Wenn das keitserwartungen)“ (interne Konsistenz: Cronbachs α =
Kompetenzerleben hoch ausgeprägt ist, so ist dies zu- .75) sowie eine sechs Items umfassende Batterie „per-
mindest in Teilen auf das Zusammenwirken zurückzu- sönliche Bedeutung interprofessioneller Kooperation
führen. In der Kontrollgruppe und zum Pretest-Zeit- im Hinblick auf außerschulisches Lernen (Wertschät-
punkt könnten die beiden Personenmerkmale durchaus zung und Volition)“ (Cronbachs α = .70), die eine ak-
weniger miteinander korrelieren, weil eine der beiden zeptable Reliabilität aufweisen. Während das erste
Variablen unabhängig von der anderen z. B. aufgrund Konstrukt im Modell professioneller Kompetenz (Bau-
von Erfahrungen oder infolge bloßer Plausibilität hoch mert & Kunter, 2006) klar den Überzeugungen zuge-
ausgeprägt sein könnte. ordnet werden kann (vgl. Kap. 2), tangiert die Operati-
onalisierung des zweiten Konstruktes sowohl Überzeu-
4 Methode gungen als auch Werthaltungen hinsichtlich guten au-
ßerschulischen Unterrichts im Rahmen interprofessio-
4.1 Erhebungsinstrument neller Kooperation.
Um diese Forschungsfragen beantworten zu können, Zwei Beispielitems für die erstgenannte Batterie seien
wurde zunächst ein standardisierter Fragebogen mit ge- an dieser Stelle exemplarisch genannt: „Ich fühle mich
schlossenen Items entwickelt (Rösch, in Vorbereitung). überfordert, außerschulische Lernumgebungen zu ge-
Diese waren anhand einer fünfstufigen bipolaren Li- stalten“ (negativ formuliert zur kriterialen Selbstwirk-
kert-Ratingskala (von 0 = „stimme nicht zu“ bis 4 = samkeitserwartung). Das Item „Es fällt mir leicht, Un-
„stimme sehr zu“) zu beantworten, die bei parametri- terricht für Orte außerhalb der Schule zu konzipieren“
schen statistischen Tests nach dem per-fiat-Prinzip als gehört zur selben Skala und repräsentiert in der ur-
quasiintervallskaliert behandelt wird (Bortz & Döring, sprünglichen Version „kriteriales Selbstkonzept“. Der
2006). Zur Varianzmaximierung bearbeitete eine Stich- Vergleich der beiden Items führt die inhaltliche Nähe
probe von Lehramtsstudierenden (N = 302) aus ver- der in den herangezogenen Quellen ursprünglich ge-
schiedenen Semestern den Fragebogen. Anschließend trennt voneinander betrachteten Konstrukte vor Augen
wurden die Items einer Skalenanalyse und -optimierung (s. auch Kunter & Pohlmann, 2015) – es erscheint plau-
sowie einer der explorativen Faktorenanalyse ver- sibel, dass die Analyse der empirischen Daten einen ge-
gleichbaren Hauptkomponentenanalyse mit Varimax- meinsamen Faktor im Sinne konvergenter Validität
Rotation (Bühner, 2011; Rudolf & Müller, 2004) unter- (Bühner, 2011) nahelegt. Diesbezüglich erscheint eine
zogen. Für eine explorative Vorgehensweise mit dem ‚künstliche‘ Zuordnung durch Baumert und Kunter
Ziel der Skalen(neu)bildung durch eine Faktorenextrak- (2006) von kriterialem Selbstkonzept zu „Überzeugun-
tion (ebd.) sprach trotz teilweise bereits vorhandener gen / Werthaltungen“ auf der einen Seite und von
ZDB ● Zeitschrift für Didaktik der Biologie - Biologie Lehren und Lernen 25. Jg. 2021 121
doi: 10.11576/zdb-4054Sie können auch lesen