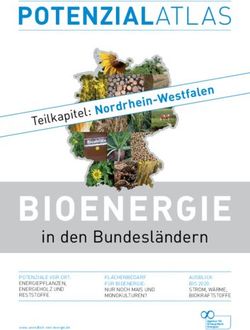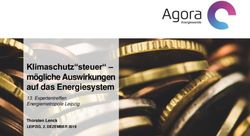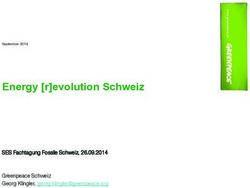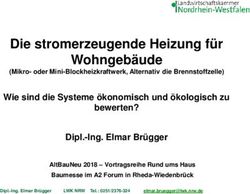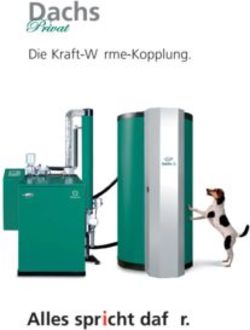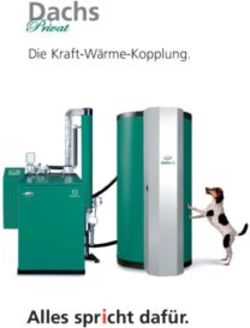Methoden, Modelle und Annahmen in der BMU-Leitstudie 2011 - Tobias Naegler, Joachim Nitsch, Thomas Pregger, Yvonne Scholz, Dominik Heide, Diego ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Methoden, Modelle und Annahmen in der BMU-
Leitstudie 2011
Tobias Naegler, Joachim Nitsch, Thomas Pregger,
Yvonne Scholz, Dominik Heide, Diego Luca de Tena,
Franz Trieb, Kristina NienhausÜberblick
1) Leitstudie im Rahmen des Energiekonzepts
2) Energiesystem-Modell MESAP
3) Mengengerüste der Leitstudie 2011
4) Szenario-Validierung
a) Versorgungssicherheit Strom
b) Validierung PKW-Szenario
5) ökonomische Aspekte
6) wesentliche Schlussfolgerungen der Leitstudie 2011Überblick
1) Leitstudie im Rahmen des Energiekonzepts
2) Energiesystem-Modell MESAP
3) Mengengerüste der Leitstudie 2011
4) Szenario-Validierung
a) Versorgungssicherheit Strom
b) Validierung PKW-Szenario
5) ökonomische Aspekte
6) wesentliche Schlussfolgerungen der Leitstudie 2011Leitstudie 2011: normative Szenarien
(„Zielszenarien“) im Rahmen des Energiekonzepts
- Entwicklung realistischer Transformationspfade zum Umbau des
Energiesystems
- Leitstudie 2011: Umsetzung der wesentlichen Ziele für 2050 des
Energiekonzepts
- THG-Emissionen: minus 80-95%
- Stromverbrauch: minus 25%
- Reduktion Endenergieverbrauch Verkehr: minus 40%
- EE-Anteil am Brutto-Endenergieverbrauch: 60%
- EE-Anteil am Brutto-Stromverbrauch: 80%
- Durchbruch Elektromobilität
- Atomausstieg
- …Teilaspekte der „Leitstudie“
- Mengengerüste, z. B.
- Nutzenergiebedarf
- Primär- und Endenergieverbrauch
- installierte Leistungen Strom- und Wärmeerzeugung
- energiebedingte CO2-Emissionen
- Import/Export
- Validierung der Mengengerüste (Versorgungssicherheit)
- dynamische Simulation der Stromversorgung
- Bestimmung Ausnutzungsdauer Energieerzeuger u. Speicher
- ökonomische Bewertung
- Gestehungskosten Strom, Wärme
- systemanalytische Differenzkosten
- Investitionen in EE-Strom- und –Wärme-AnlagenSzenarienvarianten Leitstudie 2011
• erfüllen alle wesentliche Ziele des Energiekonzepts:
• Szenario 2011 A:
• Anteil E-Mobilität an PKW-Verkehrsleistung 2050: 50%
• Durchbruch von H2-Fahrzeugen (Brennstoffzelle)
• Szenario 2011 B: wie Szenario A, aber
• kein H2 im Verkehr, stattdessen Verbrennungsmotoren auf EE-Methan-Basis
• Szenario 2011 C: wie Szenario A, aber
• kein H2 im Verkehr, PKW-Verkehrs vollständig elektrisch (BEV und Plug-in-
Hybride)
• Szenario 2011 THG95:
• Reduktion CO2-Emissionen um 95% bis 2060
• Zusätzlicher Stromeinsatz insbesondere für Wärme
• H2 als chem. Speicher: Rückverstromung, HT-Prozesswärme, VerkehrÜberblick
1) Leitstudie im Rahmen des Energiekonzepts
2) Energiesystem-Modell MESAP
3) Mengengerüste der Leitstudie 2011
4) Szenario-Validierung
a) Versorgungssicherheit Strom
b) PKW-Szenario
5) ökonomische Aspekte der Transformation des Energiesystems
6) wesentliche SchlussfolgerungenEnergiesystemmodellierung: Modell MESAP
- konsistente Bilanzierung von Stoff- und Energieflüssen
- Berechnung installierter Leistungen Stromerzeugung und
Stromgestehungskosten
- „Kalibrierung“ des Modells mit statistischen Daten: Treibergrößen, Primär-
und Endenergieverbrauch, Anwendungsbilanzen…
- Berücksichtigung
- relevanter Primär- und End-Energieträger
- relevanter Umwandlungstechnologien
- relevanter Energieverbraucher und Verbrauchstechnologien
- sozio-ökonomischen Treibergrößen
- technologisch-ökonomische Entwicklungspfade der relevanten
Technologien (Effizienzen, Investitionskosten…)Energiesystemmodell MESAP: prinzipielle
Struktur
Treibergrößen:
- BIP
- Bevölkerung
- Wohnfläche
-…
Primärenergieverbrauch
CO2-Emissionen
Endenergieverbrauch:
Umwandlungssektor: - Verkehr
- Kraftwerke - Industrie
- Heizkraftwerke - private Haushalte
- Heizwerke - GHD
- H2-Erzeugung/Methanisierung
-…Substruktur: Beispiel Industriesektor Verbrauchssektoren: - Raumwärme - Warmwasser - Prozesswärme - mechanische Energie - Beleuchtung, Kommunikation
Substruktur: Beispiel Prozesswärme Industrie Technologien zur Wärmeerzeugung: - Gasbrenner - Ölbrenner - Biomassebrenner - Wärmepumen - Solarthermie - Fernwärme -…
www.DLR.de • Folie 12 > Leitstudie 2011 > Tobias Naegler • Institutsseminar IUP Heidelberg > 12.07.2012 Technologiebeschreibungen: Datenblätter Pellet-Ofen Haushalte (
Überblick
1) Leitstudie im Rahmen des Energiekonzepts
2) Energiesystem-Modell MESAP
3) Mengengerüste der Leitstudie 2011
4) Szenario-Validierung
a) Versorgungssicherheit Strom
b) Validierung PKW-Szenario
5) ökonomische Aspekte
6) wesentliche Schlussfolgerungen der Leitstudie 2011Prämissen/Grundannahmen im Stromsektor - Reduktion Endenergieverbrauch Strom um 25% bis 2050 - EE-Anteil am Bruttostromverbrauch >80% Prämisse stabiler Inlandsmärkte - konventioneller Kraftwerkspark: Rückbau von Grundlastkraftwerken, höherer KWK-Anteil, flexible Gaskraftwerke - Atomausstieg - starke Rolle der Windkraft, begrenzter Ausbau PV aufgrund starker Fluktuation/Leistungsspitzen - begrenzte Biomassenutzung wg. limitierter nachhaltiger Potenziale, Einsatz vor allem in KWK-Anlagen - EE-Stromimport (einschl. CSP) zur Versorgung und für Lastausgleich - Netzausbau im nationalen und europäischen Übertragungsnetz nationaler und europäischer Last- und Erzeugungsausgleich - Netzausbau im Verteilnetz und variable Tarife ermöglichen Erzeugungs- und Lastmanagement
Komponenten des Bruttostromverbrauchs Szenario A
700
Übriger
Verbrauch *)
614
612 617
607 585 574 Wasserstoff-
600 591 583 erzeugung
564
572 558 562
571
566 548
556
Bruttostromverbrauch, [TWh/a]
Elektro-
mobilität
500 Wärme-
pumpen
Verkehr,
Schiene
400
GHD**)
Private
Haushalte**)
300
Endenergie
Industrie
SZEN11/STR-END; 8.10.11
200
*) Eigenverbrauch Kraft-
werke; Netzverluste; Pump-
strom; Exportsaldo;
100 Übrig. Umwandlungssektor.
**) ohne Wärmepumpen
0
2005 2010 2015 2020 2025 2030 2040 2050Struktur der Bruttostromerzeugung Szenario A
700
EE-Wasserstoff
(KW K, GT)
614 617 Europäischer
Verbund EE
600 585 574
564 Photovoltaik
Bruttostromerzeugung, [TWh/a]
558 562
548
W ind
Offshore
500 W ind an
Land
Geothermie
400 Laufwasser
Biomasse,
biogen. Abfälle
KW K,
300 Gas, Kohle
Erdgas, Öl
Kond.
Braunkohle
Kond.
200 Steinkohle
Kond.
Kernenergie
100
SZEN11/STR50-A; 7.10.11
0
2005 2010 2015 2020 2025 2030 2040 2050Struktur der Stromerzeugungskapazitäten Szenario A
250
Europ.
225 Verbund EE
223
Gesicherte 210
215 Photovoltaik
Leistung 203
Bruttoleistung Kraftwerke, GW
Wind
200 Offshore
186 Wind an
Land
163 Andere
Speicher
EE-Wasser-
150 stoff
133
Geothermie
Laufwasser
100 Biomasse
KWK
fossil
Erdgas, Öl
Kond.
50 Braunkohle
Kond.
Steinkohle
Kond.
Höchst- Kernenergie
last 0
SZEN11/ S-LEIS-A; 7.10.11
2005 2010 2015 2020 2025 2030 2040 2050Prämissen/Grundannahmen im Wärmesektor - große Effizienzpotentiale Raumwärme: spez. Endenergieverbrauch für Raumwärme: -50%, fossiler Primärenergieverbrauch -80% bis 2050 - langfristig bedeutende Rolle der Kraft-Wärmekopplung und netzgebundener Wärme (Solar- und Geothermie, Langzeitspeicherung) - deutliche Steigerung EE-Wärme, insbesondere im Raumwärmesektor und bei netzgebundener Wärme - Einsatz von EE-Strom im Wärmebereich (Substitution fossiler Brennstoffe, insb. Wärmepumpen für Raumwärme, Elektroheizer für Prozesswärme) - Flexibilisierung der KWK: mit Wärmespeichern und in Bezug auf Wärmehöchstlast größer dimensionierte Anlagenleistung - begrenzte Rolle von Biogas und Biomasse aufgrund limitierter nachhaltiger Biomassepotentiale
Endenergieverbrauch für Wärme
6000
-45% Endenergie bis 2050 Strom (direkt)
~50% EE-Anteil bis 2050
Endenergieverbrauch für Wärme [PJ/a]
Strom (Wärmepumpe)
5000
Heizöl (direkt)
Kohle (direkt)
4000
Erdgas (direkt)
Fern-/Nahwärme (fossil)
3000 Industrielle KWK (fossil)
Biomasse (individuell)
Biomasse (Nahwärme)
2000
Solarthermie (Nahwärme)
Solarthermie (individuell)
1000
tiefe Geothermie (Nahwärme)
Umweltwärme (Wärmepumpen)
0
2009 2010 2015 2020 2025 2030 2040 2050Prämissen/Grundannahmen im Verkehrssektor - leichter Rückgang Personenverkehrsleistung - deutlicher Anstieg der Güterverkehrsleistungen, insbesondere auch der Bahn und des Schiffsverkehrs - Realisierung von Effizienzpotentialen im gesamten Verkehrsbereich, insbesondere bei konventionellen Antrieben (PKW: 50-60%, LKW: 30%) - konsequente Verschärfung der CO2-Grenzwerte für Neufahrzeugflotten - begrenzte nachhaltige Biokraftstoffpotenziale fundamentaler Strukturwandel mit neuen Antriebstechnologien und einer veränderten Versorgungsinfrastruktur - Durchbruch der Elektromobilität vor allem bei den PKW - langfristig dritter erneuerbarer Kraftstoff im Verkehr (H2, CH4, synthetische Kohlenwasserstoffe, jeweils aus EE-Strom) - detaillierte Untersuchung von drei Unterszenarien im Verkehr mit unterschiedlichem Beitrag E-KFZ (BEV, EREC), EE-H2 (BZ, VB), EE-CH4
Entwicklung des Endenergieverbrauchs Verkehr
Szenario A, nach Energieträgern
Wasserstoff
2500 Biokraftstoffe
Strom
Endenergieverbrauch Verkehr, PJ/a
Erdgas
2000 Kerosin
Benzin
Diesel
1500
1000
500
Reduktion Endenergieverbrauch um 40% bis 2050
~50% EE-Anteil bis 2050
0
2005 2008 2009 2010 2015 2020 2025 2030 2040 2050Auswirkungen Verkehr auf Gesamtsystem:
Bruttostromverbrauch A (50% E-Mob, EE-H2)
*) Eigenverbrauch, Transport-
und Speicherverluste, nicht-
endenergetischer Verbrauch
**) ohne WärmepumpenAuswirkungen Verkehr auf Gesamtsystem:
Bruttostromverbrauch B (50% E-Mob, EE-CH4)
*) Eigenverbrauch, Transport-
und Speicherverluste, nicht-
endenergetischer Verbrauch
**) ohne WärmepumpenAuswirkungen Verkehr auf Gesamtsystem:
Bruttostromverbrauchs C (100% E-Mob)
*) Eigenverbrauch, Transport-
und Speicherverluste, nicht-
endenergetischer Verbrauch
**) ohne WärmepumpenImportabhängigkeit Energieversorgung
Überblick
1) Leitstudie im Rahmen des Energiekonzepts
2) Energiesystem-Modell MESAP
3) Mengengerüste der Leitstudie 2011
4) Szenario-Validierung
a) Versorgungssicherheit Strom
b) Validierung PKW-Szenario
5) ökonomische Aspekte
6) wesentliche Schlussfolgerungen der Leitstudie 2011dynamische Simulation Stromerzeugung &
Validierung der Mengengerüste: Modell Remix
Potenziale zur
DC - Übertragung AC - Übertragung Strombedarf
Stromerzeu- HGÜ Überlandleitung basierend auf dem „heutigen”
gung mit oder Erdkabel AC-Übertragungsnetz (Europa)
Erneuerbaren
Optimisierungs-Modul REMix
Kostenminimierte Versorgung zeitlich & räumlich aufgelöst Wärmebedarf
Flex. KWK-Betrieb:
- Wärmespeicher
Modell - Spitzenkessel
Elektrofahrzeuge-EV
BEV/EREV: unterschied.
Ergebnis: Ladestrategien, V2G.
Erzeugungs- & Speicherstrategien Batteriekapazität der
Mo. 30.10 Di. 31.10 Mi. 1.11 Do. 2.11 Fr. 3.11 Sa. 4.11 So. 5.11 Flotte in zeitlicher
Auflösung.
x
Konventionelle Speicher Lastmanagement
Erzeugung Pumpspeicher Industrie & Haushalte FCEV: flexible On-site
Nuklear, Kohle Druckluftspeicher (in Entwicklung) H2-Erzeugung
CCGT, Gas WasserstoffLastdeckung im Jahr 2050: Ergebnisse von Remix
Überblick
1) Leitstudie im Rahmen des Energiekonzepts
2) Energiesystem-Modell MESAP
3) Mengengerüste der Leitstudie 2011
4) Szenario-Validierung
a) Versorgungssicherheit Strom
b) Validierung PKW-Szenario
5) ökonomische Aspekte
6) wesentliche Schlussfolgerungen der Leitstudie 2011Verkehr: Flottensimulationsmodell Vector 21 (DLR-FK)
Energieverbrauch Technologiekosten Kraftstoffpreise, Steuern, …
Computer-Modell
Effizienz- Fahrzeuggröße Fahrzeuggröße
pakete
Antriebs- Fahrzeug Kunden “Adopter”-Typ
Auswahl
konzept (900 Gruppen)
Kraftstoffart Technik- Jahres- Zahlungs-
komponenten fahrleistung bereitschaft
Quelle: DLR-Institut für
Fahrzeugkonzepte, Stuttgart
Verkäufe / Marktanteile CO2-EmissionenVerkehrssektor: Entwicklung PKW-Fahrzeugflotte
100%
Anteil an PKW-Flotte in D
G
GHyb
D
DHyb
50% CNG
CNGHyb
EREV
„Wasserstoff- BEV
-Szenario“ (Szenario 2011 A) FCV
0%
2010 2020 2030 2040 2050Überblick
1) Leitstudie im Rahmen des Energiekonzepts
2) Energiesystem-Modell MESAP
3) Mengengerüste der Leitstudie 2011
4) Szenario-Validierung
a) Versorgungssicherheit Strom
b) Validierung PKW-Szenario
5) ökonomische Aspekte
6) wesentliche Schlussfolgerungen der Leitstudie 2011Entwicklung spezifische Investitionskosten für EE-Technologien
www.DLR.de • Folie 34 > Leitstudie 2011 > Tobias Naegler • Institutsseminar IUP Heidelberg > 12.07.2012
jährliche Investitionen in EE-Strom und -Wärme
35000
Wasser Wind Fotovoltaik Biomasse Erdwärme
Strom Strom
Europ. Biomasse Erdwärme,
30000 Solarwärme H2-Elektrolyse
Jährliche Investitionen, Mio. EUR(2009)/a
Stromverbund Wärme Wärmepumpen
25000
20000
15000
10000
5000
0
2000
2002
2004
2005
2007
2008
2010
2012
2013
2015
2016
2018
2019
2040
2050
2011
2001
2003
2006
2009
2014
2017
2020
2030
2060
SZEN11/INV-EE; 2.12.11Stromgestehungskosten Erneuerbare Energien
0.20
Wasser
EE - Neuanlagen
Wind
Onshore
Stromgestehungskosten, EUR(2009)/kWh
Wind
0.15 Offshore
Fotovoltaik
Geothermie
0.10
Europ.
Verbund
Feste
Biomasse
0.05 Biogase,
Deponiegas
Mittelwert
Mittelwert
0.00 ohne PV
2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060
Szen11/STR-KOS1; 15.11.11Entwicklung Kosten fossile Brennstoffe
180
Nominal
160 Real (Geld-
wert 2007)
Ölpreis (Jahresmittelwert) , $ 2009/b
140
Pfad A:
"Deutlich"
120
2011 Pfad B:
"Mäßig"
100
WEO 2010
80 New Policy
60 WEO 2010
Current Pol.
40
preis11/oelpr-11; 24.10.11
20
0
1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050Entwicklung CO2-Zertifikatspreise
Stromgestehungskosten konventioneller
Kraftwerke - Preispfad A: "Deutlich" (Zins 6%/a, Abschr. 25 a, 6000 h/a) -
16
CO2-
Aufschlag
Stromgestehungskosten, ct(2009)/kWh
14 13.55 Brennstoff
13.12
Betriebs-
Preispfad B: "Mäßig" 11.69 kosten
12
11.31 Kapital-
kosten
9.96 9.78 SZEN11; KW-KOSA, 16.11.11
10 9.44
8.61
8 7.76 7.62
7.32
5.98 5.90
6 5.74
5.01 4.94
4.38
4 3.66
2
0
05
10
20
30
40
50
05
10
20
30
40
50
05
10
20
30
40
50
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Braunkohle Steinkohle Erdgas - GuDwww.DLR.de • Folie 39 > Leitstudie 2011 > Tobias Naegler • Institutsseminar IUP Heidelberg > 12.07.2012 Steinkohle-KW: Abhängigkeit der Stromgestehungskosten von Volllaststunden
Beispiel systemanalytische Differenzkosten
Stromerzeugung
- Szenario 2011 A, gesamte EE-Stromerzeugung -
14
12
Differenzkosten, Mrd. EUR (2009)/a
10
8
6
4
2
0
-2
-4
Pfad A: Pfad B: Sehr Externe Kosten
Ist
Deutlich Mäßig niedrig internalisiert
-6
-8
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
SZEN11/DIFVAR1; 12.11.11Kumulierte Differenzkosten der gesamten Energiebereitstellung
aus EE im Szenario 2011 A für 10-Jahres-Abschnitte und Preispfad A
- Szenario 2011 A; alle EE; Preispfad A -
150
Kumulierte Differenzkosten, Mrd.EUR (2009)
+ 139 Fotovoltaik
100 Strom ohne
+ 71 Fotovoltaik
+9
50 Wärme
- 249 Kraftstoffe
0
Szen11/DIFKUMGES; 12.11.11
-50
-100
-150
-200
Summenwert 2041- 2050: -543 Mrd. €
-250
bis 2010 2011-2020 2021-2030 2031-2040Überblick
1) Leitstudie im Rahmen des Energiekonzepts
2) Energiesystem-Modell MESAP
3) Mengengerüste der Leitstudie 2011
4) Szenario-Validierung
a) Versorgungssicherheit Strom
b) Validierung PKW-Szenario
5) ökonomische Aspekte
6) wesentliche Schlussfolgerungen der Leitstudie 2011wesentliche Schlussfolgerungen I
- Ziele des Energiekonzepts strukturell-technologisch prinzipiell
erreichbar
- Herausforderungen beim Transformation des Energiesystems
insbesondere in den Bereichen
Wärme
- Effizienzsteigerung im (Raum-)Wärmesektor: große Potentiale
insbesondere bei Sanierung Gebäudebestand, aber schwer zu heben
- Ausbau EE-Wärme: ungenügende Förderinstrumente, strukturelle
Hemmnisse (Wärmenetze, Wärmespeicher zur effizienten Nutzung
von KWK, Solar- und Geothermie), flächendeckende Wärmepläne
Verkehr
- deutliche Effizienzsteigerung konventioneller Antriebe nötig
- Verlagerung Güterverkehr auf Bahn
- Durchbruch E-Mobiliät, (H2-)Brennstoffzellenfahrzeuge nötig
- limitierte EE-Optionen für Flugverkehr und schweren Güterverkehrwesentliche Schlussfolgerungen II
Strom
- Effizienzsteigerung im Stromsektor: teilweise Umkehrung aktueller
Trends nötig (z. B. Pro-Kopf-Verbrauch in privaten Haushalten)
- Flexibilisierung des Kraftwerkparks
- Systemverantwortung erneuerbarer Stromproduktion
- Stromnetze:
- Ausbau der europäische und nationale Übertragungsnetze (incl.
HGÜ), nationale Verteilnetze
- „Smart Grids“ zum Last- und Erzeugungsmanagement
- Stromspeicher, insbes. (chem.) Langfristspeicher für EE-
ÜberschüsseVielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Sie können auch lesen