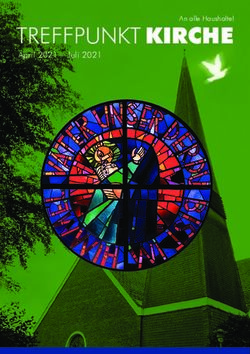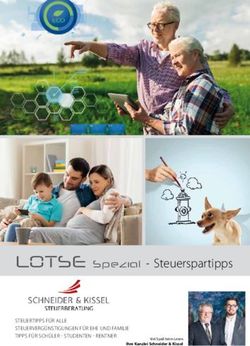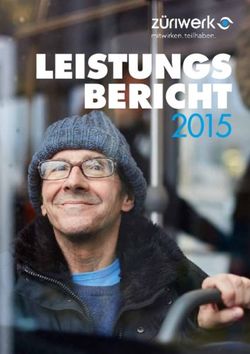Nachhaltigkeitsbericht der TU Chemnitz - Zeitraum 2015 bis März 2021 - Monarch: Qucosa
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Nachhaltigkeitsbericht der TU Chemnitz
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Über den Bericht ...................................................................................................................................... 1
Das Nachhaltigkeitsverständnis der TU Chemnitz ................................................................................ 3
TU Chemnitz – Eine internationale Hochschule .................................................................................... 5
Lehren und Lernen für die Nachhaltigkeit .............................................................................................. 6
Projekte und Arbeitsgruppen – Nachhaltigkeit in der Forschung......................................................... 7
Universitätsbibliothek .............................................................................................................................. 9
Universitätsrechenzentrum ................................................................................................................... 10
Beschaffung ........................................................................................................................................... 11
Partizipation, Gleichstellung und Familie ............................................................................................. 12
Universitäres Gesundheitsmanagement .............................................................................................. 14
Liegenschaften & Betrieb ...................................................................................................................... 14
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Baukastensystem Nachhaltiger Campus der Hochschule Zittau/Görlitz ...................... 2
Abbildung 2: Die 17 Nachhaltigkeitsziele (SDGs) .................................................................................. 3
Abbildung 3: Sustainable Development Goals in der Lehre der TU Chemnitz ..................................... 6
Abbildung 4: Sustainable Development Goals in (Forschungs-)Projekten der TU Chemnitz.............. 7
Abbildung 5: Papier- und Pappeabfall der TU Chemnitz in Tonnen (2014-2020) .............................. 16
Abbildung 6: Restabfall der TU Chemnitz in Tonnen (2014-2020) ..................................................... 17
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Übersicht über Verbräuche der TU Chemnitz (2014-2019) ............................................... 15Nachhaltigkeitsbericht der TU Chemnitz
Über den Bericht
Die Wiege der forstwissenschaftlichen Wurzeln des Nachhaltigkeitsbegriffs liegt in
Sachsen. Vor mehr als 300 Jahren hat Hans Carl von Carlowitz, geboren in Oberrabenstein
bei Chemnitz, die Grundlagen für ein nachhaltiges (Forst-)Wirtschaften gelegt. So ist die in
Chemnitz ansässige Sächsische Hans-Carl-von-Carlowitz-Gesellschaft e. V. ein
langjähriger Kooperationspartner der Technischen Universität (TU) Chemnitz.
Nachhaltigkeit ist ein Werteverständnis im Umgang mit Ressourcen, Menschen, Tieren,
Pflanzen und Natur sowie Kreisläufen im Heute und im Morgen. Die Entwicklung zur
Nachhaltigkeit ruft zu einer Wertehaltung und Handlungsweise auf, ökologische,
ökonomische und soziale Grundsätze und Ziele gleich zu gewichten. Dort sind wir als
Gesellschaft noch lange nicht. Daher stellt Nachhaltigkeit das zentrale Motiv der UN-
Agenda 2030 dar. Gemäß der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie ist Nachhaltige
Entwicklung als Leitprinzip konsequent in allen Bereichen und allen Entscheidungen
anzuwenden – so auch im Kontext von (Hochschul-)Bildung und Wissenschaft. Neben der
Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie betont die Sächsische Staatsregierung in der
Nachhaltigkeitsstrategie für den Freistaat Sachsen von 2018 (S. 9), dass die Gemeinden
und ihre wirkungsvollen Organisationen „wesentliche Akteure und eine treibende Kraft zur
Erreichung der globalen Nachhaltigkeitsziele sind“.
Als zentrale Bildungsinstitution der Region und als großer lokaler Arbeitgeber nimmt die
TU Chemnitz eine Vorbildfunktion zur Realisierung und Erreichung der Nachhaltigkeitsziele
ein. Die Ziele des ersten Nachhaltigkeitsberichts der TU Chemnitz sind somit vielfältig –
neben der Zusammenstellung von Informationen und der Bestandsaufnahme bezüglich
Nachhaltigkeitsfortschritten der TU Chemnitz soll der Bericht als Anreiz dienen, in Zukunft
weiterhin die notwendigen Themen der Nachhaltigen Entwicklung in den einzelnen
Bereichen voranzutreiben. Zusätzlich soll der Bericht den Leserinnen und Lesern vor Augen
führen, wie reichhaltig die Themen einer Nachhaltigen Entwicklung sind, wie Nachhaltigkeit
in den Prozessen der TU Chemnitz eingebunden ist und in welchen Bereichen sich
Mitglieder und Angehörige der TU Chemnitz weiterhin oder noch stärker engagieren
können. Der erste kompakte Nachhaltigkeitsbericht der TU Chemnitz ermuntert und
ermutigt alle Universitätsangehörigen, sich aktiv für eine Nachhaltige Entwicklung zu
engagieren und sich in die vielgestaltigen Themenfelder einzubringen.
Mit diesem ersten Nachhaltigkeitsbericht der TU Chemnitz wird zum ersten Mal Einblick in
die ökologischen, ökonomischen und sozialen Aktivitäten und Beiträge der drittgrößten
Hochschule Sachsens gegeben. Der Bericht beleuchtet nachhaltigkeitsbezogene
Aktivitäten und Entwicklungen im Zeitraum von 2015 bis März 2021 – auf Basis
verfügbarer Kennzahlen.
Im Bericht wird sich an einer ganzheitlichen Sicht der Nachhaltigkeit orientiert – wie im
Baukastensystem Nachhaltiger Campus der Hochschule Zittau/Görlitz aufgezeigt ist (vgl.
Abbildung 1). So enthält der Bericht das im Jahr 2020 partizipativ entwickelte
Nachhaltigkeitsverständnis der TU Chemnitz, wichtige Kennzahlen, aktuelle
Entwicklungsbedarfe und zukünftige Ziele. Es werden beispielhafte Forschungsprojekte
1sowie Lehrveranstaltungen aufgezeigt, die sich mit Aspekten der Nachhaltigen
Entwicklung auseinandersetzen.
Abbildung 1: Baukastensystem Nachhaltiger Campus der Hochschule Zittau/Görlitz
© HSZG Baukastensystem Nachhaltiger Campus, & Brauweiler, J. (2017).
Das „Baukastensystem Nachhaltiger Campus“ – ein Instrument zur Umsetzung von
Nachhaltigkeitsmanagement und -berichterstattung an Hochschulen.
uwf UmweltWirtschaftsForum, 25 (1–2), 147-157. https://doi.org/10.1007/s00550-017-0441-z.
Letzter Zugriff: 31. März 2021
Dieser erste Nachhaltigkeitsbericht der TU Chemnitz ist ein Gemeinschaftswerk und ein
Zeichen wertschätzender universitätsinterner Kooperation, die über die universitären
Grenzen gelebt wird. Neben dem herzlichen Dankeschön an all die Kolleginnen und
Kollegen in Verwaltung, Forschung und Lehre, die diesen Bericht möglich gemacht haben,
gilt mein besonderer Dank auch unseren Kooperationspartnern, dem Studentenwerk
Chemnitz-Zwickau und dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement
(SIB), die uns wertvolle Daten bereitgestellt haben. Ohne das große und beharrliche
Engagement unserer Studierenden, die an der Berichtserstellung mitgewirkt haben, wäre
der Bericht nicht das, was er jetzt ist – ein großes Dankeschön geht an Simon Fronczek
und Jana-Leonie Hofmann sowie weiterhin an Alina Vogel, Susann Güth, Nilay Akre, Vipul
Jhod, Anton Hofmeister und Alexander Kraus.
Prof. Dr. Marlen Gabriele Arnold
Professur BWL – Betriebliche Umweltökonomie und Nachhaltigkeit
Rektoratsbeauftragte für Nachhaltige Campusentwicklung
2Das Nachhaltigkeitsverständnis der TU Chemnitz
Im partizipativen Miteinander von Universitätsmitgliedern und -angehörigen wurde das
nachfolgende Nachhaltigkeitsverständnis entwickelt:
Die 17 globalen Ziele für Nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 adressieren
ökologische, ökonomische und soziale Entwicklungsaspekte, die auch auf das Wirken und
Handeln der TU Chemnitz einwirken. Die TU Chemnitz sieht sich in der besonderen
gesellschaftlichen Verantwortung zur regionalen, nationalen und internationalen
Entwicklung zur Nachhaltigkeit. Die TU Chemnitz will in einer Vorbildfunktion zur Agenda
2030 beitragen und Nachhaltigkeit in Lehre und Forschung stetig und dauerhaft verankern.
Hierfür wird ein Umfeld geschaffen, in dem alle Mitglieder und Angehörigen der Universität
zu einem übergreifenden nachhaltigen Denken und Handeln angeregt werden.
Abbildung 2: Die 17 Nachhaltigkeitsziele (SDGs)
©Bundesregierung (https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/ziele-fuer-eine
-nachhaltige-entwicklung-weltweit-355966). Letzter Zugriff: 07.August 2021
Die Universität setzt sich für die Verknüpfung disziplinärer Fachgebiete mit
Anforderungen der Nachhaltigen Entwicklung in Lehre und Forschung ein und stärkt
Interdisziplinarität. Dabei wird es als selbstverständlich angesehen, gesetzliche Vorgaben
einzuhalten und Umweltbelastungen bestmöglich zu reduzieren. Die Universität unterstützt
länderübergreifende Partizipation und Austauschmöglichkeiten von Mitarbeitenden sowie
Studierenden und schafft Anreize und Rahmenbedingungen für nachhaltigkeitsorientierte
Aktivitäten sowie daran ausgerichtetes Engagement.
In den folgenden Handlungsfeldern werden darüber hinaus spezifische
Nachhaltigkeitsaspekte in den Blick genommen:
Forschung, Lehre und Transfer: Die TU Chemnitz fördert Verständnis und
Umsetzungsoptionen von Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE). Innovative,
umweltverträgliche und sozialförderliche Forschung wird vorangetrieben und aktiv
unterstützt. Die Universität setzt sich für einen öffentlichen Diskurs über
Nachhaltigkeitsfragen ein und greift Themen der Nachhaltigkeit in Forschung, Lehre und
Weiterbildung auf. Dadurch sollen Studierende, Lernende sowie Bürgerinnen und Bürger zu
3zukunftsfähigem und nachhaltigkeitsausgerichtetem Denken und Handeln angeregt
werden und nachhaltige Kompetenzen aufbauen.
Ressourcen- und Umweltmanagement: Sowohl im Campusbetrieb als auch im Rahmen
sämtlicher Struktureinheiten der TU Chemnitz befördert die TU Chemnitz einen
verantwortungsbewussten Umgang mit Ressourcen und eine Reduzierung der
Umweltbelastungen. Alle Umweltmedien und Ökosystemdienstleistungen sowie deren
Wechselwirkungen finden Beachtung. Schädigungen der natürlichen Umwelt werden
soweit wie möglich vermieden.
Information und Kommunikation: Die TU Chemnitz sorgt dafür, dass durch die
transparente Kommunikation von Aktivitäten und Informationen alle Mitglieder und
Angehörige der Universität zur Teilhabe und Partizipation angeregt werden, u. a. im
Hinblick auf Themenfelder der Nachhaltigen Entwicklung und zentrale gesellschaftliche
Aspekte. Gesetzliche Vorgaben werden als einzuhaltende Mindeststandards und
Rahmenwerke gesehen, welche nach Möglichkeit übertroffen werden sollen. Um
Informationen nachvollziehbar und transparent präsentieren zu können, werden die Daten
zur nachhaltigen Universität regelmäßig erfasst und im Rahmen einer detaillierten
Berichterstattung für alle zugänglich gemacht. Durch externe und interne Kooperationen
und Partnerschaften mit verschiedenen Anspruchsgruppen soll das Umweltbewusstsein
sowie Umweltengagement des universitären Umfeldes gefördert werden.
Campusentwicklung und soziale Nachhaltigkeit: Mitglieder und Angehörige der Universität
werden bei Nachhaltigkeitsprojekten und im Rahmen des universitären
Zusammenarbeitens und -lebens in Richtung Nachhaltigkeit von der TU Chemnitz
unterstützt. Die Weiterentwicklung des Außenraumes wird gefördert.
Die Universität bietet eine offene Atmosphäre mit besonderem Fokus auf
Chancengleichheit aller Mitglieder und Angehöriger, unabhängig von Nationalität,
Geschlecht, Religionszugehörigkeit, kultureller und sexueller Orientierung. Durch das
entsprechende Angebot soll ein familiengerechtes und barrierefreies Umfeld geschaffen
und Diversität gefördert werden. Die vielfältigen Beziehungen zu Hochschulen und anderen
Forschungseinrichtungen sollen darüber hinaus dazu beitragen, die besondere Bedeutung
von Internationalität an der TU Chemnitz zu betonen.
4TU Chemnitz – Eine internationale Hochschule
Zukünftige und bereits bestehende Aufgaben der Sustainable Development Goals (SDGs)
lassen sich nur international und länderübergreifend lösen. Eine wichtige Aufgabe
übernehmen dabei die Hochschulen, die auch nationenübergreifendes Arbeiten
ermöglichen sowie kulturelle Kompetenzen schärfen können.
In Anbetracht der bestehenden, umfassenden Austauschprogramme und eines
internationalen Miteinanders ihrer Mitglieder und Angehörigen kann sich die TU Chemnitz
als internationale Hochschule ausweisen. Dies schlägt sich in der Anzahl der außer- und
innereuropäischen Austauschstudierenden nieder. So waren im Wintersemester 2019/20
ca. 27 Prozent (2.653) aller Studierenden der TU Chemnitz ausländische Studierende, die
für ein Vollstudium an der TU Chemnitz eingeschrieben waren. Zusätzliche 142
ausländische Studierende besuchten die TU Chemnitz für ein oder mehrere Semester.
Somit gelten über ein Viertel aller eingeschriebenen Studierende der TU Chemnitz als
internationale Studierende. Das macht die TU Chemnitz zu einer der internationalsten
Universitäten in Deutschland.
Die Studierenden kommen insbesondere aus dem asiatischen Raum. Spitzenreiter im Jahr
2019 waren Indien (805 Studierende) und China (729 Studierende) - gefolgt von Pakistan
(168 Studierende) und Bangladesch (115 Studierende).
Ebenso nutzen Jahr für Jahr Studierende der TU Chemnitz das Angebot, ein oder mehrere
Semester an außerdeutschen Universitäten zu verbringen, um Sprachfähigkeiten zu
verbessern und interkulturelle Erfahrungen zu sammeln. Im Jahr 2019 studierten 117
Studierende der TU Chemnitz über das Erasmus+-Programm an europäischen
Universitäten. Zusätzliche 34 Studierende befanden sich im außereuropäischen Ausland.
Im Jahr 2020 waren diese Zahlen, bedingt durch die Corona-Pandemie, niedriger.
Insgesamt 41 Studierende wagten den Schritt in das europäische Ausland. Zehn
Studierende studierten im außereuropäischen Ausland, wobei pandemiebedingt einige
Studierende ihren Aufenthalt wieder abbrechen mussten.
Auch in außereuropäischen Ländern, vor allem in Russland, Südkorea, Vietnam, Thailand,
China, Japan, Brasilien und Peru, sind einige Partnerhochschulen verteilt. Damit werden
das internationale Studieren und der Austausch unter den Studierenden gefördert.
Gemeinsam mit sieben weiteren Partnerhochschulen wird die TU Chemnitz für drei Jahre
mit 450.000 Euro als „UNIVERS – European Cross-Border University“ vom Deutschen
Akademischen Austauschdienst gefördert. Mit Hinblick auf die Vision einer Europäischen
Universität bestehen die ersten Ziele der Förderung in der Einführung einer geeigneten
Kooperationsstruktur und einer gemeinsamen digitalen Arbeitsgrundlage.
5Lehren und Lernen für die Nachhaltigkeit
Abbildung 3: Sustainable Development Goals in der Lehre der TU Chemnitz
Links Fakultäten, rechts Studiengänge oder Module. Quelle: TU Chemnitz, Eigene Darstellung
6Projekte und Arbeitsgruppen – Nachhaltigkeit in der
Forschung
Abbildung 4: Sustainable Development Goals in (Forschungs-)Projekten der TU Chemnitz
Akronyme von Projekten und Arbeitsgruppen. Quelle: TU Chemnitz, Eigene Darstellung
7 Interdisziplinäre Forschung und hochschulweite Aktivitäten
Zusätzlich zu den oben aufgeführten Projekten einzelner Professuren oder Fakultäten wird
an der TU Chemnitz interdisziplinäre Forschung gelebt. Die Vielfalt der Projekte und
Forschungsfelder, an bzw. in denen mehrere Fakultäten bzw. Professuren der TU Chemnitz
arbeiten, zeigt die gute Verzahnung innerhalb der Universität.
Außerhalb der Forschung können sich alle interessierten Hochschulmitglieder und -
angehörigen im Rahmen der AG Nachhaltigkeit einbringen und gemeinschaftlich
nachhaltigkeitsausgerichtete Ideen diskutieren und voranbringen. So beteiligte sich die
TU Chemnitz 2020/21 an der landesweiten Mitmachaktion Puppenstuben gesucht -
blühende Wiesen für Sachsens Schmetterlinge. Insgesamt wurden drei Flächen mit ca.
2.150 qm der bisherigen Campuswiesen in erfolgreicher Kooperation mit dem SIB und dem
universitären Dezernat Bauwesen und Technik zu bunten Blühwiesen umgestaltet.
Zusätzlich wurden Blühsträucher an den Universitätsteilen Erfenschlag und Wilhelm-
Raabe-Straße gepflanzt. Die Anzucht und Bewässerung übernahm das Dezernat Bauwesen
und Technik. Im Verlauf der nächsten Jahre soll eine Umstellung der Mahd auf weiteren
Wiesen diskutiert werden, um einen Beitrag zum Erhalt der biologischen Vielfalt zu leisten.
Im Rahmen der hochschulweiten AG Nachhaltigkeit werden zudem potentielle Ansätze zur
Klimaneutralität und deren Realisierung diskutiert.
In laufenden Abstimmungen mit der Stadt Chemnitz und den zuständigen Partnerinnen
und Partnern diskutiert die TU Chemnitz im Sinne einer sachgerechten Müllentsorgung
und Mülltrennung über die Einführung von Icons und motivierenden Sprüchen an
Mülltonnen zur Sensibilisierung von Hochschulmitgliedern und -angehörigen.
Studentische Initiativen
Neben den vielen nachhaltigkeitsbezogenen Projekten gibt es diverse
Studierendeninitiativen, welche sich für die Nachhaltige Entwicklung der TU Chemnitz
einsetzten. Zu diesen gehören Students for Future Chemnitz, das Referat für Ökologie und
Nachhaltigkeit des Student_innenrates (NATUC), der Subbotnik e. V. und die Initiative
foodsharing Chemnitz.
Die Fakultät für Maschinenbau unterstützt seit mehreren Jahren die studentische Initiative
Fortis Saxonia e.V. mit Material, Technik und Beratung. Diese studentische Initiative
entwickelt Fahrzeuglösungen, die mit minimalem Energiebedarf möglichst große
Reichweiten erzielen und damit zur Entwicklung nachhaltiger Antriebssysteme beitragen.
Die Initiative beteiligte sich u. a. erfolgreich am internationalen Wettbewerb Shell Eco
Marathon.
Die NATUC – Referat für Ökologie und Nachhaltigkeit des Student_innenrates – begann im
Jahr 2012 mit der Anlage eines Permakulturgartens vor dem Wohnheim auf der
Vetterstraße 52. Permakultur ist ein langfristig nachhaltiges Konzept der Landwirtschaft
und des Gartenbaus. Es basiert auf der genauen Beobachtung und Nachahmung
natürlicher Ökosysteme und Kreisläufe. Somit werden keine einjährigen Monokulturen
angepflanzt, sondern viele verschiedene mehrjährige Pflanzenarten, wodurch es über einen
größeren Zeitraum auch einen höheren Ertrag gibt.
8Universitätsbibliothek
Die Universitätsbibliothek der TU Chemnitz befindet sich seit Oktober 2020 auf dem
Gelände der „Alten Aktienspinnerei“ an der Straße der Nationen. Auf insgesamt 12.354
Quadratmetern laden 38 Kilometer Archiv- und Bibliotheksgut zum Recherchieren,
Nachlesen, Lernen und Grübeln ein. An den über 700 Arbeitsplätzen können Studierende,
Mitarbeitende sowie Besucherinnen und Besucher je nach Wunsch in Stillarbeit oder
Gruppenarbeiten lernen und arbeiten. Auch Lesekabinen, ein Lesesaal und ein
Veranstaltungsraum stehen zur Verfügung.
Bibliotheken leisten vielfältige Beiträge zur Agenda 2030 der UN – wie gesellschaftliche
Teilhabe durch freien Zugang zu Informationen und eine selbständige
Auseinandersetzung mit vielfältigen Informationen zur Realisierung der Agenda-Ziele.
Nachhaltigkeit im Sinne von Wissenschaft und Forschung fördert die Universitätsbibliothek
durch verstärkte Beratung zu Open Science sowie deren Strategien und Verfahren: Open
Access, Open Data/Forschungsdatenmanagement, Open Source und Open Educational
Resources. Zur Unterstützung der Mitglieder und Angehörigen der TU Chemnitz wurde in
der Bibliothek das Open Science-Team gegründet.
Open Access ist ein Bestandteil von Open Science und hat den freien Zugang zu allen
wissenschaftlichen Publikationen über das Internet zum Ziel. Die weltweite Open-Access-
Initiative vernetzt Forschungsförderer, Forschungsgemeinschaften, Verlage und
Wissenschaftseinrichtungen in diesem Prozess. Den Nutzerinnen und Nutzern der häufig
digital vorliegenden Forschungsergebnisse ist es dann gestattet, die Arbeiten zu jedem
rechtlich erlaubten Zweck zu verwenden. Für noch mehr Rechtssicherheit und die optimale
Nutzung empfiehlt die TU Chemnitz in ihrer Open Access Policy die Vergabe der Creative-
Commons-Lizenz CC BY. Neben der langfristigen Verfügbarkeit und der Förderung der
Forschungseffizienz hat Open Access noch weitere Vorteile beim Publizieren. Die
Universitätsbibliothek agiert deshalb als Vorreiter für Open Science in der TU Chemnitz.
Sie erhielt sowohl 2016 als auch 2020 für ihre Bemühungen bei der Umsetzung von
Maßnahmen für Offenheit im eigenen Umfeld den Open Library Badge. Die Auszeichnung
wurde nach strenger Prüfung verschiedener Kriterien verliehen. So ist auch der Anteil von
Publikationen, die als Open Access veröffentlicht wurden, gestiegen. Die Anzahl der Titel,
die auf diesem Weg einem breiteren Publikum zur Verfügung stehen, hat sich von jährlich
438 (2016) auf 529 (2020) ausgeweitet. Die E-Journal-Bestände sind von 50.637 im Jahr
2015 auf 70.923 im Jahr 2019 gestiegen.
Der Bestand an wissenschaftlicher Literatur der TU Chemnitz ist hingegen über die letzten
Jahre weitestgehend gleichgeblieben. Veränderungen gab es vor allem in dem Zugang zu
digitalen Titeln. Während im Jahr 2015 117.096 E-Books zugänglich waren, standen
100.362 im Jahr 2018, 110.894 im Jahr 2019 und 110.927 E-Books im Jahr 2020 zur
Verfügung. Anzumerken ist jedoch, dass die Beschaffung von E-Books immer von dem
Angebot der Verlage abhängig ist. Insbesondere in geisteswissenschaftlichen Disziplinen
werden Veröffentlichungen nach wie vor ausschließlich als Print angeboten; viele E-Books
werden zudem lediglich in Endkunden- und nicht in Campuslizenz angeboten, so dass sie
durch die Bibliothek nicht beschafft werden können.
Auch im operativen und strategischen Bereich der Bibliothek spielt Nachhaltigkeit eine
große Rolle. So hat das Universitätsarchiv der TU Chemnitz den Anspruch, die
Überlieferung von Schriftgut an nachkommende Generationen sicherzustellen und
anhand von bestimmten sachlichen und gesetzlichen Kriterien zu entscheiden, ob
Aktenmaterial aus dem laufenden Betrieb der TU Chemnitz oder von anderer Seite
9archiviert wird. In der Bibliothek wird darauf geachtet, durch kooperative
Erwerbung/Katalogisierung und Leihverkehr Dubletten und Doppelarbeiten zu vermeiden.
Im Rahmen der „Digital First“-Strategie der Bibliothek werden dabei bevorzugt E-Books
angeschafft – sofern vom Verlag als Campuslizenz angeboten – sowie bisher als Print
abonnierte Zeitschriften abbestellt und durch E-Journals ersetzt. Generell ist die
Universitätsbibliothek bestrebt, durch die Beschaffung von E-Ressourcen mit
Campuslizenz (Bücher, Zeitschriften, Datenbanken) allen TU-Mitgliedern und -Angehörigen
einen direkten Zugang zu Literatur zu ermöglichen. Zusätzlich spielt ökologische
Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle bei der Digitalisierung sowie bei allen buchbinderischen
Maßnahmen an den vorhandenen Werken.
Universitätsrechenzentrum
Als zentraler IT-Dienstleister an der TU Chemnitz stellt das Universitätsrechenzentrum
(URZ) eine moderne Informations- und Kommunikationsinfrastruktur für Forschung, Lehre
und Verwaltung zur Verfügung.
Bei Planung, Umsetzung und Ausbau der bereitgestellten Dienste wird den Themen
Energieeinsparung und Umweltschutz hohe Bedeutung beigemessen. Dies beginnt bereits
im Stadium der Projektplanung und -vorbereitung, bei der für Geräte und Komponenten
auch stets eine energetische Bewertung unter dem Aspekt eines 24/7-Betriebes erfolgt.
Generell liegt der Fokus bei der Auswahl auf erweiterungsfähigen Lösungsansätzen, zum
Beispiel der Einsatz von Blade-Architektur, welche nach Bedarf um Server-Einschübe
ergänzt werden kann. Auch die Komponenten im zentralen PC-Beschaffungsportal (Basis
bestehender Rahmenverträge) werden ca. halbjährlich, auch anhand von
Energieverbrauchskriterien, neu bewertet.
Im Datacenter haben sich mit der konsequenten Umsetzung der Virtualisierungsstrategie
die Anzahl der physischen Serversysteme und damit auch der Energieverbrauch für Betrieb
und Klimatisierung deutlich reduziert. Bereits 2015 lag die Virtualisierungsrate bei über
90 Prozent. Für die physischen Systeme werden leistungsstarke Maschinen zum Einsatz
gebracht, sodass insgesamt in der Anzahl weniger benötigt werden und damit ebenfalls zu
einem geringeren Energiebedarf beigetragen wird. Die im Einsatz befindliche
„Virtualisierungs-Infrastruktur“ im Datacenter regelt die Lüfter anhand der abgeforderten
Leistung und aktiviert Netzteile nach Bedarf. 2014 wurden im Rahmen einer
Baumaßnahme im Datacenter das Konzept der Kaltgangeinhausungen umgesetzt
(getrennte Warm- und Kaltluftführung) und somit die Energiebilanz deutlich verbessert.
Im Bereich Storage kommt statt dedizierter RAID-Speichersysteme eine zentralisierte
SAN-Speicherinfrastruktur zum Einsatz. Damit geht eine Reduzierung von peripheren
Baugruppen wie Netzteilen und Lüftern einher.
Um Mitarbeitenden und Studierenden möglichst bedarfsgerecht Storageressourcen
bereitzustellen und gleichzeitig den Aspekt der Datensparsamkeit stärker ins Bewusstsein
zu rücken, ist für Postfächer und den persönlichen Speicher im AFS sowie in der TUCcloud
ein Grenzwert voreingestellt, das eigenständig bis zu einem gewissen Limit erhöht werden
kann. Ein Anreiz zur Datensparsamkeit wird auch durch die Kostenumlage für
Speicherressourcen der Struktureinheiten oberhalb des Grundbedarfs gesetzt.
Beim regelmäßigen Backup der Daten erfolgt eine automatische Deduplizierung und
Komprimierung. Daten von Nutzerinnen und Nutzern, deren Nutzungsberechtigung
10abgelaufen ist, werden entsprechend der Festlegungen aus den
Datenschutzbestimmungen automatisch gelöscht.
Auch die Bereitstellung von PC-Pools zählt zu den Diensten des URZ. Diese verhelfen dazu,
allen Mitgliedern und Angehörigen der TU Chemnitz einen Zugang zu nötigen (Online-
)Ressourcen zu gewähren. Neben anderen Pool-Räumen gibt es an der TU Chemnitz zwölf
PC-Räume, die durch das URZ betreut werden. Den Studierenden stehen bis zu 20 PC-
Arbeitsplätze und ein Beamer für Praktika oder eigenständiges Arbeiten zur Verfügung. Bei
der Ausstattung kommen stromsparende Desktops-CPUs und Grafikkarten ohne aktive
Kühlung zum Einsatz. Um Klimaschutz auch digital zu befördern, wird seit dem Jahr 2020
auch ecosia.org als Standard-Suchmaschine in den PC-Pools der TU Chemnitz angeboten.
Im Rahmen des GreenIT-Projektes evaluierte das URZ Anfang 2017 die Abschaltung von
Arbeitsplätzen in den öffentlichen Ausbildungspools. Diese Maßnahme ist seit geraumer
Zeit in allen vom URZ administrierten PC-Pools umgesetzt. Sofern keine Nutzerin bzw. kein
Nutzer am Arbeitsplatz angemeldet ist, erfolgt ein automatisierter Shutdown. Bei Bedarf
werden die Arbeitsplätze durch die Nutzerinnen und Nutzer vor Ort eingeschaltet. Der
Einsatz schneller und energetisch sparsamer SSD-Speicher ermöglicht dabei die
kurzfristige Betriebsbereitschaft der Arbeitsplätze.
Lokale Drucker und Scanner wurden im Zusammenhang mit dem campusweiten
Multifunktionsgeräte-Projekt aus den Poolräumen entfernt. Auch in URZ-Büros werden
diese stillgelegt. An verschiedenen Standorten auf dem Campus stehen Studierenden und
Mitarbeitenden nunmehr zentrale Multifunktionsgeräte zur Verfügung. Druckaufträge
können an die sogenannte FindMe-Queue geschickt und an einem beliebigen dieser
zentralen Drucker ausgedruckt und abgeholt werden.
Beschaffung
Beschaffungsaktivitäten sind zentrale Aufgaben einer Organisation, um diese mit Betriebs-
und Arbeitsmitteln, Dienstleistungen, Informationen, Materialien und Rechten etc. zu
versorgen. Somit kommt ihnen in einer Organisation ein zentraler Stellenwert zu. Dies gilt
auch an Universitäten. Heutzutage ist Beschaffung Teil eines modernen Versorgungs- und
Lieferkettenmanagements und in komplexe Produkt- und Logistikwelten integriert.
Beschaffungsprozesse spielen eine wegweisende Rolle in der Entwicklung zu mehr
Nachhaltigkeit.
Eine nachhaltige Beschaffung richtet ihr Augenmerk auf nachhaltige Kriterien im Rahmen
der Beschaffungsprozesse oder integriert Nachhaltigkeitskriterien in den
Vergabeunterlagen. So wird ein bedeutender Beitrag zum SDG 12.7 („In der öffentlichen
Beschaffung nachhaltige Verfahren fördern, im Einklang mit den nationalen Politiken und
Prioritäten“) geleistet und globale sowie regionale Verantwortung getragen. Um die Ziele
der Nachhaltigen Entwicklung auch in der Beschaffung zu realisieren, haben jede
11Professur und jedes Dezernat vielfältige Möglichkeiten, Beschaffungsprozesse nachhaltig
zu gestalten.
Bei der Vergabe der Rahmenvereinbarung über Büromaterial wurden unter anderem
folgende Nachhaltigkeitsaspekte gefordert:
- minimale, umweltfreundliche Verpackungen
- Rücknahme leerer Toner und Tinten
- Forderung nachhaltiger Zertifikate (Blauer Engel etc.)
- Aufnahme einer großen Auswahl an nachhaltigen Produkten (lösungsmittelfreie Produkte
etc.)
Insgesamt waren im Jahr 2020 fast 21,5 Prozent der bestellten Produkte mit dem
Umweltzeichen Blauer Engel ausgestattet, rund 7 Prozent waren FSC-zertifiziert und
3,3 Prozent waren lösungsmittelfrei.
Bei der Vergabe der Rahmenvereinbarung über Büromöbel wurden unter anderem
folgende Nachhaltigkeitsaspekte gefordert:
- Blauer Engel
- sortenreine Trennung von Kunststoff und anderen Werkstoffen
- minimale Emissionen bei Verleimung, Lackierung und Beschichtung
- professionelles Umweltmanagement nach DIN EN ISO 14001
- minimale, umweltfreundliche Verpackung
Die im Unishop derzeit angebotene Kleidung ist frei von tierischen Inhaltsstoffen und
durch das PETA-anerkannte vegane Logo gekennzeichnet. Der Herstellungsprozess vom
Garn bis zum Kleidungsstück wird dahingehend überwacht, dass in Fabriken produziert
wird, die entweder WRAP-zertifiziert (Worldwide Responsible Accredited Production) oder
Mitglieder der BSCI (Business Social Compliance Initiative) sind.
Partizipation, Gleichstellung und Familie
Einen wichtigen Teil der sozialen Nachhaltigkeit stellt die Partizipation dar. Die Teilhabe
verschiedener Stakeholder an Projekten für nachhaltige Prozesse soll deren Akzeptanz,
Verbreitung und Realisierung sicherstellen.
Das Zentrum für Chancengleichheit in Wissenschaft und Forschung an der TU Chemnitz
wurde im Jahr 2009 gegründet und wird durch die Zentrale Gleichstellungsbeauftragte,
Frau Karla Kebsch, geleitet. Neben vielen Angeboten und Projekten zur Förderung der
Gleichstellung ist die Frauenförderung an der TU Chemnitz fest in der Personalentwicklung
verankert. Vor allem Frauen in MINT-Studiengängen werden durch viele Projekte gefördert,
wie den MINT-Studentinnen-Stammtisch, das Interdisziplinäre Symposium für Frauen im
MINT-Bereich, den MINT-Wissenschaftlerinnenrat oder auch den MINT-Pakt. Daneben gibt
es das Mentoring von Schülerinnen mit Interesse an Naturwissenschaften durch Projekte
wie Girls‘ Tandem oder den BeLL-Prix für Nachwuchsforscherinnen. Mit dem Mentoring-
Programm „WoMentYou – Mit Mentoring zum Erfolg“ soll die Gleichstellung gefördert und
einem sinkenden Anteil an Frauen in steigenden Hierarchiestufen entgegenwirkt werden.
2019 beteiligte sich die TU Chemnitz wieder am Professorinnen-Programm von Bund und
Ländern. Sie erhielt als einzige Universität des Freistaates Sachsen und als eine von zehn
12Hochschulen in Deutschland den Titel „Gleichstellung: ausgezeichnet!“. Somit kann die
TU Chemnitz nun vier Professorinnen auswählen, deren unbefristete Verträge in den ersten
fünf Jahren mit jeweils bis zu 165.00 Euro gefördert werden.
Ausgehend von der UN-Behindertenrechtskonvention 2009 ist die Optimierung der
Teilnahme körperlich oder geistig beeinträchtigter Studierender und Beschäftigter am
Universitätsalltag der TU Chemnitz ein kontinuierlicher Prozess. Im Januar 2016 fand
erstmals der Tag der Inklusion statt, an welchem sich Vertreterinnen und Vertreter der
sächsischen Hochschulen zu ihren Erfahrungen austauschten und Ideen für eine
Verbesserung der Inklusion von Studierenden mit Beeinträchtigung entwickelten.
Basierend auf den 2017 entworfenen Aktionsplan „Die TU Chemnitz auf dem Weg zur
inklusiven Hochschule“ wurden konkrete Ziele und Maßnahmen festgelegt, um dem Ziel
einer barrierefreien Hochschule näher zu kommen. So wurde 2019 beispielsweise ein
Treppenlift im Nord-Bau des Universitätsteils Straße der Nationen 62 installiert.
Gegenwärtig werden laufend verschiedene Seminare und Workshops sowie
Informationsveranstaltungen zum Thema Inklusion angeboten. Barrieren aller Art werden
nach und nach abgebaut. Auch Ruhe- und Rückzugsorte werden geschaffen.
Bereits seit 2006 gilt die TU Chemnitz als „familiengerechte Hochschule“. Das Zertifikat,
das im Rahmen des „audit familiengerechte hochschule“ im Jahr 2020 erneut von der
gemeinnützigen Hertie-Stiftung bestätigt wurde und nun dauerhaften Charakter besitzt,
attestiert der Universität eine ausgeprägte Familienfreundlichkeit sowie Hilfe bei der
Vereinbarung von Familie und Beruf. Neben verschiedensten Informations- und
Beratungsangeboten schafft die TU Chemnitz Räume und Angebote für Kinder von
Angehörigen. Zudem hat sich die TU Chemnitz im Rahmen der Zielvereinbarung 2021-2024
mit dem Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus (SMWK)
zur Teilnahme am Diversity Audit „Vielfalt gestalten“ des Stifterverbands für die Deutsche
Wissenschaft e. V. verpflichtet und strebt eine entsprechende Zertifizierung an.
Bei der Suche nach einer geeigneten Kinderbetreuung unterstützt die TU Chemnitz Eltern
und Angehörige. Neben den etwa 175 Betreuungseinrichtungen für Kinder, die in Chemnitz
in kommunaler und freier Trägerschaft zur Verfügung stehen, befinden sich drei
Kooperationskindertagesstätten in unmittelbarer Nähe zu den Universitätsgebäuden.
Die Kita Waisenstraße und die Kita Krabbelkäfer gehören der Stadt Chemnitz, während die
Kita Campulino dem Studentenwerk Chemnitz-Zwickau angehört. Zusätzlich werden Eltern
durch eine stundenweise Kurzzeit-Betreuung von Kleinkindern im „Zwergencampus“ des
Studentenwerks Chemnitz-Zwickau unterstützt. Durch die Randzeitenbetreuung außerhalb
der regulären Kita-Öffnungszeiten sowie eine flexible Betreuung in den
Prüfungszeiträumen soll das Studieren mit Kleinkind erleichtert werden. Außerdem stehen
im „Zwergencampus“ Ruheräume zur Verfügung, die Eltern in Begleitung ihrer Kinder als
Rückzugsorte dienen.
Im Rahmen der Initiative „Wertschätzung im Öffentlichen Dienst des Freistaates Sachsen“
der Sächsischen Staatsregierung hat das Rektorat in Abstimmung mit dem Personalrat
sowie im Sinne der Transparenz und zur Ermöglichung einer breiten Beteiligung seitens
der Hochschulöffentlichkeit die Einrichtung einer Arbeitsgruppe „Wertschätzung im
Öffentlichen Dienst“ beschlossen. In der Arbeitsgruppe tauschen sich neben
Vertreterinnen und Vertretern des Personalrats alle Akteure, die auch im TUCforum
vertreten sind, d. h. die Vertreter und Vertreterinnen aller Struktureinheiten der TU
Chemnitz, zu sinnvollen und wünschenswerten Maßnahmen aus.
13Universitäres Gesundheitsmanagement
Die TU Chemnitz verfügt über ein umfangreiches Universitäres Gesundheitsmanagement
(UGM), das über mehrere Jahre mittels eines Kernteams aufgebaut wurde und zahlreiche
gesundheitsförderliche Angebote geschaffen hat. Dies umfasst auch den
Kooperationsvertrag zum UGM über drei Jahre zwischen der Techniker Krankenkasse
(TK) und der TU Chemnitz, der im Juli 2018 durch den Rektor unterzeichnet wurde. Der
Vertrag mit dem Schwerpunkt „Gesundheit und Führung“ beinhaltet u. a. eine Analyse zur
Ermittlung der Ist-Situation. Diese soll Aufschluss geben, welche Problemfelder vorhanden
sind und welche Angebote geschaffen werden sollten. Zur Durchführung der geplanten
Befragung der Mitarbeitenden erfolgt derzeit eine abschließende Datenschutzprüfung.
Gemeinsam mit dem Kooperationspartner der Techniker Krankenkasse wurden
unabhängig davon bereits vielfältige Angebote für Mitarbeitende der TU Chemnitz
geschaffen. Seit 2018 wird jährlich der Tag der Gesundheit durchgeführt. Zudem verfügt
die TU Chemnitz über eine große Bandbreite an Kursen und Sportangeboten, welche
möglichst viele Studierende und Mitarbeitende zu sportlichen Aktivitäten animieren sollen.
Um Mitgliedern und Angehörigen der TU Chemnitz auch in belastenden Lebenslagen
beizustehen, sind mehrere Anlaufstellen vorhanden. Die psychosoziale Beratungsstelle,
geführt von Herrn Prof. Dr. Stephan Mühlig, hilft Rat- und Hilfesuchenden unterhalb der
Schwelle zu einer psychischen Störung. Auch die Psychologische Beratung des
Studentenwerks Chemnitz-Zwickau hilft mit Beratungsgesprächen bei Krisen, Identitäts-
und Orientierungsproblemen sowie Angstsituationen.
Im Falle einer akuten psychischen Krise sowie einer psychischen Störung kann das Team
der Psychotherapeutischen Hochschulambulanz TU Chemnitz GmbH, unabhängig von
einer Zugehörigkeit zur TU Chemnitz, Unterstützung anbieten.
Liegenschaften & Betrieb
Die Bewirtschaftung der Liegenschaften der TU Chemnitz erfolgt größtenteils über den
Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB). Zudem bestimmen
Dienstbarkeitsvereinbarungen zwischen SIB, der Stadt Chemnitz, der TU Chemnitz sowie
dem Studentenwerk Chemnitz-Zwickau die Bewirtschaftung und den Betrieb einzelner
Flächen des gesamten Campusplatzes. Die Liegenschaften und Räumlichkeiten der TU
Chemnitz sind auf vier Universitätsteile stadtweit verteilt: Am Campus in der Reichenhainer
Straße befinden sich neben mehreren Hörsaalgebäuden das Studentenwerk Chemnitz-
Zwickau, der Student_innenrat, mehrere Fakultäten sowie die Mensa mit Räumlichkeiten,
die zum Lernen und Entspannen einladen. Die Universitätsleitung, einige
Verwaltungsbereiche, weitere Fakultäten, das Internationale Universitätszentrum und das
Universitätsrechenzentrum befinden sich an der Straße der Nationen, nahe dem
Hauptbahnhof. Die Erfenschlager Straße beherbergt Teile der Fakultät für Maschinenbau.
In der Wilhelm-Raabe-Straße befindet sich das Institut für Psychologie.
14Durch den SIB wurde ein Masterplan-Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung des
Campus Reichenhainer Straße der TU Chemnitz durchgeführt. Am 2. April 2019 wurde der
Gewinnerentwurf der Öffentlichkeit präsentiert und diskutiert. Es werden kooperativ
weitere bauliche Maßnahmen kurz- bis mittelfristig realisiert.
Energie und Wasser 1
Aufgrund des Rahmenvertrages mit dem SIB deckte die TU Chemnitz im Jahr 2019
weniger als die Hälfte ihrer Verbräuche mit nicht erneuerbaren Energien ab, wie
Kohle (28,3 Prozent), Erdgas (7,8 Prozent), Kernenergie (7,1 Prozent) und sonstigen
fossilen Energieträgern (1,0 Prozent). 55,9 Prozent wurden durch erneuerbare Energien
gedeckt. Dieser Anteil soll weiter steigen, und zukünftig soll die Stromversorgung komplett
mit Grünstrom gedeckt werden - geplant ab dem 1. Januar 2023. Der absolute
Stromverbrauch nahm bis 2018 stetig ab und stieg 2019 wieder leicht an (vgl. Tabelle 1).
Der Frischwasserverbrauch hat sich über die Jahre erhöht, hier gab es einen Anstieg von
ca. 33 Prozent, ebenfalls von 2018 auf 2019. Ursächlich für den Anstieg des Strom- und
Wasserverbrauches ist die Inbetriebnahme der neuen VE-Wasseranlage im
Forschungsgebäude MAIN (Zentrum für Materialien, Architekturen und Integration von
Nanomembranen).
Tabelle 1: Übersicht über Verbräuche der TU Chemnitz (2014-2019)
Quelle: Dezernat Bauwesen und Technik
Jahr 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Strom 21.567,60 21.548,80 19.704,80 19.557,50 18.948,90 19.548,20
[MWh]
Frisch- 27.514,60 28.059,00 25.811,70 15.616,00 36.107,60 48.243,00
wasser
[m³]
Verschiedene Energieeffizienzmaßnahmen sind in Planung, um Verbräuche zu
reduzieren. So soll in Zukunft schrittweise von der alten, ineffizienten Beleuchtung auf
LED-Lampen umgerüstet werden, die eine längere Lebensdauer und einen geringeren
Energieverbrauch aufweisen. Außerdem sollen die bereits verwendeten
Heizköperthermostate optimiert werden. Durch die Absenkung bzw. Abschaltung von Heiz-
und Lüftungsanlagen wird außerhalb der regulären Betriebszeiten Heizenergie gespart.
Außerhalb der Betriebszeiten wird zudem Energie eingespart durch Abschalten des Lichts
in Büro- und Verwaltungsbereichen sowie Abschalten von Büroequipment, wie Drucker,
Kaffeemaschinen oder Wasserkocher.
Wärme
Die Gebäude der TU Chemnitz sind flächendeckend an die Fernwärmeversorgung der
Stadt Chemnitz angeschlossen. Die Fernwärme wird zu über 97 Prozent aus Kraft-Wärme-
1
Aufgrund zahlreicher Veranstaltung mit externen Gästen in den Gebäuden der TU Chemnitz wurde
bewusst auf das Aufzeigen der Verbräuche pro Kopf verzichtet.
15Kopplung erzeugt und ist mit einem Primärenergiefaktor von 0,70 zertifiziert. Der
Erdgasverbrauch ist in den letzten Jahren stark gesunken. 2014 wurden noch rund 45.000
m³ verbraucht, 2019 waren es nur noch 8,8 m³. Dies lässt sich durch den bis 2017
vollzogenen flächendeckenden Anschluss der Universitätsgebäude an die Chemnitzer
Fernwärmeversorgung erklären.
Auch der Fernwärmeverbrauch ist generell von 2014 bis 2019 leicht gesunken. Von 2018
auf 2019 gab es einen kleinen Anstieg von 0,8 Prozent.
Abfallentsorgung
Die Müll- und Abfallentsorgung liegt grundsätzlich in der Zuständigkeit des SIB.
Der Papierverbrauch der TU Chemnitz nahm im Laufe der letzten Jahre leicht ab. Hier
macht sich die Digitalisierung verschiedener Prozesse bemerkbar (vgl. Abbildung 5).
60
50
40
30
20
10
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Abbildung 5: Papier- und Pappeabfall der TU Chemnitz in Tonnen (2014-2020)
Senkrechte Achse: Tonnen, Waagerechte Achse: Jahre.
Quelle: Dezernat Bauwesen und Technik, Eigene Darstellung
16Auch die Menge an gemischten Siedlungsabfällen (Restabfall) ist leicht zurückgegangen
(vgl. Abbildung 6).
140
120
100
80
60
40
20
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Abbildung 6: Restabfall der TU Chemnitz in Tonnen (2014-2020)
Senkrechte Achse: Tonnen, Waagerechte Achse: Jahre.
Quelle: Dezernat Bauwesen und Technik, Eigene Darstellung
Perspektivisch sollen die Abfallerzeugungen stark minimiert werden. Durch ein besseres
Trennen der Fraktionen soll ein höherer Recyclinganteil ermöglicht werden. Zusätzlich
möchte die TU Chemnitz die Abfallvermeidung stärker in das Bewusstsein von
Mitarbeitenden und Studierenden bringen.
Um eine Mülltrennung zu erleichtern, ist in den Gebäuden der TU Chemnitz ein
umfangreiches Mülltrennsystem im Einsatz. Die eingesetzten Müllorgeln, mehrfächrige
Mülltrennsysteme, werden von den Mitgliedern und Angehörigen der TU Chemnitz gut
angenommen und rege genutzt.
17Dieses Werk - mit Ausnahme von Logos und anderem Material Dritter - steht unter
einer Creative-Commons-Lizenz "Namensnennung 4.0 International", die die
Nutzung, Weitergabe, Anpassung, Verbreitung und Vervielfältigung in jedem Medium
oder Format gestattet, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle
angemessen nennen, einen Link zur Creative-Commons-Lizenz enfügen und
angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Die Bilder sind in der Creative-
Commons-Lizenz enthalten, es sei denn, es wird zum Material anders angegeben.
Wenn das Material nicht in der Creative-Commons-Lizenz enthalten ist und Ihre
beabsichtigte Nutzung nicht durch gesetzliche Bestimmungen erlaubt ist oder über
die erlaubte Nutzung hinausgeht, müssen Sie die Erlaubnis direkt beim
Urheberrechtsinhaber einholen. Eine Kopie dieser Lizenz können Sie unter
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ einsehen.
18Sie können auch lesen