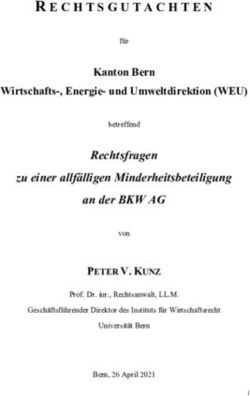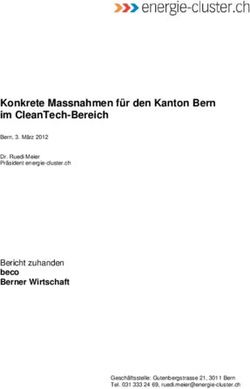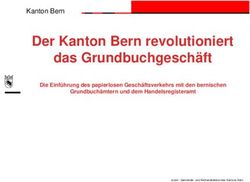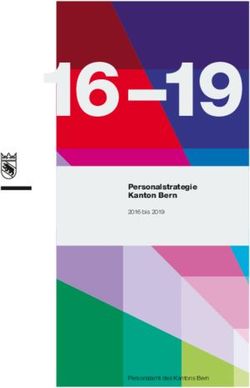Naturnahe Quellen im Kanton Bern - Erfassen - erhalten - aufwerten - UNA - Atelier für ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Naturnahe Quellen im Kanton Bern
Erfassen – erhalten – aufwerten
Bern, Februar 2018
UNA - Atelier für Naturschutz und Umweltfragen, Schwarzenburgstr. 11, 3007 Bern
Im Auftrag von:Impressum
Auftraggeber Pro Natura Bern
Kontakt: Jan Ryser
Schwarzenburgstrasse 11
3007 Bern
pronatura-be@pronatura.ch
031 352 66 00
www.pronatura-be.ch
Projektleiter UNA AG, Bern
Kontakt: Christian Imesch
UNA AG
Schwarzenburgstrasse 11
3007 Bern
imesch@unabern.ch
031 310 83 86
www.unabern.ch
Finanzierung BKW Ökofonds
Ökofonds Energie Thun AG
Naturemade star Ökofonds ewb
Pro Natura
interne Projektnummer: 2383Naturnahe Quellen im Kanton Bern
Inhaltsverzeichnis
1. Zusammenfassung 5
2. Ausgangslage 8
2.1 Quellen in der Schweiz und im Kanton Bern 9
3. Auftrag und Ziele 10
3.1 Auftrag 10
3.1.1 Projektperimeter 10
3.2 Ziele 11
4. Vorgehen 12
4.1 Beurteilung von Quellen 12
4.1.1 Freiwillige Helfer 12
4.1.2 Standorte von Quellen ermitteln 12
4.1.3 Beurteilungsmethoden 13
4.2 Sensibilisierung 13
4.3 Massnahmen zum Erhalt von Quellen 13
4.4 Revitalisierung stillgelegter Wasserfassungen 13
5. Resultate 14
5.1 Untersuchte Quellen 14
5.2 Perimeter und untersuchte Gemeinden 14
5.3 Zustand des Quell-Lebensraumes 15
5.3.1 Beeinträchtigungen 16
5.3.2 Zustand der Quell-Lebensräume mit erweitertem Datensatz 17
5.3.3 Zustand der Quell-Lebensräume nach Höhenlagen 19
5.3.4 Revitalisierungspotential 19
5.3.5 Zustand der Quellbäche 20
5.4 Standort von Quellen 20
5.5 Austrittsform von Quellen 22
5.6 Schüttungsmenge und Grösse von Quellen 24
5.7 Substrate und Artenvielfalt 27
5.7.1 Substrate der Quell-Lebensräume 27
5.7.2 Artenvielfalt von Quellen 28
5.8 Quellen in Inventargebieten 30
5.9 Aufwand der Feldmitarbeiterinnen 30
6. Fallbeispiele 31
6.1 Typische Sturzquelle, Rheokrene 31
6.2 Typische Sickerquelle, Helokrene 32
6.3 Typische Weiherquelle, Limnokrene 33
6.4 Beeinträchtigte Quelle im Wald 34
6.5 Beeinträchtigte Quelle im Offenland 35
7. Interpretation 36
Februar 2018 Atelier für Naturschutz und Umweltfragen 3Naturnahe Quellen im Kanton Bern
8. Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung 38
8.1 Schulungen 38
8.2 Flyer 38
8.2.1 Versand des Quellenflyers 38
8.3 Medientätigkeiten 39
9. Ausblick 40
9.1 Handlungsbedarf 40
9.1.1 Eingriffe in den Quell-Lebensraum vermeiden 41
9.1.2 Sensibilisierung 42
9.1.3 Arbeitsgruppe Quellen 42
9.1.4 Revitalisierungen 42
9.1.5 Instrumente zum Schutz von Quellen 43
9.1.6 Erfassen weiterer Quellen 44
9.2 Zuständigkeiten 44
9.3 Beabsichtigte Arbeitsschritte von Pro Natura Bern 46
10. Literaturverzeichnis 47
11. Anhang 49
11.1 Beispiel eines Feldplans 49
11.2 Kartieranleitung "Berner Methode" 49
11.3 Erhebungsformular "Berner Methode" 49
11.4 Geographische Darstellung des Kartierungsstandes der
Gemeinden 49
11.5 Tabelle Kartierungsstand der Gemeinden 49
11.6 Übersichtspläne der Quellen der Regionen Jura, Mittelland,
Voralpen und Nordalpen 49
11.7 Tabelle mit Quellen in Nationalen Inventargebieten 49
11.8 Revitalisierung stillgelegter Wasserfassungen 49
11.9 Flyer 49
Februar 2018 Atelier für Naturschutz und Umweltfragen 4Naturnahe Quellen im Kanton Bern
1. Zusammenfassung
Quell-Lebensräume sind in der Vergangenheit stark in Mitleidenschaft gezogen
worden. Sie sind meistens gefasst oder beeinträchtigt. Pro Natura Bern beabsichtigt
mit diesem Projekt, den Wissensstand zu den Quellen im Kanton Bern zu verbessern.
27 Freiwillige haben während den letzten zwei Jahren 1130 Quellen begangen und
bezüglich der Lebensraumqualität beurteilt.
Die Analyse des Quellzustandes zeigt deutlich auf, wie stark Quell-Lebensräume
beeinträchtigt und verbaut sind. Zwei Drittel der Quellen im Projektperimeter sind für
die Trinkwassernutzung gefasst, rund jeweils 10 Prozent zerstört oder beeinträchtigt
und nur gerade 13 Prozent in einem natürlichen Zustand. In den Alpen ist die Anzahl
gefasster Quellen geringer als in anderen Regionen.
Quellen befinden sich hauptsächlich im Wald, wo sie öfter als in anderen
Landschaftstypen noch natürlich aus dem Boden sprudeln. Im Offenland hingegen
sind sie insbesondere im Jura und dem Mittelland gefasst oder zerstört, in den
Voralpen und Alpen vor allem durch Viehtritt und Holzabfällen beeinträchtigt.
Allgemein lässt sich sagen, dass der Zustand der Quell-Lebensräume in den Voralpen
und Alpen weniger schlecht als in anderen Region ist; Abbildung 1.
100%
2 20 21
90%
207 21
24
80%
3
70% 20 97
52
60% 188 79
25
50%
31
40%
10
30% 6 24
20% 319 31 58
47
10% 6 27 14
0%
Offenland Wald Offenland Wald Offenland Wald Offenland Wald
Jura Mittelland Voralpen Nordalpen
nat•ürlich beeinträchtigt zerstört / gefasst
Abbildung 1: Zustand von Quellen nach Region und Landnutzung (Offenland/Wald). In
den Balken ist die Anzahl Quellen vermerkt. Die Daten umfassen nur die im Rahmen
des Projektes untersuchten Quellen, ohne Daten der gefassten Quellen des Kantons.
Februar 2018 Atelier für Naturschutz und Umweltfragen 5Naturnahe Quellen im Kanton Bern
Über zahlreiche Kanäle haben wir den Zustand von Quell-Lebensräumen und deren
Bedrohung an die Bevölkerung, Förster und Landwirte getragen. Zusätzlich
beschreiben wir in einem Flyer die Eigenschaften und Massnahmen zum Schutz von
Quellen.
Pro Natura Bern will sich in Zukunft weiterhin dem Thema Quellen widmen und
beabsichtigt, nach dieser Phase der Informationsbeschaffung konkrete Massnahmen
umzusetzen. Auf den drei Ebenen Sensibilisierung, Revitalisierung und
Schutzinstrumente will man aktiv bleiben.
Abbildung 2: Kalkquelle im Diemtigtal
Durch die Beratung von Landwirten und Forstmitarbeitern können Beeinträchtigungen
von Quellen (z.B. Viehtritt, Tränken, Asthaufen, Rückegassen) vermieden werden. Vor
allem in den Voralpen und Alpen, wo viele Quellen "nur" beeinträchtigt sind, wird
dadurch, mit relativ wenig Aufwand, die Qualität des Lebensraumes verbessert.
Oftmals wissen Gemeindebehörden nicht über die Lage von Quellen Bescheid.
Übersichtspläne und Angaben zum Zustand der Quell-Lebensräume sollen
Gemeinden als Instrument dienen, um bei möglichen Bauprojekten den Erhalt von
Quellen zu gewährleisten.
Um die vom Aussterben bedrohte Artenvielfalt von Quellen zu fördern, sind dringend
Revitalisierungen notwendig. Ein grosses Potential sehen wir bei stillgelegten
Trinkwasserfassungen, deren Wasser in einem Rohr direkt in das nächste Gewässer
geleitet wird. Durch das Aufbrechen der Fassung könnte sich wieder ein intakter
Lebensraum entwickeln. Bei grossen Quellen und solchen mit einer starken Schüttung
kann der Rückbau von Verbauungen zu einem grossen Mehrwert führen.
Pro Natura Bern will aber auch intakte Quellen erhalten und den Trend zu deren
Vernachlässigung stoppen. Wir beabsichtigen, uns beim Kanton und den Gemeinden
für den Schutz herausragender Quellen einzusetzen, damit
Februar 2018 Atelier für Naturschutz und Umweltfragen 6Naturnahe Quellen im Kanton Bern
Bewirtschaftungsvereinbarungen abgeschlossen werden und Quellen in die
Schutzzonenpläne der Gemeinden Einzug finden.
Mit einem Strauss an Massnahmen wollen wir erreichen, dass Quellen als seltener
Lebensraum wahrgenommen werden, deren weitere Zerstörung vermieden wird und
degradierte Lebensräume wieder aufgewertet werden.
Pro Natura Bern bedankt sich bei allen Freiwilligen für deren grossen Einsatz zur
Erfassung von Quellen. Ohne deren Unterstützung könnten wir die Förderung dieses
Lebensraumes nicht weiter voranbringen. Dem Gewässer- und Bodenschutzlabor des
Kantons Bern danken wir für die Verwaltung der Quellendatenbank. Ein grosser Dank
geht auch an die Geldgeber des Projekts, die drei Ökofonds von BKW, ewb und
Energie Thun AG.
Februar 2018 Atelier für Naturschutz und Umweltfragen 7Naturnahe Quellen im Kanton Bern
2. Ausgangslage
Quellen faszinieren – sie sind Orte, an denen Grundwasser aus dem Boden dringt
und aus dem «Nichts» ein Gewässer entsteht. Die Erscheinungsformen von Quellen
sind vielfältig und variieren von überrieselten Kalksinter-Terrassen über sprudelnde
punktuelle Austritte, flachmoorartige Quellsümpfe bis zu kristallklaren Weihern.
Quellen als Hotspots der Artenvielfalt:
Quellen bilden den Übergangsbereich zwischen Grundwasser und Oberflächen-
gewässer. Spezielle, konstante Lebensraumbedingungen (z.B. bezüglich
Wassertemperatur und Sauerstoffgehalt) bewirken, dass Quellen eine einzigartige
Tierwelt beherbergen. Feuersalamander, Quelljungfern (Libellenart) und etliche
Köcher-, Stein- und Eintagsfliegenarten sowie weitere Arten haben sich auf den
Lebensraum Quelle spezialisiert. Viele davon sind National Prioritäre Arten, die auch
gemäss der Roten Liste gefährdet sind. Die Artenvielfalt von Quellen ist gegenüber
äusseren Einflüssen sehr sensibel.
Quellen, ein mystischer Ort:
Seit jeher üben Quellen eine magische Anziehungskraft auf Menschen aus. Quellen
sind Kraftorte, wurden als Sitz von Gottheiten und mystischen Wesen betrachtet und
galten früher als Schnittstelle zwischen ober- und unterirdischer Welt. Quellen werden
bei der Bevölkerung zudem als Sinnbild für Leben und Reinheit positiv
wahrgenommen und eignen sich deshalb gut für Öffentlichkeitskampagnen.
Quellen und deren Bedrohung:
Quellen und ihre Lebensgemeinschaften sind heute in höchstem Masse gefährdet
(alle Quell-Lebensräume sind in der Liste der National Prioritären Lebensräume der
Schweiz mit der Gefährdungsstufe «vom Verschwinden bedroht» aufgeführt, in der
Roten Liste der Lebensräume sind Kalkquellfluren mit "vom Aussterben bedroht" auf
der höchsten Gefährdungsstufe). Sie werden infolge Siedlungsentwicklung,
Gewässerkorrektionen, Landwirtschaft und Wassernutzung gefasst, degradiert oder
verschmutzt. Über drei Viertel der Quellen sind eingedolt und wohl weniger als 1%
sind im Mittelland noch in natürlichem Zustand (Zollhöfer, 1997). Standorte von
Quellen sind häufig nicht bekannt oder dokumentiert und werden daher bei der
Planung von Bauprojekten nicht berücksichtigt. Das führt dazu, dass sie unwissentlich
degradiert oder deren Schutzwürdigkeit nicht konsequent beachtet wird.
Für Bewirtschafter (Land- und Forstwirtschaft) gibt es keine Regelungen /
Informationen über den Umgang mit natürlichen Quellstandorten.
Weiter ist zu befürchten, dass durch die Klimaerwärmung und trockenen Sommer der
Druck auf die Quellen steigt, z.B. durch vermehrte Nutzung zur Bewässerung
landwirtschaftlicher Kulturen während Trockenperioden.
Pro Natura Bern hat den Verlust des Lebensraumes Quelle erkannt und will für deren
Bedeutung und Gefährdung sensibilisieren, insbesondere bei Gemeindebehörden und
Februar 2018 Atelier für Naturschutz und Umweltfragen 8Naturnahe Quellen im Kanton Bern
direkt Betroffenen. Für die Inventararbeiten wurde ein Citizen Science Ansatz gewählt,
wobei Privatpersonen ehrenamtlich wissenschaftliche Daten erheben.
2.1 Quellen in der Schweiz und im Kanton Bern
In der Vergangenheit sind viele Quellen gefasst oder beeinträchtigt worden. Gründe
dafür sind v.a. Fassungen für die Trinkwassernutzung, Entwässerungen in der
Landwirtschaft (Fassungen und Umleitungen), Viehtritt oder Nährstoffeinträge
(Zollhöfer, 1997). Natürliche Quellaustritte kommen heute nur noch isoliert vor. Viele
quellspezifische Arten sind in der Folge vom Aussterben bedroht.
Untersuchungen im Aargauer Mittelland haben ergeben, dass noch rund 0.5% (!) der
Quellen in einem natürlichen Zustand sind. Alle anderen sind entweder gefasst oder
aufgrund von Verbauungen beeinträchtigt (Zollhöfer, 1997). Insbesondere in der
offenen, nicht bewaldeten Landschaft ist der Lebensraum Quelle nur noch sehr selten
aufzufinden.
Dass die Bedeutung der Quellen wieder vermehrt erkannt wird, zeigt das Engagement
verschiedener Instanzen. So setzt sich beispielsweise das Bundesamt für Umwelt
(BAFU) mit der neu entwickelten Erhebungs- und Entwicklungsmethode sowie einer
Inventarisierungsmethode stark für Quellen ein (Lubini-Ferlin, et al., 2016). Mit dem
Projekt „Empfindlichkeit von Quell-Lebensräumen gegenüber Klimaveränderungen in
den Alpen“ untersucht das BAFU die sich abzeichnenden Veränderungen. Und der
Kanton Bern (Amt für Wasser und Abfall, AWA) hat eine einfache Methode entwickelt,
um die Struktur von Quelllebensräumen rasch zu beurteilen. Diese Methode bildet die
Grundlage für flächendeckende Aufnahmen von ganzen Gebieten. Gleichzeitig hat
das AWA eine Datenbank entwickelt, die alle Angaben über naturnahe Quellen
vereint.
Abbildung 3: Weiherquelle in den Voralpen
Februar 2018 Atelier für Naturschutz und Umweltfragen 9Naturnahe Quellen im Kanton Bern
3. Auftrag und Ziele
3.1 Auftrag
Da die Datengrundlagen zu naturnahen Quellen spärlich sind, sollten in einem ersten
Schritt Daten zur Lage und zum Zustand von Quellen gewonnen werden. Weiter
sollten Behörden und direkt betroffene Akteure wie Landwirte, Förster und
Grundeigentümer zum Thema Quellen und ihre Bedeutung und Gefährdung
sensibilisiert werden.
Für Quellen, die aufgrund ihrer Grösse und Strukturvielfalt für die bedrohten,
standortspezifischen Quellarten eine besondere Bedeutung einnehmen können,
sollten Massnahmen zum Erhalt und Aufwertung geprüft werden.
3.1.1 Projektperimeter
Um Aussagen zum Zustand von Quellen in Abhängigkeit der geographischen Lage
machen zu können, wurden Gemeinden unterschiedlicher Regionen untersucht.
90 Gemeinden befinden sich im Perimeter des Quellenprojektes. Die Gemeinden
lassen sich den 4 biogeografischen Regionen Jura, Mittelland, Voralpen und
Nordalpen zuordnen.
Tabelle 1: Biogeografische Regionen
Biogeografische Region Anzahl Gemeinden
Jura 6
Mittelland 55
Voralpen 22
Nordalpen 7
Februar 2018 Atelier für Naturschutz und Umweltfragen 10Naturnahe Quellen im Kanton Bern
Abbildung 4: Projektperimeter mit biogeografischer Regionen. Gelb: Jura, orange:
Mittelland, rot: Voralpen, blau: Nordalpen
3.2 Ziele
Das Projekt verfolgt folgende Ziele:
1. Quellen-Inventar: Kenntnisstand über vorhandene Quellen inkl. Quellbach in
verschiedenen Regionen des Kantons Bern verbessern.
2. Sensibilisierung: Öffentlichkeit, speziell Förster/Waldbesitzer und Landwirte für
die Bedeutung und Gefährdung der naturnahen Quellen sensibilisieren.
Gemeindebehörden über Vorkommen von natürlichen Quellen informieren und
sensibilisieren.
3. Schutz und Aufwertung von Quellen: Schutz, Erhalt und/oder Aufwertung der
wichtigsten naturnahen Quellen prüfen.
4. Revitalisierung stillgelegter Wasserfassungen: Möglichkeiten zur
Revitalisierung von stillgelegten Wasserfassungen prüfen.
Februar 2018 Atelier für Naturschutz und Umweltfragen 11Naturnahe Quellen im Kanton Bern
4. Vorgehen
4.1 Beurteilung von Quellen
In einem derart grossen Projektperimeter ist eine grosse Menge an Datengrundlagen
von Quell-Lebensräumen nur durch freiwillige Helfer zu generieren. Abbildung 5 zeigt
den Arbeitsverlauf von der Datensammlung von Quell-Standorten bis zur Entwicklung
von Massnahmen zum Erhalt von Quellen.
Abbildung 5: Schematische Darstellung des Projektablaufes
4.1.1 Freiwillige Helfer
Freiwillige waren vor allem unter den Mitgliedern von NGOs zu finden. In den lokalen
Magazinen und mittels Versand von Mails, sind Mitglieder von Pro Natura, dem WWF,
von Vogelschutz-Vereinen und dem Verein Smaragdgebiet Oberaargau
angeschrieben worden.
4.1.2 Standorte von Quellen ermitteln
Umfragen: An Gemeinden und Förster wurden Pläne verschickt, auf
denen bekannte, natürliche Quellen einzuzeichnen waren.
Nationale Datenbanken: Konsultation der Listen für Gefässpflanzen, Moose,
Steinfliegen und Köcherfliegen bei Info Species. Funddaten
von quelltypischen Arten wurden als potentieller
Quellstandort aufgenommen.
Februar 2018 Atelier für Naturschutz und Umweltfragen 12Naturnahe Quellen im Kanton Bern
Analyse von GIS Daten: Alle Gewässeranfänge aus dem Gewässer Shapefile GN5
sind als Punkte markiert worden und als potentielle
Quellstandorte eingestuft.
Aus OL-Karten sind markierte Quellen übertragen worden
Aus den oben genannten Grundlagen sind für die Feldaufnahmen rund 10'000
potenzielle Quellstandorte zusammengetragen und auf Plänen im Massstab 1:10'000
dargestellt worden. Ein Beispiel eines Feldplans befindet sich im Anhang.
4.1.3 Beurteilungsmethoden
Die Quellen wurden mit der «Berner Methode» beurteilt. Diese Methode entspricht
einer einfachen Struktur-Beurteilungsmethode, die sich als geeignet für geschulte
Laien erweist. Mit dieser Methode werden folgende Parameter untersucht:
Koordinaten, Zustand Lebensraum, Standort, Revitalisierungspotential, Austrittsform
der Quelle, Schüttung, Grösse, Angaben zum Quellbach, Substrat und Artengruppen;
siehe Anhang. Die erhobenen Daten werden in der Datenbank des Gewässer- und
Bodenschutzlabors im AWA zentral verwaltet.
4.2 Sensibilisierung
Zur Sensibilisierung für das Thema wurde ein Flyer kreiert und an wichtige Akteure
versandt, sowie Medienartikel verfasst.
4.3 Massnahmen zum Erhalt von Quellen
Aus der bekannten Literatur und vorliegenden Berichten von Quellenprojekten sind
Massnahmen zum Erhalt von Quellen abgeleitet worden.
4.4 Revitalisierung stillgelegter Wasserfassungen
Bei der Entwicklung von Massnahmen zur Revitalisierung stillgelegter
Wasserfassungen haben wir mit dem AWA, Bereich Siedlungswasserwirtschaft,
zusammengearbeitet. Dieses entwickelte eine Methodik zur Priorisierung von
Revitalisierungsobjekten. Leider konnte aufgrund von Verzögerungen auf Seiten
Kanton die Planung nicht wunschgemäss weitergeführt werden. Die weiteren Schritte
sind jedoch aufgegleist.
Februar 2018 Atelier für Naturschutz und Umweltfragen 13Naturnahe Quellen im Kanton Bern
5. Resultate
5.1 Untersuchte Quellen
Im Rahmen des Pro Natura Quellenprojektes haben insgesamt 27 Freiwillige 1130
Quellen besucht und beurteilt. Für die Evaluation der Quell-Daten haben wir
zusätzlich noch alle Quellen, die bereits in der GBL-Quelldatenbank erfasst waren und
im Projektperimeter liegen, verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, dienen als
Datengrundlage bei den Auswertungen ca. 1500 Quellen.
5.2 Perimeter und untersuchte Gemeinden
Von den 90 Gemeinden des Projektperimeters sind 38, gemäss abgegebenen
Feldunterlagen, vollständig beurteilt worden. Das heisst, dass alle angezeigten
Quellpunkte einer Gemeinde besucht wurden. Für fast die Hälfte aller Gemeinden ist
ein grosser Teil der potentiellen Quellstandorte erfasst worden (blau und grün);
Abbildung 6. Im Verlaufe des Projektes alle Gemeinden vollständig zu kartieren, war
nicht Bestandteil der Zielformulierung. Vielmehr sollte ein Überblick über den Zustand
und die Verbreitung von naturnahen Quellaustritten in unterschiedlichen Regionen
des Kantons Bern gewonnen werden. Insofern konnten wir genügend Daten aus den
verschiedenen biogeographischen Regionen Jura, Mittelland, Voralpen und
Nordalpen gewinnen, um Vergleiche anzustellen. Total liegen für diese
Untersuchungen von 68 Gemeinden Angaben zu Quellen vor. Der Stand der
Beurteilung von Quellen ist dem Anhang zu entnehmen.
22
38
11
14 5
Abbildung 6: Anteil kartierter Quellen pro Gemeinde
Die Zahlen innerhalb des Diagramms geben die Anzahl Gemeinden an. Farblegende:
blau: vollständig kartiert, grün: über 75% der potentiellen Quellen kartiert. Gelb: 25 –
75% der Quellen kartiert, orange: weniger als 25% kartiert, rot: keine Kartierung.
Februar 2018 Atelier für Naturschutz und Umweltfragen 14Naturnahe Quellen im Kanton Bern
5.3 Zustand des Quell-Lebensraumes
Bei den Aufnahmen ging es darum, vor allem jene Quellen anzuschauen, von denen
man ausging, sie seien noch in einem natürlichen Zustand.
Als wichtigstes Kriterium bei der Beurteilung von Quellen nach der "Berner Methode"
gilt der Zustand von Quellen. Hier wird zwischen folgenden Zuständen unterschieden:
▪ Natürlich: Der Quell-Lebensraum ist nicht beeinträchtigt.
▪ Beeinträchtigt: Der Quell-Lebensraum ist beeinträchtigt, aber noch vorhanden.
Hierzu zählen auch Fassungen mit Überlauf, bei denen zumindest eine Teilmenge
des Wassers natürlich abfliesst und sich ein Quell-Lebensraum bildet. Als
Beeinträchtigungen gelten Verbauungen jeglicher Art, Brunnen, Viehtränken,
Wege, Trittschäden, Abfälle, Holzdepots.
▪ Zerstört: Die gesamte Quelle ist durch eine Brunnstube, einen Brunnen, eine
Viehtränke, ein Becken/Rohr etc. gefasst, durch Schäden komplett zerstört oder
nicht mehr existent. Es gibt keinen Überlauf, oder falls einer besteht, bildet sich
kein natürlicher Quell-Lebensraum (Rohrauslauf einer Fassung wird direkt in den
Bach geleitet).
▪ Gefasst: Die Quelle ist gefasst. Es besteht kein Überlauf und keine Einleitung in
einen unmittelbar angrenzenden Bach.
132
519
348
427
natürlich beeinträchtigt zerstört gefasst
Abbildung 7: Zustand der Quellen. n = 1426.
Die Abbildung 7 zeigt auf, dass rund ein Drittel aller Quellen einen naturnahen Quell-
Lebensraum haben, ein weiteres Drittel sind beeinträchtigt und bei einem Drittel der
untersuchten Quellen ist der Quell-Lebensraum zerstört oder die Quelle ist gefasst.
Februar 2018 Atelier für Naturschutz und Umweltfragen 15Naturnahe Quellen im Kanton Bern
5.3.1 Beeinträchtigungen
Die häufigsten Beeinträchtigungen von Quell-Lebensräumen treten in Form eines
Rohrs auf (Wasserableitung). Diese Art von Beeinträchtigung führt in den meisten
Fällen zur Beurteilung "zerstörter Quell-Lebensraum". Die hohe Anzahl Fassungen
überrascht, da man bei der Auswahl der Quellen von potentiell noch intakten Quellen
ausgegangen war. Von den beurteilten Quellen weisen 13 % (192 Quellen)
Abfallablagerungen in Form von Holzdepots im Quell-Lebensraum auf. Es handelt
sich dabei um einen bedeutenden Faktor, der den Lebensraum negativ beeinflusst.
Ins Gewicht fallen ausserdem Beeinträchtigungen durch Trittschäden von
Viehbeständen, die direkten Zugang zu Quellen haben.
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Rohr
Holzabfall
Viehtränke
befestigter Weg
Brunnen
Abfall
Fassung
Trittschäden
unbefestigter Weg
Abbildung 8: Beeinträchtigungen von Quell-Lebensräumen. Pro Quelle sind gemäss
Anleitung "Berner Methode" Mehrfachnennungen möglich.
Februar 2018 Atelier für Naturschutz und Umweltfragen 16Naturnahe Quellen im Kanton Bern
Abbildung 9: Beeinträchtigter Quell-Lebensraum im Mittelland
5.3.2 Zustand der Quell-Lebensräume mit erweitertem Datensatz
Zieht man bei der Evaluation des Quellzustandes auch die in der
Gewässerschutzkarte des Kantons Bern (GSK25) enthaltenen, gefassten Quellen
hinzu, so zeichnet sich für die Quellen im Projektperimeter ein noch dramatischeres
Bild ab. Aufgeteilt auf die Regionen sind im Jura 49, im Mittelland 1888, in den
Voralpen 376 und den Nordalpen 208 Quellen gefasst. Der Anteil natürlicher
Quellaustritte beträgt in Anbetracht dieser Daten nur noch 13 % (Abbildung 10).
Hingegen sind Dreiviertel der Quellen gefasst oder haben einen zerstörten
Lebensraum.
Februar 2018 Atelier für Naturschutz und Umweltfragen 17Naturnahe Quellen im Kanton Bern
519; 13%
427; 11%
348; 9%
2653; 67%
natürlich beeinträchtigt zerstört gefasst
Abbildung 10: Zustand des Quell-Lebensraums inkl. gefasste Quellen aus dem
GSK25
Der Anteil gefasster Quellen ist im Mittelland und den Voralpen mit über 70 % am
grössten. Im Jura und den Nordalpen beträgt deren Anteil unter 55%. Auch kommen
in den Nordalpen anteilsmässig am meisten naturnahe Quell-Lebensräume vor. Man
kann daraus schliessen, dass in schwer zugänglichen Gebieten weniger gefasste
Quellen vorkommen. Ein Grund kann auch der geringere Bedarf an Trinkwasser
aufgrund der geringeren Siedlungsdichte sein. Der Druck auf Quellen ist in stärker
besiedelten Gebieten wie dem Mittelland und den Voralpen grösser. Übersichtspläne
der vier biogeographischen Regionen befinden sich im Anhang.
100%
90%
80%
248
70% 58
1955 392
60%
50% 29
40%
18 139
30%
270 31
20% 9
223 56
10% 16 105
349 49
0%
Jura Mittelland Voralpen Nordalpen
natürlich beeinträchtigt zerstört gefasst
Abbildung 11: Zustand von Quellen aufgeteilt nach Regionen inkl. gefasste Quellen
aus dem GSK25. Im Diagramm ist die Anzahl der untersuchten Quellen erwähnt.
Februar 2018 Atelier für Naturschutz und Umweltfragen 18Naturnahe Quellen im Kanton Bern
5.3.3 Zustand der Quell-Lebensräume nach Höhenlagen
Der Anteil natürlicher Quellaustritte unterscheidet sich nach deren Höhenlagen nur
geringfügig zwischen 28 und 43 %; Abbildung 12. In der Höhenlage zwischen 600 und
799 Metern befinden sich die meisten zerstörten Quellen. Die meisten dieser Quellen
sind der Region Mittelland zuzuordnen, wo der Siedlungs- und Landwirtschaftsdruck
am höchsten ist. Quell-Lebensräume oberhalb 1500 Metern sind häufiger
beeinträchtigt, aber weniger "zerstört" oder "gefasst" als in tieferen Höhenlagen. Eine
häufige Beeinträchtigung von Quellen im Offenland hoher Höhenlagen sind
Trittschäden durch das Vieh. Gemäss der Einstufung des Quellzustandes in die
Kategorien natürlich, beeinträchtigt, zerstört und gefasst zerstört, kann man davon
ausgehen, das Quellen über 1500 m. ü. M. in einem weniger schlechten Zustand sind.
100% 4
25 48 20
34 7
90%
76
80%
57 24
182
70%
60% 114 75
50% 46 82
109
40%
30%
20% 165 79
184
55 35
10%
0%
< 600 m 600 -799 m 800 - 999 m 1000 - 1499 m > 1500 m
natürlich beeinträchtigt Zerstört gefasst zerstört
Abbildung 12: Zustand der Quell-Lebensräume in verschiedenen Höhenlagen. Im
Diagramm ist die Anzahl der untersuchten Quellen erwähnt.
5.3.4 Revitalisierungspotential
Unter den 1499 untersuchten Quellen ist bei 113 ein gutes Revitalisierungspotential
festgestellt worden. Ein Potential zur Revitalisierung besteht nur bei beeinträchtigten
und gefassten Quellen. Folgende Kriterien wurden für diese Beurteilung
berücksichtigt: naturnahe Quellen in der Umgebung, Vernetzung zu bestehendem
Quellbach, Lage in Schutzgebiet, Fassung mit Überlauf, relevante Schüttung,
Revitalisierungsaufwand wird als gering eingeschätzt. Die Kriterien sind nicht
abschliessend, die Beurteilung war auch stark vom persönlichen Eindruck der
Kartierpersonen abhängig.
77 Quellen mit Revitalisierungspotential befinden sich im Wald, 34 im Offenland und 2
im Siedlungsgebiet.
Es ist klar, dass auch weitere Quellen mit beeinträchtigtem und zerstörtem Quell-
Lebensraum ein Potential zur Revitalisierung aufweisen.
Februar 2018 Atelier für Naturschutz und Umweltfragen 19Naturnahe Quellen im Kanton Bern
5.3.5 Zustand der Quellbäche
Die im Projektgebiet untersuchten Quellbäche sind mehrheitlich (58%) in einem
natürlichen Zustand, 42% sind durch harte oder ingenieurbiologische Verbauungen
beeinträchtigt. Da diese Beurteilung des Quellbaches nur bei rund der Hälfte der
untersuchten Quellen durchgeführt wurde, ist die Interpretation der Resultate
schwierig. Es ist aber anzunehmen, dass auch beeinträchtigte Quell-Lebensräume
einen naturnahen Quellbach haben.
Vergleicht man den Zustand des Quellbaches in den verschiedenen
biogeographischen Regionen, so ist es erstaunlich, dass im Mittelland der Anteil
natürlicher Quellbäche am höchsten ist, wo es doch beim Zustand des Quell-
Lebensraumes gerade umgekehrt ist; Abbildung 13. Eine mögliche Erklärung ist, dass
der Anteil Waldquellen im Vergleich zu den Voralpen und Alpen grösser ist, und dort
die Bäche weniger beeinträchtigt sind.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Jura Mittelland Voralpen Nordalpen
natürlich beeinträchtigt
Abbildung 13: Zustand von Quellbächen nach Region
5.4 Standort von Quellen
Bei der Lage der Quellen werden gemäss "Berner Methode" drei Landschaftstypen
unterschieden. Quellen befinden sich entweder im Wald, im Offenland oder im
Siedlungsgebiet. Liegt die Quellen im Offenland, wird weiter zwischen Acker, Wiese
und Weide unterschieden.
Die untersuchten Quellen sind am häufigsten im Wald anzutreffen; über Dreiviertel
aller Quellen, Abbildung 14. Aufgrund des starken Nutzungsdruckes im Offenland ist
dieses Resultat nicht weiter erstaunlich.
Februar 2018 Atelier für Naturschutz und Umweltfragen 20Naturnahe Quellen im Kanton Bern
Betrachtet man den Zustand der Quell-Lebensräume in Abhängigkeit ihres
Standortes, so ist ersichtlich, dass natürliche Quellen zu 90% im Wald zu finden sind,
Abbildung 15. Je schlechter der Zustand von Quellen, desto weniger gross ist der
Anteil an Waldquellen. In gleichem Verhältnis nimmt mit steigender Verschlechterung
des Quell-Lebensraumes der Anteil im Offenland und dem Siedlungsgebiet zu.
17
247
937
Siedlung Offenland Wald
Abbildung 14: Standort von Quellen. Im Diagramm ist die Anzahl der untersuchten
Quellen erwähnt.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
natürlich beeinträchtigt zerstört gefasst
Wald Offenland Siedlung
Abbildung 15: Zustand der Quell-Lebensräume in Verhältnis zum Standort
Abbildung 16 verdeutlich obige Aussage, dass die meisten natürlichen Quell-
Lebensräume im Wald vorkommen. Die Anteile natürlicher Quellen sind in Wiesen
und Weiden nur aufgrund der geringen Anzahl relativ hoch. Im Ackerland befinden
sich keine natürlichen Quellaustritte.
Februar 2018 Atelier für Naturschutz und Umweltfragen 21Naturnahe Quellen im Kanton Bern
100%
1 60
90% 25 11
191 5
80%
70% 51 28
60% 268
13 6
50%
40% 13
30% 62
20% 418 5
21
10%
2
1
0%
Acker Wiese Weide Wald Siedlung
natürlich beeinträchtigt zerstört gefasst
Abbildung 16: Einfluss der Landnutzung auf den Zustand der Quellen. Blau: natürlich,
gelb: beeinträchtigt, orange: zerstört und rot: gefasst. Im Diagramm ist die Anzahl
Quellen angegeben.
5.5 Austrittsform von Quellen
Im Rahmen der Quellenbeurteilung werden in der "Berner Methode" vier
unterschiedliche Austrittsformen unterschieden:
▪ Sturzquellen: Das Wasser tritt punktuell aus und der Abfluss erfolgt in einem
Gerinne, das bereits im oberen Abschnitt einem Bächlein gleicht.
▪ Sickerquellen: Das Wasser tritt flächig aus und bildet einen Quellsumpf. Ein klarer
Austritt ist nicht auszumachen. Die Sohle ist oft mit Seggen, Moosen und
Wasserpflanzen bewachsen.
▪ Weiherquelle: Das Wasser tritt am Grunde eines Weihers aus und fliesst meist in
einem Quellbach ab. In Auen werden solche Quellen auch als Giessen bezeichnet.
▪ Künstlicher Austritt: Das Wasser tritt aus einem Rohr oder aus einem anderen
künstlichen Ausfluss aus.
Februar 2018 Atelier für Naturschutz und Umweltfragen 22Naturnahe Quellen im Kanton Bern
423 419
25
370
Sturzquelle Sickerquelle Weiherquelle künstlich
Abbildung 17: Austrittsformen von Quellen. Im Diagramm ist die Anzahl Quellen
angegeben.
Weiherquellen sind eine Austrittsform die nur selten zu finden ist. Die drei Quelltypen
Sturzquelle, Sickerquelle und künstlicher Austritt wurden beinahe zu gleichen Anteilen
beobachtet, Abbildung 17. Ein regionaler Vergleich der Austrittsformen von Quellen
zeigt klare Unterschiede auf; Abbildung 18. Im Jura sind Sickerquellen mit nur rund 5
% Vorkommen vergleichsweise selten und über die Hälfte der Quellen hat eine
künstliche Austrittsform. Im Mittelland und den Voralpen sind bezüglich Austrittsform
der Quellen hingegen keine grossen Unterschiede auszumachen. In den Nordalpen
sind Sturzquellen dominant.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Jura Mittelland Voralpen Nordalpen
Abbildung 18: Austrittsform nach Region. Grün: Weiherquelle, blau: Sturzquelle,
braun: Sickerquelle, rot: künstlicher Austritt.
Februar 2018 Atelier für Naturschutz und Umweltfragen 23Naturnahe Quellen im Kanton Bern
Bezüglich Zustand der unterschiedlichen natürlichen Austrittsformen sind keine
eindeutigen Unterscheide auszumachen. Der Anteil natürlicher und beeinträchtigter
Quell-Lebensräume liegt bei rund 60 – 70 %, resp. 30 – 35 %, Abbildung 19.
Eindeutig ist, dass bei künstlichen Quellaustritten keine natürlichen Lebensräume
vorkommen, da sich die Eigenschaften des Wassers im Rohr verändern.
100% 12 8
90% 61
8
80% 141 137
70%
60%
268
50%
40%
17
30% 260 219
20%
10% 94
0%
Weiherquelle Sturzquelle Sickerquelle künstlich
natürlich beeinträchtigt zerstört gefasst
Abbildung 19: Zustand der Quellen nach Austrittsform
5.6 Schüttungsmenge und Grösse von Quellen
Die Schüttungsmenge der untersuchten Quellen zeigt ein eindeutiges Bild.
Durchschnittlich haben über 80 % der Quellen ein Schüttungsvolumen von weniger
als 1 Liter pro Sekunde
Unterschiede in der Schüttung findet man im Vergleich der verschiedenen
Höhenlagen der Quellen. Je höher eine Quelle gelegen ist, desto grösser ist der Anteil
Quellen, die mehr als 1 l/s Schüttungsmenge aufweisen. Daraus lässt sich schliessen,
dass in höheren Lagen die Schüttungsmenge zunimmt; Abbildung 20.
Februar 2018 Atelier für Naturschutz und Umweltfragen 24Naturnahe Quellen im Kanton Bern
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
unter 600 600 bis 799 800 - 999 1000 - 1499 über 1500
Abbildung 20: Quellschüttung in unterschiedlichen Höhenlagen. Grau 100 l/s.
Betrachtet man die Schüttungsmenge der gefassten Quellen (Datenherkunft GSK25),
so sieht die prozentuale Verteilung der Schüttungsmengen gleich aus wie bei den für
das Projekt untersuchten Quellen, Tabelle 2.
Die Hypothese, dass Quellen mit einer grossen Schüttungsmenge tendenziell eher
gefasst sind als kleine Quellen, lässt sich anhand dieser Daten nicht bestätigen.
Wird die Schüttungsmenge mit dem Zustand des Quell-Lebensraumes verglichen, so
ist jedoch erkennbar, dass natürliche Quell-Lebensräume eine geringere Schüttung
als beeinträchtigte und zerstörte Quellen haben, Abbildung 21.
Tabelle 2: Schüttungsmengen der gefassten Quellen. Datenherkunft: GSK25.
Schüttungsmenge (l/s) Anzahl Quellen Prozent Vgl. Projektdaten
> 100 2 0.1 0.2
10 – 100 36 1.6 1.1
1 – 10 376 17.2 17.7Naturnahe Quellen im Kanton Bern
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
natürlich beeinträchtigt zerstört
100 l/s
Abbildung 21: Schüttungsmenge von Quellen im Vergleich zum Zustand des
Lebensraumes.
Die Darstellung der Schüttungsmenge pro Region, Abbildung 22, zeigt klar auf, dass
Quellen mit einer sehr hohen Schüttung (> 100 l/s) ausschliesslich im Jura
vorkommen. Für den karstigen Jura, wo das Wasser durch das poröse Gestein über
weite Strecken versickert und dann gebündelt an einem Standort hervortritt
(Sturzquelle), erstaunt dieser Befund nicht. Auch in den Nordalpen sind Quellen mit
einer Schüttung zwischen 1 – 10 l/s vergleichsweise zahlreich. Auch das könnte einen
geologischen Hintergrund haben. Im Mittelland und den Voralpen sprudeln jedoch
kaum Quellen mit einem höheren Volumen als einem Liter pro Sekunde.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Jura Mittelland Voralpen Nordalpen
100 l/s
Abbildung 22: Schüttungsvolumen von Quellen nach Region
Februar 2018 Atelier für Naturschutz und Umweltfragen 26Naturnahe Quellen im Kanton Bern
Die Quell-Lebensräume sind im Jura alle kleiner als 30 m²; Abbildung 23. In den
anderen Regionen beträgt dieser Anteil Quellen mit einer Fläche grösser als 30 m² um
die 10 %. Bei den grossen Quellen handelt es sich zu einem sehr grossen Teil um
Sickerquellen, deren Wasser flächig austritt. Tendenziell sind Quellen der Voralpen
und Nordalpen grossflächiger.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Jura Mittelland Voralpen Nordalpen
klein mittel gross
Abbildung 23: Grösse von Quellen nach Region
5.7 Substrate und Artenvielfalt
5.7.1 Substrate der Quell-Lebensräume
Die Beschaffenheit und die Vielfalt des Bodensubstrates von Quellen ist für den
Lebensraum charakteristisch und wirkt sich direkt auf die Zusammensetzung der
Artenvielfalt aus (Lubini-Ferlin, et.al., 2014). Quellen mit grosser Substratdiversität
haben viele ökologische Nischen, die zu einer grösseren Artenvielfalt führen.
Abbildung 24 zeigt auf, wie häufig die untersuchten Substrate vorkommen. Auffällig
sind die geringen Vorkommen von Blöcken und Kalkablagerungen. Verwunderlich ist
diese Feststellung jedoch nicht, da Blöcke nicht typische Quellsubstrate sind und
Kalkablagerungen nur bei kalkhaltige Quellen zu erwarten sind. 20 % der Quellen
enthalten Ablagerungen von Kalk in Form von Tuffbildungen oder weissen
Kalkkrusten.
Februar 2018 Atelier für Naturschutz und Umweltfragen 27Naturnahe Quellen im Kanton Bern
600
500
400
300
200
100
0
Moospolster
Steine
Detritus
Falllaub
Kalkablagerungen
Feinmaterial
Sand
Kies
Blöcke
Totholz
Abbildung 24: Substratnennungen. Y-Achse: Anzahl Nennungen bei total 877
Quellen. Mehrfachnennungen pro Quelle sind möglich.
Am häufigsten wurden fünf unterschiedliche Substrate festgestellt; Abbildung 25.
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Abbildung 25: Anzahl der genannten Substrate. X-Achse: Anzahl Substrate, Y-Achse:
Anzahl der Quellen. Total 877 Quellen.
5.7.2 Artenvielfalt von Quellen
Feldmitarbeiterinnen und -Mitarbeiter haben z.T. mittels einfachem Verfahren die
Quellfauna untersucht. Dabei hat sich gezeigt, dass Bachflohkrebse gefolgt von
Köcher- und Steinfliegen am häufigsten erkannt wurden; Abbildung 26.
Februar 2018 Atelier für Naturschutz und Umweltfragen 28Naturnahe Quellen im Kanton Bern
250 227
200
150
112 115
100 87
41
50
2
0
Strudelwürmer
Steinfliege
Flohkrebs
Eintagsfliege
Feuersalamander
Köcherfliege
Abbildung 26: Nachgewiesene Artengruppen. Total 891 Quellen.
Häufig wurde nur eine Artengruppe festgestellt, Abbildung 27. Über den Zustand der
Artenvielfalt kann man mit dieser Aufnahmemethode keine Aussagen machen.
Einzige Annahme ist, dass man bei Nachweisen von Tieren davon ausgehen kann,
dass die Quelle ganzjährig schüttend ist und somit geeignete Lebensbedingungen für
die Quellfauna bildet. Nur in zwei Quellen konnte man Feuersalamander finden. Es ist
anzunehmen, dass der Feuersalamander häufiger vorkommt, die Suche braucht
jedoch ein geschultes Auge und Erfahrung.
700
600
500
400
300
200
100
0
0 1 2 3 4 5
Abbildung 27: Anzahl nachgewiesener Artengruppen. X-Achse: Anzahl Artengruppen,
Y-Achse: Anzahl der Quellen. Total 891 Quellen.
Februar 2018 Atelier für Naturschutz und Umweltfragen 29Naturnahe Quellen im Kanton Bern
5.8 Quellen in Inventargebieten
Im Hinblick auf die Erarbeitung von Massnahmen zum Erhalt und der Aufwertung von
Quellen haben wir die Quellen, die sich innerhalb von nationalen Inventarobjekten
befinden, separat ausgewertet. Folgende Inventare wurden berücksichtigt:
Amphibienlaichgebiete, Auengebiete, Flachmoore, Moorlandschaften, Trockenwiesen,
BLN-Gebiete, Wasser- Zugvogelreservate.
56 Quellen befinden sich in nationalen Inventarobjekten. 25 davon befinden sich in
einem beeinträchtigten oder zerstörten Zustand. Eine Liste dieser Quellen befindet
sich im Anhang. Diese Quellen sind bezüglich Sensibilisierungsmassnahmen und
Revitalisierung prioritär zu behandeln.
5.9 Aufwand der Feldmitarbeiterinnen
Insgesamt haben sich aufgrund der Ausschreibungen 45 Personen für die Kartierung
von Quellen gemeldet. Davon haben 36 an einem Schulungsanlass teilgenommen, 2
haben ohne vorgängige Schulung Quellen besucht und von 7 Interessenten hat man
nichts mehr gehört.
Schlussendlich haben 27 Personen Feldaufnahmen durchgeführt und total 1130
Quellen mit der "Berner Methode" beurteilt. Zusätzlich zum Datensatz, der im Rahmen
dieses Projektes erarbeitet wurde, bestehen noch weitere 370 beurteilte Quellen, die
aus früheren Projekten stammen. Der Aufwand einzelner Personen fiel sehr
unterschiedlich aus. Einige Personen haben enorm viele Quellen kartiert und
tageweise im Feld verbracht. Ein Drittel aller Quellen wurde durch drei Personen
beurteilt, Tabelle 3.
Rechnet man für die Beurteilung einer Quelle mit 20 Minuten Aufwand, inkl.
Fotobeschriftung und Datenbereinigung, und einer durchschnittlichen Anfahrtszeit von
30 Minuten, sind im Rahmen des Projektes rund 1000 ehrenamtliche Stunden
geleistet worden.
Tabelle 3: Aufwand der FeldmitarbeiterInnen
Anzahl Person Kartierte Quellen
3 >100
6 50 – 100
6 20 – 50
7 10 – 20
5Naturnahe Quellen im Kanton Bern
6. Fallbeispiele
Diese Fallbeispiele aus allen untersuchten biogeographischen Regionen zeigen auf,
welche Eigenschaften Quellen haben und welche Massnahmen wir für bestimmte
Quelltypen empfehlen. Solche Massnahmen sind auf Quellen mit ähnlichen
Eigenschaften übertragbar.
6.1 Typische Sturzquelle, Rheokrene
GBL-Code Gemeinde Region Höhe Standort
QBC009 Cortébert Berner Jura 748 m. ü. M. Offenland
Zustand Schüttung Grösse Quellbach nicht beeinträchtigt
natürlich < 1 l/s < 15 m²
Austritt QBC009 Lage QBC009
Eigenschaften typischer Sturzquellen
▪ Punktuell austretendes Wasser fliesst bald als Quellbach ab
▪ Dominanz von gröberem Substrat wie Kies und Steinen
▪ Der Quell-Lebensraum ist von geringer Grösse, weil sich die physikalischen und
chemischen Eigenschaften rasch ändern
▪ Kommt oft in Hanglagen vor
▪ Im Jura oft nur temporär, bei starken Niederschlägen wasserführend
Generelle Massnahmen zur Förderung des Quell-Lebensraumes
▪ Beschattung des Quellaustrittes mit standortgerechten Sträuchern
▪ Quellbereich in einem Umfang von mindestens 5 Metern auszäunen, um Trittschäden
durch die Beweidung zu verhindern
▪ Wasserentnahmen für Tränken und Brunnen nicht direkt am Quellaustritt installieren
Februar 2018 Atelier für Naturschutz und Umweltfragen 31Naturnahe Quellen im Kanton Bern
▪ Keine Äste und Schnittgut auf dem Quell-Lebensraum deponieren
▪ Keine Düngung in Quellennähe
▪ Aufnahme in ein kommunales Naturinventar
6.2 Typische Sickerquelle, Helokrene
GBL-Code Gemeinde Region Höhe Standort
QAA634 Unterlangenegg Voralpen 650 m. ü. M. Wald
Zustand Schüttung Grösse Quellbach nicht vorhanden
natürlich < 1 l/s 15 – 30 m²
Austritt QAA634 Lage QAA634
Eigenschaften typischer Sickerquellen
▪ Flächiger Wasseraustritt, Austrittsorte oft nicht klar auszumachen
▪ Bildung eines Quellsumpfes
▪ Dominanz von Feinsubstraten wie Ton, Sand, Kies und organischem Abbaumaterial
▪ Oft in Mulden- oder schwacher Hanglage
▪ Oft nicht fliessend und hat nicht zwingend einen Quellbach
▪ Oft mit Seggen, Moosen und Wasserpflanzen bewachsen
Generelle Massnahmen zur Förderung des Quell-Lebensraumes
▪ Quellen bei Forstarbeiten schonen, keine Rückegassen, Baumfällungen
▪ Keine Äste und Schnittgut auf dem Quell-Lebensraum ablagern
▪ Keine Brennholzstapel in der Nähe von Quellen deponieren
▪ Quellen auf Betriebsplänen des Forstdienstes eintragen
▪ Aufnahme in ein kommunales Naturinventar
Februar 2018 Atelier für Naturschutz und Umweltfragen 32Naturnahe Quellen im Kanton Bern
6.3 Typische Weiherquelle, Limnokrene
GBL-Code Gemeinde Region Höhe Standort
QBA230 Rubigen Mittelland 515 m. ü. M. Offenland
Zustand Schüttung Grösse Quellbach nicht beeinträchtigt
natürlich < 1 l/s > 30 m²
Austritt QBA230 Lage QBA230
Eigenschaften typischer Weiherquellen
▪ Grundwasseraustritt in einen Quelltümpel
▪ Austritte am Grund aufgrund konischer Wölbung sichtbar
▪ Bildung eines Quellbaches
▪ Befinden sich am Hangfuss oder in Tallagen
▪ Ist oft in Giessen anzutreffen
▪ Seltener Quelltyp
Generelle Massnahmen zur Förderung des Quell-Lebensraumes
▪ Beschattung des Tümpels mit standortgerechten Sträuchern
▪ Quellbereich in einem Abstand von mindestens 5 Metern auszäunen, um Trittschäden
durch die Beweidung zu verhindern
▪ Keine Düngung in Quellnähe
▪ Aufnahme in ein kommunales Naturinventar
Februar 2018 Atelier für Naturschutz und Umweltfragen 33Naturnahe Quellen im Kanton Bern
6.4 Beeinträchtigte Quelle im Wald
GBL-Code Gemeinde Region Höhe Standort
QBB647 Heimiswil Mittelland 634 m. ü. M. Wald
Quelltyp Zustand Schüttung Grösse Quellbach
Sturzquelle beeinträchtigt < 1 l/s < 15 m² beeinträchtigt
Austritt QBB647 Lage QBB647
Beeinträchtigungen
▪ Siedlungsabfall
▪ Holzabfall
Folgen für den Quell-Lebensraum
▪ Chemische Gewässerverschmutzung durch Siedlungsabfall
▪ Änderung der Lebensraumeigenschaften durch Asthaufen eigentlicher Quell-
Lebensraum ist für Insekten nicht mehr erreichbar
▪ Düngung der Quelle durch Holzzerfall
Empfohlene Massnahmen
▪ Keine Äste und Schnittgut auf dem Quell-Lebensraum ablagern
▪ Keine Brennholzstapel in der Nähe von Quellen deponieren
▪ Quellen bei Forstarbeiten schonen, keine Rückegassen, Baumfällungen
Februar 2018 Atelier für Naturschutz und Umweltfragen 34Naturnahe Quellen im Kanton Bern
6.5 Beeinträchtigte Quelle im Offenland
GBL-Code Gemeinde Region Höhe Standort
QBO707 Grindelwald Nordalpen 1980 m. ü. M. Offenland
Quelltyp Zustand Schüttung Grösse Quellbach
nicht
vorhanden
Sturzquelle beeinträchtigt < 1 l/s < 15 m²
Austritt QBO707 Lage QBO707
Beeinträchtigungen
▪ Viehtritt
Folgen für den Quell-Lebensraum
▪ Zerstörung des Substrats und des Interstitialbereichs
▪ Düngung der Quelle durch Exkremente
▪ Beeinträchtigung der Artenvielfalt
Empfohlene Massnahmen
▪ Quellbereich in einem Umfang von mindestens 5 Metern auszäunen, um Trittschäden
durch die Beweidung zu verhindern
▪ Wasserentnahmen für Tränken und Brunnen nicht direkt am Quellaustritt installieren
▪ Keine Äste und Schnittgut auf dem Quell-Lebensraum ablagern
▪ Keine Düngung in Quellnähe
Februar 2018 Atelier für Naturschutz und Umweltfragen 35Naturnahe Quellen im Kanton Bern
7. Interpretation
Durch das Pro Natura Projekt stehen zahlreiche neue Daten zu Verbreitung und
Zustand von Quellen im Kanton Bern zur Verfügung. Aufgrund des grossen
Projektperimeters innerhalb unterschiedlicher biogeographischer Regionen sind
aussagekräftige Interpretationen möglich.
Natürliche Quell-Lebensräume:
Ein Drittel der untersuchten noch vorhandenen Quellen ist unversehrt und hat einen
natürlichen Quell-Lebensraum. Diese Quellen befinden sich typischerweise im Wald
und haben eine geringe Schüttung (< 1 l/s).
Beeinträchtigte Quell-Lebensräume:
Zwei Drittel der untersuchten Quellen hat keinen natürlichen Lebensraum mehr. Die
Quellen sind beeinträchtigt, zerstört oder gefasst.
Beeinträchtigte oder zerstörte Quell-Lebensräume wären natürlicherweise meist im
Offenland, sind jedoch drainiert und in den nächstgelegenen Wald geleitet worden.
Typische Beeinträchtigungen von Quell-Lebensräumen
In den häufigsten Fällen ist der eigentliche Quellbereich drainiert und ein Rohr bildet
den Anfang eines Bächleins. Die eigentliche Quelle befindet sich in der offenen
Landschaft und das Wasser wird bis zum nächsten Wald im Rohr abgeführt. Man
spricht von einem zerstörten Quell-Lebensraum. Einzige Massnahme um den Quell-
Lebensraum aufzuwerten wäre die Revitalisierung, sprich das Entfernen der
Fassungsrohre. Der Widerstand dagegen dürfte aber gross sein, da sich diese
Objekte meist im Landwirtschaftsgebiet befinden.
Bei den anderen Beeinträchtigungen handelt es sich hauptsächlich um Astdepots,
Trittschäden und Viehtränken, die sich im Quellbereich befinden. Durch
Sensibilisierung der Grundeigentümer und Bewirtschafter lässt sich der Lebensraum
im besten Fall mit einer Verhaltensänderung aufwerten.
Regionale Unterschiede:
Jura und Mittelland: Hier sind naturnahe Quell-Lebensräume weitgehend auf Wälder
beschränkt. Im Offenland ist beinahe nichts mehr zu finden. Im Jura findet man
hauptsächlich den Quelltyp Sturzquelle, bei dem das Wasser rasch und punktuell aus
dem Boden fliesst. Der Quellbereich ist deshalb nicht allzu gross und das
abfliessende Wasser bildet sofort ein Gerinne. Namentlich in Kalksteingebieten wie
dem Jurabogen kann das Wasser auch spektakulär im freien Fall aus Felsen
austreten. Im Mittelland kommen Sturzquellen, wie auch Sickerquellen, die einen
Quellsumpf bilden, gleichermassen vor. Allerdings sind 80 Prozent der Quellen
gefasst oder zerstört.
Februar 2018 Atelier für Naturschutz und Umweltfragen 36Naturnahe Quellen im Kanton Bern
Voralpen und Nordalpen: Hier findet man natürliche Quellen nicht nur im Wald,
sondern auch im Offenland, auf Wiesen und Weiden. Je höher man in die Berge
steigt, desto verbreiteter sind naturnahe Quell-Lebensräume. In den Voralpen
dominieren Sickerquellen in Wäldern. In den Nordalpen hingegen sind eher
Sturzquellen anzutreffen. In den Nordalpen sind immerhin 50 % der Quellen nicht
gefasst, entsprechend verbreitet sind noch intakte Lebensräume.
Abbildung 28: Sturzquelle im Berner Jura
Februar 2018 Atelier für Naturschutz und Umweltfragen 37Naturnahe Quellen im Kanton Bern
8. Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung
Für die Sensibilisierung und Öffentlichkeitsarbeit haben wir auf drei Ebenen
Massnahmen ergriffen:
▪ Direkte Schulung von Leuten zum Thema Quellen
▪ Informieren mittels eines Flyers zum Thema
▪ Allgemeine Medienartikel zu Quell-Lebensräumen und zum Pro Natura Projekt
8.1 Schulungen
Mit Ausnahme von zwei geübten Personen, die bereits Quellen beurteilt hatten,
konnten wir an zwei halbtägigen und einer Abendschulung 36 freiwillige Personen zur
Bedeutung des Quell-Lebensraumes informieren. Eine Präsentation und
anschliessende praktische Erfahrungen mit der "Berner Methode" zur Beurteilung von
Quellen statteten die freiwilligen Helfer mit dem notwendigen Rüstzeug für die
Feldarbeiten aus.
8.2 Flyer
Eine der ersten Projektarbeiten war die Gestaltung eines Informationsflyers zu den
Quellen. Mit diesem sollten bereits zu Projektbeginn Gemeinden und weitere Akteure
auf das Thema Quell-Lebensräume aufmerksam werden.
Der Flyer beschreibt den Lebensraum, die Entwicklung der Quellen in der Schweiz,
porträtiert drei typische Quellarten und empfiehlt Massnahmen zum Umgang mit
Quellen im Wald und im Landwirtschaftsgebiet. Im Anhang ist ein Exemplar beigelegt.
Der Flyer ist in deutscher und französischer Sprache verfügbar.
8.2.1 Versand des Quellenflyers
Den Flyer haben wir an folgende Institutionen verschickt:
▪ Alle Berner Gemeinden haben zwei gedruckte Exemplare erhalten (38
französischsprachige, 314 deutschsprachige)
▪ Amt für Wald des Kantons Bern (KAWA): 130 Flyer plus eine digitale Version im
PDF Format zuhanden der Revierförster
▪ Berner Wald: Flyer im Organ der Berner Waldbesitzer abgedruckt
▪ Verein Berner Burgergemeinden: 10 gedruckte Flyer verschickt
▪ Pro Natura, weitere USOs: die kantonalen Sektionen und bernischen
Regionalsektionen sowie weitere Umweltorganisationen wurden mit gedruckten
Flyern bedient
Februar 2018 Atelier für Naturschutz und Umweltfragen 38Naturnahe Quellen im Kanton Bern
8.3 Medientätigkeiten
Mittels Artikeln in Fachzeitschriften und Zeitungen, Newslettern und Radiosendungen
haben wir die Bevölkerung zur Problematik der Quell-Lebensräume informiert:
▪ WWF Panda Magazin, Lokalteil Bern: Aufruf für Freiwilligenarbeit und
Kurzbeschrieb des Projektes, Frühling 2016
▪ Pro Natura Lokal Bern: Artikel und Aufruf für Freiwilligenarbeit, Frühling 2016
▪ Berner Bauernverband: Artikel im elektronischen Newsletter vom Oktober 2016
▪ Bauernzeitung: Artikel, Oktober 2016
▪ Radio SRF - Echo der Zeit und Regionaljournal: Beitrag zu den Quellen,
September 2016
▪ Pro Natura Lokal Bern: Artikel zu den Resultaten des Quellenprojektes, Frühling
2018
Februar 2018 Atelier für Naturschutz und Umweltfragen 39Naturnahe Quellen im Kanton Bern
9. Ausblick
Im vorliegenden Projekt zeigen wir den Zustand von Quell-Lebensräumen in
verschiedenen biogeographischen Regionen des Kantons Bern auf. Dabei wird klar,
dass die Qualität des Lebensraumes in der Vergangenheit stark abgenommen hat
und dadurch auch die quellspezifische Artenvielfalt leidet.
Quellen wurden in der Vergangenheit aufgrund verschiedener Interessen
beeinträchtigt oder zerstört. Je nach Region fällt das Ausmass der Beeinträchtigung
des Lebensraumes jedoch unterschiedlich aus. Das ruft deshalb nach spezifischen,
situationsbedingten Massnahmen.
Der Erhalt und die Revitalisierung von Quellen tangieren diverse Akteure (Bund,
Kanton, Gemeinden, Grundeigentümer, Bewirtschafter und NGOs). Um mit dieser
Absicht voran zu kommen, sollten die Aufgaben aller Akteure bekannt sein.
Aus den erarbeiten Grundlagen leiten wir, um Quell-Lebensräume langfristig zu
erhalten, den Handlungsbedarf ab und machen Empfehlungen für die Zuständigkeit.
9.1 Handlungsbedarf
Grundsätzlich ist jede Quelle, sei sie in naturnahem oder beeinträchtigtem Zustand,
zu erhalten. Beeinträchtigungen von Quellen sind möglichst durch geeignete
Massnahmen zu beheben.
Die Gemeinden und die Öffentlichkeit sollten Kenntnis haben von ihren Naturobjekten
und sollten besonders wertvolle, d.h. grosse, strukturreiche und landschaftlich
wertvolle Quellen durch Artenschutzverträge mit dem Kanton oder der Gemeinde,
oder durch Schutzbeschlüsse sichern.
In der Abbildung 29 zeigen wir die weiteren Massnahmen auf, die wir zum Erhalt und
Schutz von Quell-Lebensräumen empfehlen.
Februar 2018 Atelier für Naturschutz und Umweltfragen 40Sie können auch lesen