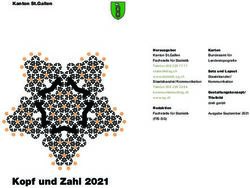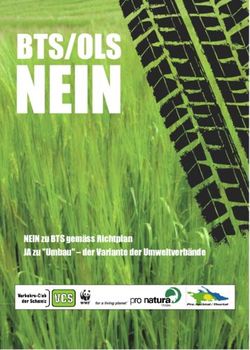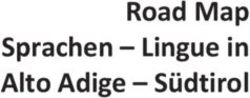Das Reh-Projekt im Kanton Bern - Mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät Universität Zürich
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät Universität Zürich Das Reh-Projekt im Kanton Bern Prof. Dr. Lukas Keller Aktueller Stand Die Universität Zürich führt seit zwei Jahren im Auftrag des Bundesamts für Umwelt (BAFU) ein Reh-Projekt durch, dessen Ziel es ist, die direkten und indirekten Einflüsse des Luchses auf Rehbestände zuverlässig zu er- fassen. Dies deshalb, weil politische Vorstösse immer wieder fordern, dass Luchse abgeschossen werden sollen, zu den Effekten der Luchse auf die Populationen ihrer Beutetiere in der Schweiz aber keine verlässlichen Zahlen vorliegen. Um zuverlässige Daten dazu zu erhalten, stattete die Universität Zürich bisher insgesamt 143 Rehe im Berner Oberland mit Halsbandsendern aus, die es erlauben, die Bewegungsmuster und Todesursachen der Rehe zu erfassen. Im August 2013 war es zu Zwischenfällen mit Rehkitz-Hals- bändern gekommen: Der Expansionsmechanismus, welcher ein Mitwach- sen der Halsbänder ermöglichen sollte, funktionierte wegen eines Pro- duktionsfehlers nicht. Nachdem Fangversuche ergebnislos verblieben, beschlossen am 20. August 2013 das Jagdinspektorat des Kantons Bern, das Bundesamt für Umwelt (BAFU) und die Universität Zürich gemein- sam den präventiven Notabschuss von 22 Tieren, der anschliessend durch die Wildhut des Kantons Bern durchgeführt wurde. Diese Notabschüsse stellen einen herben Rückschlag für das Rehprojekt dar. Monatelange, intensive Feldarbeit wurde dadurch zunichte gemacht. Auch kannten die Forscherinnen und Forscher die Tiere individuell, was die Entscheidung zum Abschuss noch schwieriger machte. Die Uni- versität Zürich bedauert das tragische Vorkommnis ausserordentlich und setzt alles daran, die genauen Ursachen für das Versagen der Kitz- Senderhalsbänder der Firma Sirtrack zu klären. Die sich nicht korrekt erweiternden Kitz-Sendehalsbänder werden derzeit im Auftrag der Uni- versität Zürich bei der EMPA untersucht, um den genauen Produktions- fehler zu eruieren.
Das Reh-Projekt
im Kanton Bern
Die Universität Zürich wird der für die Tierversuchsbewilligung des Pro-
jekts zuständigen Kantonalen Tierversuchskommission Bern im Detail
Bericht erstatten und und verzichtet bis auf weiteres auf das Einfangen
und Besendern von weiteren Tieren. Die bereits besenderten Rehe werden
aber im Rahmen der Studie weiterhin vom Projektteam beobachtet.
Die Medien wurden am 3. September 2013 über den Notabschuss infor-
miert. Daraufhin wurden im Grossen Rat des Kantons Bern und auch im
Nationalrat mehrere Vorstösse gegen das Rehprojekt eingereicht (siehe
Anhang).
Das vorliegende Dossier will die zum Teil heftig und emotional ge-
führten Debatten über das Reh-Projekt mit Fakten, Hintergründen
und Richtigstellungen anreichern. Damit sollen möglichst umfassende
Informationen transparent und verständlich an die Öffentlichkeit, die
Medien und die Politik weitergegeben werden.
2Das Reh-Projekt
im Kanton Bern
Die Vorgeschichte
«Welche direkten und indirekten Einflüsse haben Luchse auf die Reh
bestände im Simmen- und im Kandertal im Berner Oberland?»
Das ist die zentrale Forschungsfrage im so genannten Reh-Projekt. Dazu
gibt es heute keine objektiven und damit zuverlässigen Daten. Landläufig
hingegen herrscht oft die vorgefasste subjektive Meinung, es gäbe ohnehin
zu viele Luchse, welche den Rehbestand schon drastisch reduziert hätten.
Politische Vorstösse fordern deshalb seit geraumer Zeit, dass Luchse abge-
schossen werden sollen (siehe Anhang).
Nun ist der Luchs aber ein geschütztes Wildtier. Abschüsse können des-
halb ausschliesslich vom Bundesamt für Umwelt BAFU bewilligt werden.
Um zu entscheiden, ob regulierende Abschüsse nötig sind oder nicht, benö-
tigt das BAFU wissenschaftliche Grundlagen und Fakten.
Das Projekt in Kürze
Das BAFU erteilt Prof. Dr. Lukas Keller von der Universität Zürich im Jahr
2011 den Auftrag, ein objektives Abbild der Situation in einer wissenschaft-
lichen Studie aufzuzeigen. Das von der Kantonalen Tierversuchskommissi-
on des Kantons Bern bewilligte Projekt startet im selben Jahr im Simmen-
und Kandertal. Einige der zentralen Fragen der Studie sind unter anderen:
– Wie beeinflusst die Anwesenheit des Grossraubtiers Luchs das
Verhalten der Rehe?
– Stehen Rehe unter vermehrtem Stress, sind sie krankheitsanfälliger?
– Haben Rehe kürzere Ruhezeiten, verändern sich die Intervalle
ihrer Fresszeiten?
– Welchen Anteil hat der Luchs an der Sterblichkeit von Rehen?
– etc.
Warum braucht man Halsbandsender?
Diese Fragen erfordern, dass Verhalten, Bewegungen und Todesursachen
der Rehe präzis erfasst und beobachtet werden. Verlässliche Daten darüber
liefern einzig Halsbandsender. Mit Ohrmarken lassen sich keine genauen
Daten erheben: Rückmeldungen geben meist nur darüber Auskunft, dass
das Tier geschossen oder überfahren wurde. Andere Todesursachen wie
Krankheit, Abstürze oder ob das Tier einem Luchs oder einem anderen
Wildtier zum Opfer gefallen ist, lassen sich mit Ohrmarken allein nicht
überprüfen. Ähnliches gilt für die von Katzen und Hunden bekannten
Mikrochips. Diese können nur aus wenigen Zentimetern Distanz abgele-
sen werden, und sind daher für die Erforschung von Bewegungsmustern
und Todesursachen nicht geeignet.
3Das Reh-Projekt
im Kanton Bern
Von November 2011 bis und mit Juni 2013 wurden deshalb bei insgesamt
69 ausgewachsenen Rehen Sendehalsbänder angebracht und ab 2012 wurden
auch 74 Rehkitze mit Sendern ausgestattet (Details siehe Anhang).
Welche Halsbänder wurden verwendet?
Ausgewachsene Rehe: GPS Senderhalsband Typ Reh (390g, e-obs)
Rehkitze 2012: VHF Senderhalsband Typ Expandierbar
(90g, Followit)
Rehkitze 2013: VHF Senderhalsband Typ Expandierbar
(33.5g / 42g, Sirtrack)
Die im Jahr 2012 bei den Rehkitzen angebrachten Halsbänder zeigten eine
ungenügende Sendeleistung, zudem hatte der Hersteller Lieferschwierig-
keiten. Im Frühsommer 2012 hat die Projektleitung deshalb beschlossen,
einen anderen Lieferanten zu suchen. Nach eingehender Evaluation fiel
die Wahl auf den international renommierten Hersteller SirTrack. Das von
ihm gelieferte Halsband Ultimate V5 Expanding Collar, war bei vergleich-
baren Tierarten (Weisswedelhirsche in den USA) bereits über hundert
Mal erfolgreich eingesetzt worden. Die Felderprobtheit dieses Halsbandes
war neben der besseren Sendeleistung und des niedrigeren Gewichts ein
wesentliches Entscheidungskriterium.
Wie werden Sender an diese extrem scheuen Tiere angebracht?
Ausgewachsene Tiere werden mit Netzen bzw. Kastenfallen eingefangen.
(Details siehe Anhang). Netzfänge werden jedes Mal von einem Tierarzt eng
begleitet.
Rehkitze sind während der ersten Lebenswochen Nesthocker, d. h. bei
Gefahr vertrauen sie auf ihre Tarnung und bewegen sich nicht. Sendehals-
bänder lassen sich so sehr leicht und ohne unnötigen Stress für das Tier
überstreifen. Die Kitz-Halsbänder werden vom Hersteller fertig geliefert und
werden einfach über den Kopf gestreift. Somit können beim Anbringen der
Halsbänder eigentlich keine Fehler vorkommen.
Probleme mit den Kitz-Sendehalsbändern vom Typ Ultimate V5
Mitte August 2013 ergab unsere radiotelemetrische Überwachung aller Tiere,
dass ein von uns besendertes Rehkitz verstorben war. Bei der Untersu-
chung dieses Tieres fiel auf, dass sich das Sendehalsband aus unbekannten
Gründen nicht nicht wie vorgesehen, dem Wachstum des Jungtieres ange-
passt hat (Details siehe Anhang). Die Obduktion am Zentrum für Fisch- und
Wildtiermedizin der Universität Bern (FIWI) konnte die Todesursache nicht
feststellen. Das fragliche Jungtier ist jedoch mit Sicherheit nicht erstickt,
wobei nicht ausgeschlossen werden kann, dass das Halsband indirekt zum
Tod beigetragen hat.
4Das Reh-Projekt
im Kanton Bern
Wie haben die Verantwortlichen auf dieses Problem reagiert?
Sofort nach diesem Vorfall wurde durch die Projektleitung die Überprü-
fung sämtlicher besenderten Tiere aufgenommen. Der Aufenthaltsort aller
Tiere war den Forschern immer bekannt. Zu diesem Zeitpunkt waren die
Jungtiere allerdings keine Nesthocker mehr. Sie verhielten sich wie er-
wachsene Tiere d.h sie sind Fluchttiere, die bei der geringsten Störung bzw.
bei Anzeichen von Gefahr flüchten.
Gemeinsam haben dann die Universität Zürich, das BAFU und die Wildhut
des Kantons Bern beschlossen, die einzelnen Kitze mit Netzen einzufangen.
Netzfänge sind aber sehr zeitaufwendig und jede einzelne Fangaktion hat
nur geringe Erfolgschancen. Nach zwei erfolglosen Versuchen wurde klar,
dass es nicht gelingen würde, die Tiere innert nötiger Frist einzufangen.
Deshalb beschlossen die involvierten Parteien am 20. August aus tierschüt-
zerischen Überlegungen den präventiven Notabschuss der betroffenen Tie-
re. Mit dieser Massnahme sollte verhindert werden, dass die Tiere durch ihr
weiteres Wachstum und das zunehmend engere Halsband leiden müssen.
Wieso wurden die Tiere getötet und nicht einfach betäubt?
Aus Sicht der Öffentlichkeit und aus tierschützerischen Überlegungen her-
aus ist diese Frage verständlich und nachvollziehbar. Folgende Fakten aus
der Veterinärmedizin sprechen dagegen:
– Generell erträgt besonders das Reh eine Betäubung relativ schlecht, und
es kommt oft zu schweren Komplikationen während der Narkose.
– Ein Betäubungsschuss ist nur aus kurzen Distanzen (20 m – 30 m) möglich.
Es ist sehr schwierig, sich so nahe an ein Rehkitz heranzupirschen.
– Die Betäubung eines 9 bis 15 Kilogramm schweren Kitzes ist mit grossen
Risiken verbunden. Die hohe Auftreffwucht des Narkosepfeiles kann ein
Tier schwer verletzen. Verletzt der Betäubungspfeil beispielsweise einen
Lauf, wirkt das Betäubungsmittel nicht richtig und das verletzte Tier
flüchtet unter grossen Schmerzen. Verletzte Tiere müssen dann oft un-
nötig lange leiden, bis die Wildhut sie erlösen kann.
Im Mai/Juni dieses Jahres wurden total 46 Rehkitze mit Sendern ausgestat-
tet. Per Ende September lebten noch sechs dieser Rehkitze. Diese tragen ein
Senderhalsband, das sich korrekt erweitert hat. Die anderen 40 Rehkitze
starben an den folgenen Ursachen:
– per Anfang August 16 Tiere im Kitz-Alter durch Prädation,
Hunde, Krankheit, etc. getötet
– Mitte August 1 Tier an unbekannten Ursachen gestorben
– Mitte August 1 Tier bei Fangversuch verunfallt
– Mitte September 22 Tiere per Beschluss von Wildhütern
des Kantons Bern erlegt
5Das Reh-Projekt
im Kanton Bern
Schlussbemerkung
Ein modernes Wildtiermanagement erfordert eine objektive Datengrund
lage. Bei den meisten Wildtieren ist eine solche nur mit Hilfe technischer
Hilfsmittel zu erreichen. Besonders häufig werden dazu Senderhalsbänder
eingesetzt. Diese liefern Informationen wie kein anderes technisches Hilfs-
mittel in der Wildbiologie. Sie sind deshalb für wildbiologische Forschun-
gen unersetzlich. Bei allen Einsätzen von technischen Hilfsmitteln, kann es
aber auch bei aller Vorsicht zu einem technischen Versagen kommen.
In der Rehstudie der Universität Zürich ist es zu einem besonders tragi-
schen Versagen bei den Rehkitzhalsbändern gekommen, das den Not
abschuss von 22 Rehkitzen erforderte. Die Wildbiologen der Universität
Zürich sind zutiefst betroffen, haben sie doch in den letzten zwei Jahren mit
intensiver Feldarbeit viel Neues über die Rehe im Studiengebiet und deren
individuelle Schicksale gelernt. Niemand hat sich in den letzten Jahren so
intensiv um die Rehe des Studiengebiets gekümmert, wie die Biologen der
Universität Zürich und die Widlhüter der betroffenen Gebiete.
Im Grossen Rat des Kantons Bern sind diverse politische Vorstösse gegen
die Rehforschung eingereicht worden. Mehrheitlich wurden diese von
Grossräten unterzeichnet, die selber auch Jäger sind. Dies erstaunt, denn
pro Jahr werden im Kanton Bern 6 000 Rehe durch die Jagd getötet. Noch
unverständlicher ist es, dass eine Motion verlangt, dass alle Forschung an
Rehen verboten werden soll und nicht nur das Rehprojekt der Universität
Zürich. Das würde es im Kanton Bern in Zukunft unmöglich machen,
wissenschaftliche Grundlagen zu erarbeiten, wie sie für ein modernes
Wildtiermanagement unabdingbar sind.
Im November 2013
Universität Zürich
Institut für Evolutionsbiologie und
Umweltwissenschaften
Prof. Dr. Lukas Keller
Winterthurerstrasse 190
CH-8057 Zürich
6Anhänge Reh-Projekt im Kanton Bern Anhang I Parlamentarische Vorstösse gegen das Rehprojekt Nationalrat 13.3935 – Motion Lustenberger Sorgsamer Umgang mit der Kreatur und mit Steuergeldern Genauer Wortlaut der Motion noch nicht verfügbar Einreichungsdatum: 27. 09. 2013 Nationalrat – Herbstsession Fragestude Frage Geissbühler Andrea Martina Rehprojekt im Simmental Fragestunde vom: 16. 09. 2013 4 Grosser Rat Bern – Interpellation Schmid, Rösti, Berger Wer ist für das Rehfangprojekt verantwortlich Einreichungsdatum: 24. 09. 2013 5 Grosser Rat Bern 247-2013 – Motion Schmid, Berger, Siegenthaler Müssen Rehe zu Forschungszwecken Todesangst ausstehen oder sogar sterben? Einreichungsdatum: 04. 09. 2013 6
Anhang II Parlamentarische Vorstösse Luchs Grosser Rat Bern 273.2013 – Motion Rösti, Luginbühl-Bachmann, Flück, Schmid, Schwarz, Berger Hoher Luchsbestand muss reguliert werden, und verwaiste Luchse dürfen nicht mehr ausgewildert werden Einreichungsdatum: 11. 09. 2013 8 Grosser Rat Bern 2013-290 – Fragestunde Fragen 19 und 20 zu Luchs und Rehprojekt Fragestunde vom: 11. 06. 2013 10 Grosser Rat Bern 186-2010 – Motion Schmid, Reber Den Wolf und den Luchs auch im Kanton Bern zum Abschuss freigeben Einreichungsdatum: 25. 10. 2010 12 Grosser Rat Bern 187-2010 – Motion Berger, Rösti Weniger Schutz für den Wolf – Umsetzung der vom Nationalrat angenommen Vorstösse Einreichungsdatum: 25. 10. 2010 14 Grosser Rat Bern – Interpellation Schmid Grossraubtiere jagen wahllos Einreichungsdatum: 02. 03. 2010 15 Grosser Rat Bern – Interpellation Graber, Reber Wildtierbestände – Wildtierschäden Einreichungsdatum: 02.06.2009 16 Grosser Rat Bern – Interpellation Schmid Den Luchsbestand sinnvoll bewirtschaften Einreichungsdatum: 07. 03. 2007 19
Anhang III Factsheet der Firm SirTrack 23 Anhang IV Fangmethoden 25
Nationalrat - Herbstsession 2013 - Sechste Sitzung - 16.09.13- vorheriges Geschäft
14h30 nächstes Geschäft
Conseil national - Session d'automne 2013 - Sixième séance -
16.09.13-14h30
13.5285
Fragestunde.
Frage Geissbühler Andrea Martina.
Rehprojekt im Simmental
Heure des questions.
Question Geissbühler Andrea Martina.
Projet faons dans le Simmental
Informationen CuriaVista
Informations CuriaVista
Informazioni CuriaVista
Leuthard Doris, Bundesrätin: Zu Ihren drei Fragen:
1. Das Forschungsprojekt läuft seit 2011. Es wird von der Universität Zürich geführt und vom Bafu
finanziell unterstützt. In den vergangenen zwei Jahren sind keine Probleme aufgetreten. Das Projekt
ist zurzeit sistiert. In den kommenden Wochen wird die Ursache des Versagens der Halsbänder
gesucht. Erst wenn alle Fakten zusammengetragen sind, werden die eventuellen Konsequenzen für
das Projekt gezogen und die dafür verantwortlichen Personen genannt werden können.
2. Das Bafu hat das Forschungsprojekt in den Jahren 2011 bis 2014 mit insgesamt 477 000 Franken
unterstützt. Das Projekt hat zum Ziel, den Zusammenhang zwischen Grossraubtieren und Beutetieren
sowie der Waldverjüngung in der Kulturlandschaft aufzuzeigen. Mit dem Projekt soll Wissen zum
Wildtiermanagement gewonnen werden, dies im Hinblick auf eine allfällige zukünftige Luchsregulation.
3. Im Rahmen der Jagdgesetzgebung hat der Bund den Auftrag, die Erforschung der wildlebenden
Tiere zu fördern. Die von der Universität Zürich durchgeführte Feldstudie ist mit Sorgfalt geplant und
im Rahmen einer Doktorarbeit durchgeführt worden. Das Bafu wurde regelmässig über den
Projektablauf informiert. In den vergangenen zwei Saisons wurden bereits 143 Rehe mit Halsbändern
versehen, dies ohne Probleme. Dieses Jahr wurde die Firma, die die Halsbänder liefert, gewechselt.
Die Funktionstauglichkeit der neuen Halsbänder wird nun Gegenstand detaillierter Abklärungen sein.
Neben diesem Projekt unterstützt der Bund eine Hirschstudie im Mittelland, die keine Probleme dieser
Art aufweist.
45
Kanton Bern Cant
anton de Berne
Parlamentarischer Vorstoss
Vorstoss-Nr.: 247-2013
2013
Vorstossart: Motion
Richtlinienmotion: ☐
Geschäftsnummer: 2013.1192
Eingereicht am: 04.09.2013
Fraktionsvorstoss: Nein
Kommissionsvorstoss: Nein
Eingereicht von: Schmid (Achseten, SVP) (Sprecher/in)
Berger (Aeschi, SVP)
Siegenthaler (Thun, SP)
Weitere Unterschriften: 0
Dringlichkeit verlangt: Ja
Dringlichkeit gewährt:
RRB-Nr.: vom
Direktion: Volkswirtschaftsdirektion
Klassifizierung: Nichtt klassifiziert
Antrag Regierungsrat:
Müssen Rehe zu Forschungszwecken Todesangst ausstehen oder sogar sterben?
Der Regierungsrat wird aufgefordert, Sofortmassnahmen einzuleiten,
einzuleiten um das Rehfangprojekt der
Universität Zürich «Besenderung
Besenderung von Rehen» zu stoppen:
1. Zu Forschungszwecken werden im Kanton Bern keine Rehe mehr eingefangen.
eing
2. Das Besendern von Rehkitzen ist unverzüglich zu stoppen.
3. Das Rehfangprojekt der Universität Zürich wird im Kanton Bern unverzüglich gestoppt.
Begründung:
Das Rehfangprojekt der Universität Zürich ist im Kanton Bern im Gang. Seit Dezember 2012
werdenen im Berner Oberland Tiere eingefangen und mit einem Sender versehen. In der Studie
soll untersucht werden, welchen Einfluss der Luchs auf die Population der Rehe hat und welchen
Gefahren sie ausgesetzt sind.
Die Rehe sind im Winter geschwächt.
geschwächt Da ihnen durchurch den Schnee die Nahrung zugedeckt wird,
zehren
ren sie vom Herbst angelegten Fett. Als Notnahrung, um etwas in den Magen zu bekommen,
werden knospentragende Spitzen von Bäumen und Strauchpflanzen aufgenommen. Die Ruhe ist
für das Reh im Winter überlebensnotwendig,
überlebensnotwendig, da es seine Kräfte zur Nahrungssuche benötigt. So
werden auch die Variantenskifahrer, die sich nicht an die Abschrankungen am Pistenrand
Pis halten,
04|00|K|6
Letzte Bearbeitung: 05.09.2013 / Version:
Version 3 / Dok.-Nr.: 69351 / Geschäftsnummer: 2013.1192 Seite 1 von 2
6Der Regierungsrat des Kantons Bern
zu Recht bestraft. Ebenso Hundebesitzer, deren Hunde im Winter Rehe hetzen, werden eben-
falls zu Recht bestraft.
Aus diesen Gründen ist es unverständlich, dass der Regierungsrat ein Projekt vorantreibt, bei
dem die Rehe im Winter, entgegen allen ethischen und moralischen Grundsätzen, in Netze ge-
trieben werden, Todesängste ausstehen, sich verletzen oder sogar getötet werden müssen. Die
Rehe werden im Frühling aus ihren Einständen getrieben, auf ihren Fluchtwegen werden Netze
gespannt, in die sie hochflüchtig rennen, sich verwickeln, verletzen oder sogar sterben. 18 Reh-
kitze wurden nach ihrer Besenderung von der Wildhut wieder abgeschossen, weil das Sender-
halsband sie sonst ersticken würde. Das ist unprofessionell und unhaltbar. Und dies alles nur zu
Forschungszwecken und um eine Doktorarbeit abzuschliessen. Das ist unverhältnismässig und
unverständlich. Es ist Tierquälerei. Diesem Treiben ist unverzüglich Einhalt zu bieten.
Letzte Bearbeitung: 05.09.2013 / Version: 3 / Dok.-Nr.: 69351 / Geschäftsnummer: 2013.1192 Seite 2 von 2
7Kanton Bern Canton de Berne
Parlamentarischer Vorstoss
Vorstoss-Nr.: 273-2013
Vorstossart: Motion
Richtlinienmotion: ☐
Geschäftsnummer: 2013.1238
Eingereicht am: 11.09.2013
Fraktionsvorstoss: Nein
Kommissionsvorstoss: Nein
Eingereicht von: Rösti (Kandersteg, SVP) (Sprecher/in)
Luginbühl-Bachmann (Krattigen, BDP)
Flück (Brienz, FDP)
Schmid (Achseten, SVP)
Schwarz (Adelboden, EDU)
Berger (Aeschi , SVP)
Weitere Unterschriften: 0
Dringlichkeit verlangt: Nein
Dringlichkeit gewährt:
RRB-Nr.: vom
Direktion: Volkswirtschaftsdirektion
Klassifizierung: Nicht klassifiziert
Antrag Regierungsrat:
Hoher Luchsbestand muss reguliert werden, und verwaiste Luchse dürfen nicht mehr
ausgewildert werden
Nachdem die Jagdverordnung des Bundes (JSV), die gemäss Artikel 4 Absatz 1 befristete
Massnahmen zur Regulierung von Beständen geschützter Tierarten zulässt, im Juni 2012 in
Kraft gesetzt wurde, wird der Regierungsrat aufgefordert, dies zum Schutz des übrigen Wildbe-
stands auch im Kanton Bern umzusetzen.
Konkret fordern wir den Regierungsrat auf,
1. Massnahmen zu treffen, um den Luchs im Kanton Bern rasch zu regulieren
2. Massnahmen zu treffen, damit das Konzept Luchs in dem Sinne angepasst wird,
• dass verwaiste Jungluchse nicht wieder in die Population integriert werden
• dass gezüchtete Jungluchse nicht in die Population integriert werden.
Begründung:
04|00|K|6
Letzte Bearbeitung: 13.09.2013 / Version: 3 / Dok.-Nr.: 70086 / Geschäftsnummer: 2013.1238 Seite 1 von 2
8Der Regierungsrat des Kantons Bern
Seit 1975 lebt der Luchs im Kanton Bern. Nach einer ersten «Luchswelle» in den frühen achtzi-
ger Jahren war es um den Luchs im Kanton Bern lange Zeit ruhig. Mitte der neunziger Jahre be-
gann der Luchsbestand zuzunehmen, wohl als Folge der angewachsenen Rehbestände. Der
Aufschwung des Luchses betraf vor allem das westliche Berner Oberland. Dort wurde in den
Jahren 1999/2000 ein Höchststand erreicht, der schliesslich zu den erwähnten Wegfängen, aber
auch illegalen Tötungen und natürlichen Abgängen führte.
Die neusten Erkenntnisse von KORA zeigen nun, dass der Luchsbestand in der ganzen Schweiz
eine hohe bis sehr hohe Dichte erreicht hat (1,5 bis über 2 Luchse pro 100 km2). Der Einfluss
des Luchses ist im Berner Oberland, aber auch im Jura, beim Reh-, aber auch Gämswild, deut-
lich spürbar und ist mitschuldig, dass diese Wildtierbestände auf tiefem Niveau bleiben. Die neue
Jagdverordnung des Bundes (JSV) sieht nun vor, dass Eingriffe von geschützten Arten möglich
sind. In der Botschaft des Bundesrates steht u. a.: «Bezüglich der in der Schweiz vorkommenden
Grossraubtiere ist diese Situation erst beim Luchs gegeben, welcher in einzelnen Regionen der
Schweiz in regional hohen Beständen vorkommt, so in den westlichen Voralpen (VD, FR, BE)
oder im nördlichen Jura (SO). Die vierzigjährige Erfahrung mit dem Luchs in diesen Regionen
zeigt das Ausmass der Prädation auf seine Beutetiere (v. a. Reh, Waldgämsen); so konsumierte
der Luchsbestand in den westlichen Voralpen zu bestimmten Zeiten mehr Rehe als durch die
reguläre Jagd erlegt wurden. Folge davon waren der rasche Rückgang der Wildhuftiere, politi-
scher Unmut gegen den Luchs und Wilderei beim Luchs.»
Das Konzept Luchs Schweiz vom 21. Juli 2004 regelt die aufgegriffenen verwaisten Jungluchse
wie folgt:
«Aufgegriffene verwaiste Jungluchse sollen zu einem geeigneten Zeitpunkt im gleichen Kompar-
timent wieder in die Population integriert oder für Umsiedlungsprojekte im In- oder Ausland ver-
wendet werden. Falls die Wiedereingliederung aus veterinärmedizinischer Sicht nicht zu empfeh-
len ist, werden die Jungluchse euthanasiert.»
Dieser Artikel ist ersatzlos zu streichen. Vor dem Hintergrund des hohen Luchsbestands macht
eine Auswilderung dieser Luchse keinen Sinn. Zudem ist es aus tierschützerischen und ethi-
schen Gründen nicht zu verantworten.
Letzte Bearbeitung: 13.09.2013 / Version: 3 / Dok.-Nr.: 70086 / Geschäftsnummer: 2013.1238 Seite 2 von 2
9Sitzungstitel7 2013.0290 1
Der Grosse Rat Le Grand Conseil
des Kantons Bern du canton de Berne
Dienstag (Vormittag), 11. Juni 2013
Fragestunde
97 2013.0290 übrige Geschäfte
Antworten des Regierungsrates auf die Fragen der Mitglieder des Grossen Rates
Präsident. Wir beginnen mit der Fragestunde. Ich begrüsse Herrn Regierungspräsidenten Neu-
haus, der auch die Fragen an die Staatskanzlei beantworten wird.
Es werden hier nur die Fragen und Antworten wiedergegeben, die für das Rehprojekt
relevant sind!
Frage 19
Hans Schmid, Achseten (SVP) – Werden immer noch Luchse ausgesetzt?
Aus verschiedenen Kreisen hört man, dass im Kanton Bern wieder Luchse ausgesetzt wurden.
Fragen:
1. Sind in den letzten zwei Jahren 2012 und 2013 im Kanton Bern Luchse ausgesetzt worden?
2. Wie viele Luchse sind im Kanton Bern in den letzten zwei Jahren 2012 und 2013 ausgesetzt
worden?
3. In welchem Gebiet wurden Luchse ausgesetzt?
Beatrice Simon. Finanzdirektorin. Zur ersten bis dritten Frage: Nein. 2013 wurden hingegen zwei
im Kanton Bern aufgefundene, verwaiste Jungluchse wieder in die natürliche Population integriert,
nachdem sie im Winter zur Pflege in der Wildstation Landshut waren. Dieses Vorgehen erfolgte in
Absprache mit dem BAFU, anderen Kantonen, mit KORA und aufgrund des Konzepts Luchs
Schweiz vom 21. Juli 2004.
10Junisession 2013 2013.0290 12
Frage 20
Hans Schmid, Achseten (SVP) – Müssen Rehe zu Forschungszwecken in Todesangst getrie-
ben werden?
Das Rehfangprojekt der Universität Zürich ist im Gang. Seit Dezember 2012 werden im Berner
Oberland Tiere gefangen und mit einem Sender versehen. In der Studie soll untersucht werden,
welchen Einfluss der Luchs auf die Population der Rehe hat und welchen Gefahren sie ausgesetzt
sind.
Die Rehe werden durch den Winter sehr geschwächt, da die Nahrung durch Schnee zugedeckt ist
und sie vom im Herbst angelegten Fett zehren. Als Notnahrung werden knospentragende Spitzen
von Bäumen und Strauchpflanzen aufgenommen.
Die Rehe werden im Winter, entgegen allen ethischen und moralischen Grundsätzen, in Netze ge-
sprengt, wo sie sich zum Teil verletzen oder sogar sterben und Todesängste ausstehen müssen.
Variantenskifahrer werden bestraft, wenn sie ausserhalb der Piste fahren, und bei Hunden, die im
Winter oder ausserhalb der Jagdzeit Rehe jagen, werden die Hundehalter bestraft.
Fragen:
1. Wie kann ein Regierungsrat hinter einem solchen Projekt stehen?
2. Wie viel kostet dieses Projekt den Bund und den Kanton Bern, inklusive Stunden der Verwaltung
und der Wildhüter?
3. Wie viele Rehe sind bis jetzt beim Einfangen verletzt oder getötet worden?
Beatrice Simon, Finanzdirektorin. Zur ersten Frage: Die Erkenntnisse dienen der Ausarbeitung
von Lösungen für den nachhaltigen Umgang mit Grossraubtieren in der Schweiz. Das Jagdinspek-
torat, das BAFU und die Berner Jägerschaft unterstützen dieses Projekt. Der Regierungsrat hat bei
diesem Projekt keine Entscheidbefugnisse. Zur zweiten Frage: Beim Rehprojekt der Universität Zü-
rich handelt es sich um ein vom BAFU finanziertes Projekt. Die Projektwerte sind uns nicht bekannt.
In das Projekt sind vier Wildhüter involviert. Die Aufwendungen für das Rehprojekt (Unterstützung
beim Einfang) betragen daher pro Wildhüter ca. drei bis fünf Tage pro Jahr. Zur dritten Frage: Bis-
her ist es zu einer schweren Verletzung gekommen. Das Tier brach einen Rückenwirbel und musste
vom Wildhüter getötet werden. Beim Fang kann es gelegentlich zu oberflächlichen Schürfungen der
obersten Hautschicht kommen
CONVERT_163b9d2922504a49b8655c65f3c3ea74 02.07.2013
11Kanton Bern Parlamentarische Vorstösse
Canton de Berne Interventions parlementaires
Vorstoss-Nr: 186-2010
Vorstossart: Motion
Eingereicht am: 25.10.2010
Eingereicht von: Schmid (Achseten, SVP) (Sprecher/ -in)
Reber (Schangnau, SVP)
Weitere Unterschriften: 0
Dringlichkeit:
Datum Beantwortung:
RRB-Nr:
Direktion:
Den Wolf und den Luchs auch im Kanton Bern zum Abschuss freigeben
Nachdem Ständerat und Nationalrat entschieden haben, dass der Wolf in der Schweiz
künftig abgeschossen werden darf, wird der Regierungsrat aufgefordert, dieses auch im
Kanton Bern umzusetzen.
Konkret fordern wir den Regierungsrat auf, gemäss Beschluss von National- und Stände-
rat:
- Massnahmen zu treffen, um den Wolf im Kanton Bern zum Abschuss freizugeben
- Massnahmen zu treffen, um den Luchs im Kanton Bern zum Abschuss freizugeben
Immer schneller breitet sich der Wolf auch im Kanton Bern aus. Gemäss Berichten leben
in der Schweiz bereits heute rund 15 Wölfe, Rudelbildungen stehen somit vor der Tür.
Die vergangenen Alpsommer mit den zunehmenden Wolfsrissen, auch an Nutztieren, ha-
ben deutlich gezeigt, dass der Wolf im Vormarsch ist. Ein vernünftiges Zusammenleben
von freilebenden Kühen, Schafen und Ziegen mit dem Wolf ist somit eine Illusion. Die Vor-
beugemassnahmen zum Schutz der Nutztiere haben ihre Ziele bei weitem verfehlt. Der
Lebensraum für Wolfsrudel ist in der Schweiz, vor allem im Kanton Bern, nicht mehr vor-
handen.
Auch die Luchsbestände haben sich im Kanton Bern auf eine untragbare Dichte einge-
pendelt. Haben wir doch heute in den Nordwestalpen Bestände von rund 1,5 Luchsen auf
hundert Quadratkilometer, die jährlich bis zu über 80 Schafe reissen. Ebenfalls sind die
Rehbestände im Kanton Bern, vor allem im westlichen Berner Oberland, stark zurückge-
gangen und werden sich ohne Eingriff in den Luchsbestand nicht mehr erholen.
Das Ziel des Jagd- und Wildschutzgesetzes, durch die Jagd eine nachhaltige Nutzung des
Wildes zu gewährleisten, kann im westlichen Oberland bei der Rehjagd bei weitem nicht
mehr erfüllt werden.
Die jährlich gelösten Jagdpatente im Kanton Bern sind rückläufig, was sich auf die Ein-
nahmen des Kantons Bern negativ auswirkt. Diese Zunahme von Wölfen und ein so hoher
Luchsbestand werden die Jagdpatenteinnahmen von heute rund 2,2 Mio. Franken jährlich
gefährden.
Geschäfts-Nr.: 2010-9681 Seite 1/2
12Es werden im Kanton Bern tausende von Arbeitsstunden geleistet, die der Steuerzahler
teuer bezahlt, um das Zusammenleben von Luchs und Wolf mit unseren Nutztieren zu
ermöglichen. Für Tiere, die keinen geeigneten Lebensraum in der Schweiz und schon gar
nicht im Kanton Bern finden sowie nicht vom Aussterben bedroht sind, stehen die Aufwen-
dungen in keinem Verhältnis.
Gehören im Kanton Bern die gepflegten Wiesen mit weidenden Kühen, Ziegen und Scha-
fen, die unsere natürliche Berglandschaft schmücken, mittelfristig der Vergangenheit an?
Müssen die Bauernfamilien in Zukunft vermehrt um ihre Tiere oder sogar um ihre Kinder
auf den langen Schulwegen bangen? Sind unsere Touristen auf den Wanderungen noch
sicher?
Diese und noch weitere Fragen haben den National- und Ständerat bewogen, Massnah-
men zu treffen, um den Wolf schweizweit zum Abschuss freizugeben. Luchs und Wolf
müssen aus diesen Gründen auch im Kanton Bern zum Abschuss freigegeben werden.
Geschäfts-Nr.: 2010-9681 Seite 2/2
13Kanton Bern Parlamentarische Vorstösse
Canton de Berne Interventions parlementaires
Vorstoss-Nr: 187-2010
Vorstossart: Motion
Eingereicht am: 25.10.2010
Eingereicht von: Berger (Aeschi , SVP) (Sprecher/ -in)
Rösti (Kandersteg, SVP)
Weitere Unterschriften: 0
Dringlichkeit:
Datum Beantwortung:
RRB-Nr:
Direktion:
Weniger Schutz für den Wolf - Umsetzung der vom Nationalrat angenommenen Vor-
stösse
Der Regierungsrat wird aufgefordert, die verschiedenen vom Nationalrat angenommenen
Vorstösse zur Thematik Wolf unverzüglich im Kanton Bern umzusetzen.
Begründung:
Am 30. September 2010 hat sich der Nationalrat mit diversen Vorstössen zum Umgang mit
dem Wolf auseinandergesetzt. Nach dem Willen des Nationalrates sollen die Wolfsbe-
stände in der Schweiz reguliert werden. Sowohl der Nationalrat als auch der Ständerat
(Motion Fournier, CVP, VS) fordern den Bundesrat unter anderem auf, eine Änderung der
Berner Konvention zu erwirken, mit dem Ziel, den Wolfsschutz aufzuweichen. Falls dies
nicht möglich ist, soll die Schweiz den Vertrag kündigen. Ein späterer Beitritt zu diesem
Übereinkommen würde dann aber nur mit einem Vorbehalt erfolgen.
Der Schutz des Wolfes darf nicht über den Schutz der Nutztiere gestellt werden. Wölfe
gefährden die sinnvolle Bewirtschaftung unserer Weiden und Alpen. Schäden an Nutztie-
ren können trotz Herdenschutzmassnahmen nicht vollumfänglich verhindert werden.
Es wird Dringlichkeit verlangt.
Geschäfts-Nr.: 2010-9682 Seite 1/1
14I 027/2010 VOL
Interpellation
Schmid, Achseten (SVP)
Weitere Unterschriften: 0 Eingereicht am: 02.03.2010
Grossraubtiere jagen wahllos
Gehören im Kanton Bern die gepflegten Wiesen mit weidenden Kühen, Ziegen und
Schafen, die unsere natürliche Berglandschaft schmücken, mittelfristig der Vergangenheit
an?
Mit grossem Fleiss und harter Arbeit wird die Landschaft von unseren Bauernfamilien im
Kanton Bern bewirtschaftet. Schon sehr jung lernen die Kinder, wie man mit Tieren umgeht
und dass man ihnen keine Schmerzen zufügen darf. Vielmals gibt es von Kind zu Tier sehr
enge und starke Verbindungen und Freundschaften. Schmerzhaft und unverständlich ist es,
wenn die Bauernfamilien ihre Tiere am Morgen auf den Weiden mit grossen Schmerzen,
halb zerrissen oder tot auffinden müssen. Immer schneller breitet sich der Wolf auch im
Kanton Bern aus. Der vergangene Alpsommer, mit den zunehmenden Wolfsrissen hat
deutlich gezeigt, dass der Wolf im Vormarsch ist und ein vernünftiges Zusammenleben von
freilebenden Kühen, Schafen und Ziegen mit dem Wolf eine Illusion ist. Gemäss
Zeitungsberichten leben in der Schweiz schon jetzt 12 Wölfe. Diese kosten den Bund und
die Kantone jährlich rund 1 Million Franken. Im Grenzgebiet zwischen dem Kanton Bern
und Freiburg streifen ein Wolf und eine Wölfin umher; es ist anzunehmen, dass sie sich
finden und eine Familie bilden. Der Lebensraum für Wolfsrudel ist leider in der Schweiz,
aber vor allem im Kanton Bern, nicht mehr vorhanden.
Die Bauernfamilien müssen in Zukunft vermehrt um ihre Tiere oder sogar um ihre Kinder
auf den langen Schulwegen bangen.
1. Will die Regierung zuschauen, wie Menschen von Raubtieren angegriffen oder sogar
getötet werden, und auch die Verantwortung dafür übernehmen?
2. Wie lange will die Regierung noch zuschauen, wie Nutztiere bei lebendigem Leib
zerrissen werden und leiden müssen, bis sie durch einen erlösenden Schuss zur Ruhe
kommen?
3. Muss der Luchs, Wolf und Bär mit allen möglichen Mitteln im Kanton Bern angesiedelt
werden, auch wenn der Lebensraum für diese Tiere nicht mehr vorhanden ist?
4. Will die Regierung den vom Bund geöffneten Schutzstatus für Problemwölfe umsetzen,
wenn ja, wie?
Ich hoffe, wir können unsere Kinder weiterhin sorglos auf den Schulweg schicken, und noch
lange die Glocken der Kühe, das Meckern der Ziegen, und das Blöken der Schafe auf
unseren Naturwiesen hören. Auch für den Tourismus ist eine gepflegte Berglandschaft mit
weidenden Kühen, Ziegen, und Schafen zwingend zu erhalten.
15I 212/2009 VOL 2. Dezember 2009 VOL C
Interpellation
2081 Graber, Horrenbach-Buchen (SVP)
Reber, Schangnau (SVP)
Weitere Unterschriften: [Anzahl] Eingereicht am: 02.06.2009
Wildtierbestände - Wildtierschäden
Ausgangslage:
Trotz starkem Bevölkerungswachstum, trotz Landverbrauch und Verkehrszunahmen, trotz
starker Entwicklung des Tourismus und weiterer Freizeitaktivitäten haben die Wildbestände
seit Mitte des letzten Jahrhunderts grösstenteils deutlich zugenommen (Ausnahmen wie
der Feldhase und das Auerhuhn bestätigen die Regel). Das freut grosse Teile der
Bevölkerung und ist das Verdienst einer umsichtigen kantonalen Jagdplanung. Die
Wildbestände sind stark genug geworden, dass sie auch die Entwicklung von
Raubtierbeständen erlauben. Auch die Greifvogelbestände haben sich von früheren
Tiefständen erholt. Neuerdings will der Kanton die Wildtiere u.a. mit Betretverboten
vermehrt vor Störungen schützen, um die Wildbestände weiter zu vermehren.
Demgegenüber richten Wildtiere erheblichen Schaden an landwirtschaftlichen Kulturen, an
Nutztieren und am Wald an. So schön es ist, Hirsche in freier Wildbahn zu sehen: diese
Tiere sind da und dort mittlerweile zu einem Problem geworden z.B. in grösseren Gebieten
am rechten Thunerseeufer. Mehr Wild und mehr Raubtiere, das ist nicht einfach nur besser.
Es gilt, unter Abwägung der verschiedenen Interessen (u.a. Jagd, Naturschutz, Tourismus,
Land- und Forstwirtschaft) ein Optimum zu erwirken.
Ähnliches spielt sich an den Gewässern ab, wo sich Fischer und Vogelschützerinnen
wegen Äschen, Forellen, Kormoranen und Graureihern dauernd in den Haaren liegen.
Der Regierungsrat wird deshalb ersucht, folgende Fragen zu beantworten:
1. Welche Bestände (in absoluten Zahlen; evtl. unterteilt nach Wildräumen oder
Kantonsteilen) werden mit der Jagdplanung bei den verschiedenen Wildtierarten
angestrebt, namentlich beim Rothirsch, bei der Gämse, beim Steinbock, beim Reh,
beim Luchs und beim Wolf? Wo liegen die Grenzen zwischen zu wenig, genug und
zuviel?
2. Wie haben sich die Vergütungen für Wildschäden in den letzten 20 Jahren im Kanton
Bern entwickelt (in Fr.; evtl. unterteilt nach Tierarten), welche jährliche Schadensumme
wird als vertretbar erachtet und aus welchen „Kassen“ kommt das Geld dafür?
3. Welche Strategie wird verfolgt, um die Zielgrössen (gemäss Fragen 1 und 2) zu
erreichen (... wenn z.B. wie im letzten Herbst nicht einmal Nach- und Sonderjagden auf
den Rothirsch zum Erfolg führen oder wenn sich der Feldhasenbestand im Mittelland
einfach nicht erholen will)?
4. Welche Strategie wird im Kanton Bern im Spannungsfeld Fischerei – Vogelschutz
verfolgt?
Es wird Dringlichkeit verlangt. Abgelehnt: 08.06.2009
162
Antwort des Regierungsrats
Wie in der Interpellation richtig dargelegt wird, bestehen im Kanton Bern heute
grundsätzlich gute Wildtierbestände, insbesondere bei Schalenwild wie Rothirsch, Gämse,
Reh, Steinbock und Wildschwein.
Wildtiere werden aber immer stärker durch Störungen aller Art in ruhigere Gebiete
abgedrängt und verursachen dort zum Teil Schäden am Jungwuchs von Bäumen. Mit
Wildschutzgebieten sollen in Zukunft wichtige Lebensräume besser vor Störungen
geschützt werden, damit Konzentrationen und damit übermässige Schäden beispielsweise
in empfindlichen Bergwäldern vermieden werden können.
Die vom Interpellanten angesprochene Abwägung zwischen den verschiedenen
Interessen ist durch die Jagdgesetzgebung vorgeschrieben und wird insbesondere im
Rahmen der Jagdplanung berücksichtigt (vgl. Art. 3 des Gesetzes vom 25. März 2002
über Jagd und Wildtierschutz [JWG; BSG 922.1]).
Der Regierungsrat nimmt zu den einzelnen Fragen wie folgt Stellung:
Zu Frage 1:
Im Rahmen der Jagdplanung muss einerseits ein naturnah strukturierter Wildbestand
geschaffen und erhalten werden, anderseits darf dieser Bestand zu keinen untragbaren
Wildschäden führen. Die Jagdplanung wird für alle wichtigen Schalentiere durchgeführt
und erfolgt regional differenziert in sog. Wildräumen. Für jeden Wildraum werden dabei die
anzustrebenden Wildtierbestände festgelegt. Anhand der Grundlagen wie
Frühjahrsbestand, Fallwild, Vorjahresjagdstrecke, Einfluss von Raubtieren und
Wildschadensituation wird festgelegt, ob der Bestand innerhalb des Wildraums
angehoben, belassen oder gesenkt werden soll (vgl. Art. 3 der Jagdverordnung vom 26.
Februar 2004 [JaV; BSG 922.111]). Daraus resultiert die geplante Jagdstrecke. Am Ende
eines jeden Jagdjahres wird die erzielte Jagdstrecke mit der Jagdplanung verglichen und
im Jahresbericht des Jagdinspektorats publiziert (vgl. Homepage des Jagdinspektorats
des Kantons Bern). Falls notwendig, stehen dem Kanton weitere Instrumente wie
Sonderabschüsse zur Verfügung.
Zu Frage 2:
Art. 3 Abs. 1 der Verordnung vom 22. November 1995 über die Verhütung und
Entschädigung von Wildschäden (WSV; BSG 922.51) sieht vor, dass Schäden, die
jagdbare Tiere an Wald, landwirtschaftlichen Kulturen und Nutztieren sowie in
eidgenössischen Jagdbanngebieten anrichten, angemessen entschädigt werden. Die
finanziellen Aufwendungen für die Entschädigung von Wildschäden blieben in den letzten
20 Jahren mit rund Fr. 120’000.-- pro Jahr relativ stabil. Nebst der Vergütung von Schäden
werden auch Projekte zur Wildschadenverhütung unterstützt, wobei die Höhe der
Aufwendungen in den letzten 20 Jahren zwischen Fr. 170'000.-- (1999) und Fr. 390'000.--
(2007) schwankte. In Anbetracht der Grösse des Kantons Bern und im Vergleich zu
anderen Kantonen erachtet der Regierungsrat die Aufwendungen für Vergütung und
Verhütung von Wildschaden insgesamt als tragbar.
Die finanziellen Aufwendungen zur Verhütung und Entschädigung von Wildschäden
werden aus dem Wildschadenfonds (vgl. Art. 24 JWG) beglichen. Der Wildschadenfonds
ist eine Spezialfinanzierung und wird vorwiegend durch zweckgebundene Zuschläge auf
den Jagdpatentgebühren geäufnet. Weitere Beiträge leisten Bund und Kanton (vgl. Art. 13
Abs. 1 JWG).
Zu Frage 3:
Der Kanton Bern erreicht naturnah strukturierte Wildbestände primär durch die
Instrumente der Jagdplanung. Für einzelne Wildarten wurde zudem eine spezielle
Strategie geschaffen. So entwickelte das zuständige Jagdinspektorat in Zusammenarbeit
mit einer breit abgestützten Arbeitsgruppe ein Rothirschkonzept, das am 29. Mai 2006 von
173
der Volkswirtschaftsdirektion genehmigt wurde. Dieses Konzept soll einen angemessenen
Schutz des Rothirsches unter gleichzeitiger jagdlicher Nutzung gewährleisten und in
Konfliktsituationen Entscheidhilfen bieten.
Der Regierungsrat ist sich bewusst, dass die Jagdplanung allein nicht jedes
Bestandsproblem zu lösen vermag. So ist der tiefe Bestand an Feldhasen im Kanton Bern
unter anderem mit ungeeigneten Lebensräumen ohne Hecken und Buntbrachen zu
erklären. Der Regierungsrat fördert daher eine naturnahe Landwirtschaft mit
entsprechenden ökologischen Ausgleichsflächen und unterstützt Massnahmen zum
Schutz von Lebensräumen bedrohter Tier- und Pflanzenarten.
Zu Frage 4:
Die Kantone sind aufgrund der Bundesgesetzgebung über die Fischerei verpflichtet, in
ihrem Bestand bedrohte Fisch- und Krebsarten zu schützen. Im Kanton Bern wurden in
den vergangenen 20 Jahren grosse Anstrengungen unternommen. Im Bereich derjenigen
fischfressenden Vögel, deren Bestand gesichert ist, wurden bereits mehrere konkrete
Massnahmen eingeleitet und umgesetzt:
• Die Jagdzeit auf den Kormoran wurde ab der Jagdzeit 2008/2009 um einen Monat,
d.h. bis 31. Januar verlängert.
• Der Gänsesäger ist eine bundesrechtlich geschützte Vogelart. Der Kanton Bern hat
beim Bund beantragt, den Gänsesäger auf die Liste der jagdbaren Arten
aufzunehmen und einen eidgenössischen Managementplan zu erarbeiten.
• Auch der Graureiher ist bundesrechtlich geschützt. Das vom Bund in den
Achtzigerjahren herausgegebene Konzept „Graureiher und Fischerei“ hat sich
bewährt und wird im Kanton Bern auch weiterhin konsequent umgesetzt.
Der Regierungsrat ist überzeugt, dass diese Instrumente das Spannungsfeld Fischerei-
Vogelschutz bereits deutlich entschärfen konnten.
An den Grossen Rat
18I 201/2006 VOL 7. März 2007 VOL C
Interpellation
0416 Schmid, Achseten (SVP)
Weitere Unterschriften: 0 Eingereicht am: 11.09.2006
Den Luchsbestand sinnvoll bewirtschaften
Der Luchsbestand hat sich im Berner Oberland auf ein untragbares Mass vermehrt. Der
Reh- und Gämsebestand ist auf ein erschreckend tiefes Niveau gesunken, und ist immer
noch sinkend. Durch den Rückgang des Schalenwildes sind auch die landwirtschaftlichen
Nutztiere vermehrt gefährdet. Bei einer Tollwuterkrankung der Luchse könnte dieser hohe
Bestand auch für den Menschen sehr gefährlich werden.
Durch den Rückgang der jährlich gelösten Jagdpatente wird auch der volkswirtschaftliche
Nutzen der Jagd für den Kanton immer kleiner werden.
Ein gesund strukturierter Wildbestand braucht den selektiven Eingriff durch die Jagd.
Das Gesetz über Jagd- und Wildtierschutz erfüllt unter diesen Umständen sein Ziel (JWG,
Art.1) nicht mehr.
Das JWG verfolgt die Ziele:
a durch die Jagd eine nachhaltige Nutzung des Wildes zu gewährleisten und naturnah
strukturierte Bestände zu fördern.
e eine attraktive und weidgerechte Patentjagd mit einer starken Eigenverantwortung der
Jägerinnen und Jäger zu fördern.
Angesichts dieser prekären Lage müsste die Behörde handeln.
Der Regierungsrat wird um die Beantwortung folgender Fragen gebeten:
1. Wie schätzt die Regierung die Lage ein?
2. Was gedenkt der Regierungsrat zu tun, um den Reh- und Gämsebestand anzuheben?
3. Was gedenkt der Regierungsrat zu tun, um den Luchbestand auf ein tragbares Mass
zu senken?
4. Welche Entschädigungen wurden in den letzten Jahren durch den vom Luchs an
landwirtschaftlichen Nutztieren verursachten Schäden im Kanton Bern entrichtet?
5. Aus welcher Kasse werden die Luchsprojekte bezahlt? Und was kostet es den Kanton
Bern?
6. Ist für den Regierungsrat Handlungsbedarf vorhanden? Wenn ja, in welchem
Zeitfenster gedenkt er zu handeln?
Es wird Dringlichkeit verlangt. Abgelehnt: 23.11.2006
192
Antwort des Regierungsrats
1. Wie schätzt die Regierung die Lage ein?
Die hohen Reh- und Gämswildbestände der neunziger Jahre führten zu untragbaren
Wildschäden an Wäldern und landwirtschaftlichen Kulturen. Seither gingen die
Bestände - speziell im Berner Oberland - deutlich zurück. Für diese Entwicklung gibt
es verschiedene Ursachen. Im Vordergrund stehen der verstärkte Jagddruck auf die
genannten Wildarten, der hohe Luchsbestand, die Gämsblindheit und zwei strenge
Winter. Obwohl die Jagd in der Zwischenzeit reduziert worden ist, sind die Reh- und
Gämswildbestände noch nicht wieder auf das erhoffte Niveau angestiegen.
Die gemäss Artikel 1 des Gesetzes vom 25. März 2002 über Jagd und Wildtierschutz
(JWG; BSG 922.11) verfolgten Ziele liegen nicht ausschliesslich bei einer durch die
Jagd gewährleisteten nachhaltigen Nutzung des Wildes und der Förderung einer
attraktiven und weidgerechten Patentjagd mit starker Eigenverantwortung der
Jägerinnen und Jäger. Weitere gleichwertige Ziele des JWG sind der Schutz
bedrohter Arten, die Begrenzung der von Wildtieren verursachten Schäden auf ein
tragbares Mass sowie die Förderung der Zusammenarbeit von Jagd, Wald- und
Landwirtschaft, Tourismus und Sport, Schutzorganisationen und Behörden.
Die Resultate des Fotofallenmonitorings des Winters 2005/2006 zeigen, dass die
Luchsbestände in den beiden untersuchten Regionen Haslital – Obwalden -
Nidwalden - Luzern und Simmental - Saanenland - Pays d’Enhaut - Freiburger
Voralpen - Waadtländer Alpen steigende Tendenz aufweisen. Im westlichen Berner
Oberland war es bereits die vierte Erhebung seit 1998. Im östlichen Berner Oberland
und der Zentralschweiz war es das zweite Monitoring. Die Erhebungen im
vergangenen Winter ergaben für das Referenzgebiet im westlichen Oberland eine
Besiedlungsdichte von zirka 1.5 Luchsen pro 100 km2. Im östlichen Oberland schätzt
das KORA (Koordinierte Forschungsprojekte zur Erhaltung und zum Management der
Raubtiere in der Schweiz) die Besiedlungsdichte auf zirka 1.04 Luchse pro 100 km2.
Mit dem Konzept Luchs Schweiz steht ein Instrument für einen sinnvollen,
zukunftsgerichteten Umgang mit dem Luchs zur Verfügung. In diesem Konzept und in
der übergeordneten Bundesgesetzgebung sind die Kriterien und Voraussetzungen für
Eingriffe in die Luchsbestände verankert. So sind Eingriffe nur dann möglich, wenn
der Nachweis erbracht werden kann, dass einerseits der Luchsbestand zunimmt und
andererseits der Luchs die Reh- und Gämswildbestände über mehrere Jahre derart
stark dezimiert hat, dass eine nachhaltige Nutzung des Wildes durch die Jagd nicht
mehr erreicht werden kann. Zudem muss der Beweis erbracht werden, dass die
natürliche Verjüngung des Waldes gewährleistet ist und andere Sterblichkeitsfaktoren
beim Reh- und Gämswild ausgeschlossen werden können.
Auch wenn die Reh- und Gämswildbestände im Berner Oberland im Vergleich zu den
neunziger Jahren auf ein tieferes Niveau gesunken sind, erachtet der Regierungsrat
die Jagd im Kanton Bern im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe e JWG nach wie
vor als attraktiv, weidgerecht und von starker Eigenverantwortung der Jägerinnen und
Jäger geprägt. Gleichzeitig konnten die teilweise untragbaren Schäden an
landwirtschaftlichen Kulturen und am Wald deutlich herabgesetzt werden.
2. Was gedenkt der Regierungsrat zu tun, um den Reh- und Gämsbestand
anzuheben?
Seit Inkrafttreten des JWG vor fünf Jahren wurde der Kanton Bern in 18 Wildräume
eingeteilt und die Jagdplanung dementsprechend angepasst und regionalisiert.
Anders als früher stellt die neue Jagdplanung auf die im Frühjahr erfassten Bestände
ab. Mitberücksichtigt werden zudem Faktoren wie der jeweilige Lebensraum, das
Störpotenzial, der Einfluss von Raubtieren und die Wildschadensituation. Die
Wildbewirtschaftung erfolgt heute in kleineren regionalen Wildbewirtschaftungsräumen
203
und nicht mehr wie früher in den Grossräumen Oberland, Mittelland und Berner Jura.
Fünf Jahre nach Einführung der neuen, regionalisierten Jagdplanung kann eine
positive Bilanz ihrer Wirkung gezogen werden. Vor allem kann mit der regional nach
Wildräumen differenzierten Bejagung den örtlichen Verhältnissen besser Rechnung
getragen werden als früher. Die regional differenzierte Jagdplanung ist somit eines der
wichtigsten Instrumente zur Beeinflussung der jagdbaren Wildtierbestände, zur
Sicherung einer nachhaltigen Bewirtschaftung und zur Vermeidung von untragbaren
Wildschäden.
Der Regierungsrat ist überzeugt, dass diese Massnahmen, zusammen mit der
Umsetzung des Konzeptes Luchs Schweiz und dem geplanten Konzept zur Reduktion
der flächendeckenden Störungen (Schaffung von Wildschutzgebieten) dazu führen
wird, dass sich die Reh- und Gämswildbestände mittelfristig wieder erholen werden.
3. Was gedenkt der Regierungsrat zu tun, um den Luchsbestand auf ein
tragbares Mass zu senken?
Anfangs 2000 haben der Kanton Bern und 15 weitere Kantone dem damaligen
BUWAL betreffend Vollzug des Konzepts Luchs Schweiz verschiedene Bedingungen
gestellt, unter anderem dass die Kompetenz zum Abschuss von schadenstiftenden
Luchsen bei den Kantonen liegen muss. In der Folge hat der Bund den Kantonen
diese Kompetenz übertragen. Von 1999 bis heute wurden im Kanton Bern drei
besonders schadenstiftende Luchse durch die Wildhut erlegt (1999, 2001 und 2002).
Falls die im Konzept Luchs Schweiz verlangten und in der Antwort zu Frage 1
dargelegten Kriterien erfüllt sind, kann der Kanton als Vollzugsbehörde beim
Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
(UVEK) für den entsprechenden Lebensraum (Kompartiment) ein begründetes
Regulierungsgesuch stellen. Erst wenn eine Umsiedlung von Luchsen nicht möglich
ist, kann das UVEK im betroffenen Kompartiment einen Regulierungsabschuss
bewilligen, welcher wie erwähnt durch den betroffenen Kanton vorzunehmen ist.
In diesem Sinne hat der Kanton Waadt nach Rücksprache mit den Kantonen Bern und
Freiburg im Juni 2006 beim UVEK den Antrag gestellt, ab 2006 bis 2008 insgesamt
fünf Luchse aus den Waadtländer Alpen in den Jura umzusiedeln. Damit soll der
Bestand in den Nordwestalpen reduziert und gleichzeitig die Population im Jura
gestärkt werden. Zusätzlich werden voraussichtlich im Winter 2006/2007 zwei weitere
Luchse in die Ostschweiz umgesiedelt, um auch dort den Luchsbestand weiter zu
stützen. Der Regierungsrat ist der Auffassung, dass zuerst die Auswirkungen dieser
Massnahmen abzuwarten sind, bevor über einen allfälligen (weitergehenden) Eingriff
in den Luchsbestand im Berner Oberland zu entscheiden ist.
4. Welche Entschädigungen wurden in den letzten Jahren durch den vom
Luchs an landwirtschaftlichen Nutztieren verursachten Schäden im Kanton
Bern entrichtet?
Aus der untenstehenden Aufstellung gehen die jährlich geleisteten
Entschädigungssummen im Kanton Bern in den Jahren 1995 bis 2006 hervor. An diese
Entschädigungen leistete der Bund in den letzten Jahren einen Anteil von jeweils 80
Prozent. Vor Inkrafttreten des JWG gingen die Entschädigungen vollumfänglich
zulasten des Wildschadenfonds; der Bundesanteil an den Entschädigungssummen lag
damals zwischen 50 und 80 Prozent.
214
Jahr Entschädigungssumme in Franken,
davon übernimmt der Bund im
Moment 80 Prozent
1995 8'400.-
1996 16'300.-
1997 13'657.-
1998 27'269.-
1999 37'248.-
2000 19'100.-
2001 26'108.-
2002 62'001.-
2003 12'945.-
2004 9'645.-
2005 19'600.-
2006 5'200.-
Die Belastung für den Kanton Bern ist somit relativ gering, sie betrug beispielsweise
2006 Fr. 1'040.-, 2005 Fr. 3'920.- und 2004 Fr.1'929.-.
5. Aus welcher Kasse werden die Luchsprojekte bezahlt? Und was kostet es
den Kanton Bern?
Bedingt durch die Zunahme der Luchspräsenz in den schweizerischen Nordwestalpen
ab dem Jahr 1996 und die zunehmenden Übergriffe des Luchses auf Schafherden
haben die Kantone Bern, Waadt und Freiburg zusammen mit dem BUWAL und dem
KORA zur Abklärung verschiedener Fragen ein dreijähriges Luchsprojekt (1997 bis
1999) lanciert. Dafür wendete der Kanton Bern Fr. 30'000.- auf. Für eine bessere
Überwachung und Erfassung der Luchsbestände ist der Einsatz von Fotofallen
unumgänglich. Das Jagdinspektorat hat deshalb letztes Jahr 12 Fallen für insgesamt
Fr. 9'813.15 angeschafft. Daneben hat der Kanton Bern in den 10 letzten Jahren keine
weiteren Geldmittel für das Luchsmonitoring eingesetzt.
6. Ist für den Regierungsrat Handlungsbedarf vorhanden? Wenn ja, in welchem
Zeitfenstern gedenkt er zu handeln?
Der Regierungsrat ist der Ansicht, dass heute im Kanton Bern die Instrumente für
einen sinnvollen und zukunftsgerichteten Umgang mit dem Luchs vorhanden sind. In
Bezug auf die in der Interpellation angesprochenen Reh- und Gämswildbestände im
Berner Oberland gilt es vorerst die Ergebnisse der Luchsumsiedlungen aus den
Waadtländer Alpen in den Jura und in die Ostschweiz abzuwarten. Für den
Regierungsrat besteht damit - wie in der Antwort zu Frage 3 ausgeführt - kein
unmittelbarer Handlungsbedarf zum Eingriff in die Luchsbestände, zumal der hierfür
erforderliche Nachweis gemäss Konzept Luchs Schweiz im heutigen Zeitpunkt nicht
erbracht werden könnte. Sollte sich im Verlauf der nächsten zwei Jahre zeigen, dass
die Luchsbestände im Berner Oberland trotz den ergriffenen Massnahmen weiter
ansteigen und sich die Reh- und Gämswildbestände nicht erholen, wird ein Eingriff in
die Luchsbestände erneut zu prüfen sein.
An den Grossen Rat
22Sie können auch lesen