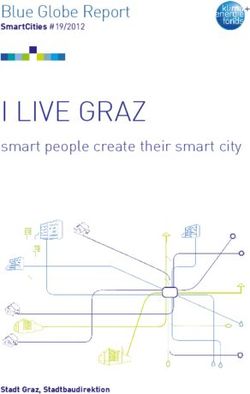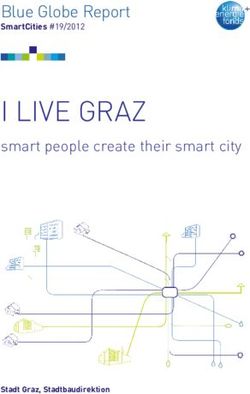Neue Energien 2020 Forschungs- und Technologieprogramm 3. Ausschreibung 2009 Leitfaden für die Projekteinreichung - Wien, Juni 2009 - Klima- und ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Neue Energien 2020
Forschungs- und
Technologieprogramm
3. Ausschreibung 2009
Leitfaden für die
Projekteinreichung
Foto: flickr©wolfgangs
Wien, Juni 2009NEUE ENERGIEN 2020 ist das Forschungs- und Technologieprogramm des Klima- und Energiefonds.
Es baut auf den Ergebnissen des Strategieprozesses ENERGIE 2050 auf, setzt thematische Linien der Aus-
schreibungen Neue Energien 2020 1. und 2. Ausschreibung fort und berücksichtigt die besonderen Anlie-
gen und Schwerpunktsetzungen des Klima- und Energiefonds.
Das Programm unterstützt besonders die Erreichung der österreichischen Energie- und Klimaziele der
EU für 2020. Es wird im Auftrag des Klima- und Energiefonds von der Österreichischen Forschungsförde-
rungsgesellschaft (FFG) und bei Infrastrukturvorhaben von der Kommunalkredit Public Consulting GmbH
(KPC) abgewickelt.
Neue Energien 2020Inhaltsverzeichnis
Vorwort 4
01 Das Wichtigste in Kürze 6
02 Ausrichtung und Ziele des Programms 8
2.1 Ausgangssituation 8
2.2 Ausrichtung des Programms 9
2.3 Programmstrategie 9
2.4 Programmziele 10
03 Themenfelder der Ausschreibung 11
3.1 Energiesysteme, Netze und Verbraucher 12
3.2 Fortgeschrittene Speichertechnologien 19
3.3 Energieeffizienz in Industrie und Gewerbe 21
3.4 Energieeffiziente Fahrzeugkomponenten und –systeme 23
3.5 Solarthermie 25
3.6 Photovoltaik 29
3.7 Bioenergie und fortschrittliche Umwandlungstechnologien 30
3.8 Sonstige erneuerbare Energieträger 32
3.9 Strategische Entscheidungsgrundlagen für die Österreichische Technologie-, 33
Klima- und Energiepolitik
04 Administrative Hinweise 36
4.1 Teilnahmeberechtigte bzw. Zielgruppen 36
4.2 Budget 36
4.3 Projektarten und Finanzierungsintensitäten 36
4.4 Anerkennbare Kosten bei Förderungen 46
4.5 Verwertungsrechte 48
4.6 Beurteilungskriterien 49
4.7 Rechtsgrundlagen und EU-Konformität 50
05 Ablauf 51
5.1 Einreichung und Beratung 51
5.2 Auswahl der Projekte 51
5.3 Vertragserrichtung 53
5.4 Auszahlungsmodalitäten und Berichtswesen 53
06 Kontakte 54
6.1 Programmauftrag und -verantwortung 54
6.2 Programmabwicklung 54
07 Anhang 56
7.1 Weiterführende Informationen zu Personalkosten 56
7.2 Weitergehende Informationen zu Gemeinkosten 58
7.3 Umsatzsteuer 59
7.4 KMU Definition 59
Neue Energien 2020 Vorwort
Für die nächsten Jahrzehnte zeichnen sich deut- tigung. Das sind die Fakten. Die Herausforderung
liche Veränderungen unseres Energiesystems wendet sich an uns. Wir brauchen eine kluge Politik
ab. Bis zum Jahr 2030 wird – soferne es nicht und – das sehen wir immer deutlicher – moderne
gelingt, den Bedarf dramatisch zu senken - eine Energietechnologien.
Energienachfrage von zusätzlich 55 % erwartet:
die Weltbevölkerung wächst und mit ihr steigt der Österreichs Zukunft auf dem Gebiet von Forschung
Energiebedarf an. Die Reduktion des Bedarfes und und Entwicklung liegt vor allem bei den Techno-
die Bereitstellung der benötigten Energie ist eine logien, bei denen wir der internationalen Entwick-
gewaltige Herausforderung unserer Zeit. Aufgabe lung voraus sind. Hier muss man ansetzen, denn
ist es nun, alte Trends aufzubrechen, um so rasch eines wird immer deutlicher: Die einzige Quelle für
als möglich von unserer jetzigen Wirtschaftsweise wirkliche Wettbewerbsvorteile in einer globalen
in eine CO2-ärmere Zukunft zu gelangen und dabei Wirtschaft sind Technologien, die niemand an-
gleichzeitig neue Märkte für die Zukunft zu eröff- derer besitzt und alle haben wollen. Wichtig sind
nen. Der Klimawandel ist evident und zeigt bereits auch: eine effektive Kooperation von Wirtschaft
negative Auswirkungen. Das Gebot der Stunde und Wissenschaft; eine beständige Evaluierung zur
ist es, alle Möglichkeiten zu nutzen, um aus der Qualitätssicherung und schließlich kosteneffiziente
Verbrennung fossiler Energieträger auszusteigen, Förderung, d. h., welche Maßnahmen liefern den
Energie zu sparen und in neue Basistechnologien größtmöglichen nachhaltigen Beitrag für einen
zu investieren. Nur so können wir industrielle und Fördereuro?
gesellschaftliche Prozesse grundlegend verändern.
Es besteht breite Übereinstimmung darüber, dass Der Fonds verfolgt mit der Förderung von For-
nur Innovationen einen Vorsprung im globalen schung und Entwicklung moderner Energietechno-
Wettbewerb verschaffen und nur innovative Pro- logien zwei Generalziele: Zunächst soll die Förde-
dukte und Dienstleistungen unsere Arbeitsplätze rung eine auf lange Sicht sichere, wirtschaftliche
in diesem globalen Wettbewerbsumfeld nachhaltig und umweltverträgliche Versorgung mit Energie
sichern und nur neue Technologien den breiten gewährleisten. Der Schlüssel dabei liegt für mich
Anspruch auf dauerhafte Steigerung der Energieef- unumstritten bei Energieeffizienz. Darüber hinaus
fizienz erfüllen können. Seit mehr als 30 Jahren zielt die Förderung darauf ab, die technologischen
reden wir über die Erschöpfung der Vorräte an Öl Optionen zu sichern und zu erweitern und dadurch
und Gas, die Energiearmut in vielen Entwicklungs- die Flexibilität der Energieversorgung Österreichs
ländern, die wachsende Abhängigkeit der Industrie- auch gegenüber unvorhersehbaren Entwicklungen
länder von Energieimporten, die drohende Gefahr zu verbessern.
von möglichen Klimaänderungen als Folge der
zunehmenden Konzentration von energiebedingten Eine Energieversorgung ist sicher, wenn man mehr
Treibhausgasen in der Atmosphäre und über die Energie hat, als man braucht. Diese Definition um-
Risiken hoher Ölpreise für Wachstum und Beschäf- fasst auch die Vorstellung, dass man mehr Tech-
Neue Energien 2020nikoptionen zur Verfügung hat, als man kurzfristig
benötigt. In Österreich lag der Importanteil am
Inlandstromverbrauch im Jahr 2008 bei rd.
29 % (Exportanteil 22 %). Ca. 20.000 GWh aus
dem sog. UCTE-Mix (Importanteil). Der UCTE-Mix
besteht zu 53 % aus fossiler Energie und zu 29 %
aus nuklearer Energie. Bei steigendem Energiever-
brauch wird sich die Energieabhängigkeit Öster-
reichs zunächst tendenziell vergrößern. Die Ener-
gieforschung leistet einen wichtigen Beitrag zu der
gesamtwirtschaftlichen Risikovorsorge.
Der Fonds ist angetreten, um mit Energiefor-
schungs- und Technologieentwicklung einen sicht-
baren Beitrag zur Restrukturierung des österrei-
chischen Energiesystems zu leisten. Dabei sind drei
klimapolitische Lösungen zu unterstützen: massive
Steigerung der Energieeffizienz, nachhaltige Re-
duktion fossiler Energieträger und optimale Distan-
zen beim Einsatz von Primärenergieträgern.
Sie haben die Möglichkeit, uns dabei zu unterstüt-
zen! Ich freue mich, auf Ihre innovativen, nachhal-
tigen Projektvorhaben und wünsche Ihnen für eine
erfolgreiche Teilnahme an unserer Ausschreibung
alles Gute.
Dr. Eveline Steinberger
Geschäftsführerin Klima- und Energiefonds
Neue Energien 2020 01. Das Wichtigste in Kürze
Der Klima- und Energiefonds ist ein wichtiges Ins- Zugelassene Projektarten:
trument der Österreichischen Bundesregierung für Zu den genannten Themenfeldern können unter-
das Setzen sichtbarer Impulse in der Klimapolitik. schiedliche Projektarten eingereicht werden.
Zur Unterstützung einer nachhaltigen Restruktu- Die Förderungen umfassen:
rierung des heimischen Energiesystems hat der Grundlagenforschung, Technische Durchführbar-
Klima- und Energiefonds das Forschungs- und keitsstudien, Industrielle Forschung, Experimentel-
Technologieprogramm Neue Energien 2020 ent- le Entwicklung, Demonstrations-Projekte. Es wer-
wickelt. den auch Dissertations- und Post-Doc Stipendien
gefördert. Als Forschungsaufträge werden Studien
Die 1. Ausschreibung ist von 19. März 2008 bis finanziert (siehe 3.9 Entscheidungsgrundlagen für
30. Mai 2008 gelaufen. Die 2. Ausschreibung von die Österreichische Klima- und Energiepolitik).
1. Oktober 2008 bis 30. Jänner 2009. Da die Projektarten in unterschiedlicher Höhe
gefördert bzw. finanziert werden, ist die richtige
Inhalte der 3. Ausschreibung: Zuordnung der Anträge wichtig (siehe dazu Kapitel
Die nachfolgend genannten Themenfelder zeigen 4.3 Projektarten und Finanzierungsintensitäten).
Fragestellungen auf, die den Zielsetzungen des
Forschungs- und Technologieprogramms des Der Schwerpunkt der Energieforschungs-
Klima- und Energiefonds besonders entsprechen. ausschreibung des Klima- und Energiefonds
1. Energiesysteme, Netze und Verbraucher
2. Fortgeschrittene Speichertechnologien
Energie-
systeme
3. Energieeffizienz in Industrie und Gewerbe
4. Energieeffiziente Fahrzeugkomponenten und –systeme
Energie-
effizienz
5. Solarthermie
6. Photovoltaik
Erneuerbare- 7. Bioenergie und fortgeschrittene Umwandlungstechnologien
Energie 8. Sonstige erneuerbare Energieträger
9. Strategische Entscheidungsgrundlagen für die österreichische Technologie-,
Energie- und Klimapolitik
10. „Themenoffen“ entsprechend der Zielsetzungen Neue Energien 2020
Abb: 1.1
Neue Energien 2020„Neue Energien 2020“ liegt entsprechend des er- Im Fall von Demonstrations-Anlagen wird der Pro-
warteten Zielbeitrages auf angewandter Forschung. jektantrag zusätzlich auch an die Kommunalkredit
Projekte der Grundlagenforschung sowie Studien Public Consulting GmbH zur Bearbeitung übermit-
werden nur in eingeschränktem Ausmaß der für telt. Die Prüfung der Fördervoraussetzungen und
die Ausschreibung zur Verfügung stehenden Mittel die Ausarbeitung eines Förderungsvorschlages
berücksichtigt. für den Investitionskostenanteil erfolgt durch die
Experten der KPC.
Einreichung von Vollanträgen (bis max. 2 Mio. Euro
beantragter Fördersumme) und Projektskizzen Für Projektskizzen (Projektbeschreibungen von
(mehr als 2 Mio. Euro beantragter Fördersumme, reduziertem Umfang mit einer beantragten Förder-
zweistufiges Verfahren) bis spätestens: summe größer 2 Mio. Euro), welche die Formal-
8.10.2009, 12:00 Uhr prüfung positiv bestanden haben, erfolgt die
via eCall bei der FFG, https://ecall.ffg.at/ fachliche und inhaltliche Jurierung inklusive eines
Forschungsförderungsgesellschaft (FFG), Hearings mit den Antragstellern. Jurierung und
Bereich Thematische Programme Hearing erfolgen durch unabhängige nationale und
Sensengasse 1, 1090 Wien internationale Experten, wobei alle mit dem Bewer-
tungsverfahren befassten bzw. bei der Jury-
Da knapp vor Ende der Einreichfrist technische sitzung anwesenden Personen zur Verschwiegen-
Probleme nie ausgeschlossen werden können, wird heit über die ihnen im Rahmen dieser Funktion be-
dringend empfohlen, die Einreichung nicht erst in kannt gewordenen Informationen verpflichtet sind.
den letzten 24 Stunden vorzunehmen.
Vorherige Registrierung zur Erlangung einer Die Einreichfrist für Vollanträge der zweiten Stufe
Projektnummer des Klima- und Energiefonds wird den Antragstellern von positiv entschiedenen
(unbedingt erforderlich): auf der Homepage des Projektskizzen gesondert bekannt gemacht. Der
Klima- und Energiefonds www.klimafonds.gv.at weitere Jurierungsablauf für ausgearbeitete För-
deransuchen über 2 Mio. Euro beantragter Förder-
summe entspricht jener für Vollanträge.
Einreichformulare und Sprache
Für die Einreichung sind unbedingt die entspre- Nach Abschluss der technisch-wissenschaftlichen
chenden Formulare von der Homepage zu ver- Jurierung werden die Projekte in den Gremien
wenden. Besonders wird auf die spezifischen des Klima- und Energiefonds behandelt. Die finale
Formulare für Projektskizzen hingewiesen. Für Förderentscheidung trifft das Präsidium des Klima-
Grundlagenforschungsprojekte und Studien ist eine und Energiefonds.
Einreichung in Englisch verpflichtend.
Behandlung von Vollanträgen über 2 Mio. Euro
Ablauf und Jurierung Vollanträge über 2 Mio. Euro beantragter Förder-
Für Vollanträge (vollständige Förderansuchen mit summe erhalten jedenfalls den Status „Projekt-
einer beantragten Fördersumme geringer skizze“ und werden entsprechend dem Verfahren
2 Mio. Euro), welche die Formalprüfung positiv für Projektskizzen zweistufig juriert. Nach allfäl-
bestanden haben, erfolgt die eigentliche fachliche liger positiver Begutachtung der „Projektskizze“
und inhaltliche Jurierung. Diese erfolgt durch un- wird der Antragsteller eingeladen, den Vollantrag
abhängige nationale und internationale Experten, einzureichen, welcher gesondert juriert wird.
wobei alle mit dem Bewertungsverfahren befassten
bzw. bei der Jurysitzung anwesenden Personen Informationen und Beratung:
zur Verschwiegenheit über die ihnen im Rahmen Österreichische Forschungsförderungs-
dieser Funktion bekannt gewordenen Informationen gesellschaft (FFG)
verpflichtet sind. E-mail: neue-energien-2020@ffg.at
www.neue-energien-2020.at
Außerdem erfolgt eine Überprüfung der wirtschaft-
lichen Leistungsfähigkeit (Bonität) der beteiligten
Unternehmen durch FFG-interne Experten. Im
Bedarfsfall können von der Förderstelle nähere
Erläuterungen den Antrag betreffend eingeholt
werden.
Neue Energien 2020 02. Ausrichtung und Ziele
des Programms
2.1 Ausgangssituation Emissionen verantwortlich ist, hat sich zwischen
1970 und 2005 mehr als verdoppelt.
In Anbetracht des global stark ansteigenden
Energiebedarfs, der Klimaproblematik und der Die Richtlinie „20 20 20 by 2020“ der Europäischen
zunehmenden Risiken bezüglich einer sicheren Kommission sieht eine Reduktion der Treibhaus-
Energieversorgung steht unser Energiesystem vor gas-Emissionen um 20 % und eine Steigerung des
notwendigen und einschneidenden Veränderungen. Anteils an erneuerbaren Energien auf 20 % in der
Selbst mit einer deutlichen klimapolitischen EU bis zum Jahr 2020 vor. Gemäß dem Klimapaket,
Wende lässt sich nach den Erkenntnissen des UNO- welches das Europäische Parlament im Dezem-
Expertengremiums IPCC der globale Klimawandel ber 2008 verabschiedet hat, soll Österreich seine
mit seinen schwerwiegenden Folgen nur teilweise Treibhausgas-Emissionen um 16 % reduzieren
abwenden. Für die Sicherheit und Nachhaltigkeit und seinen Anteil an erneuerbaren Energien auf
der Energieversorgung spielen neue Technologien 34 % steigern. Österreich zählt im Übrigen zu den
und Systemlösungen für den effizienten Energieein- wenigen Ländern in Europa, in denen prinzipiell
satz und die Nutzung erneuerbarer Energieträger eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien
eine entscheidende Rolle. Sie ermöglichen nicht mit vertretbarem volkswirtschaftlichem Aufwand
nur die Aufrechterhaltung unserer Lebensqualität, möglich ist.
sondern bieten auch maßgebliche Chancen für die
Wirtschaft. Im Jahr 2007 wurde der Klima- und Energiefonds
mit dem Ziel gegründet (Klima- und Energiefonds-
Die aktuellen energiepolitischen Ziele einer Gesetz vom 6. Juli 2007), einen Beitrag zur Ver-
Energieeinsparung und Minderung der CO2-Emis- wirklichung einer nachhaltigen Energieversorgung
sionen auf ein langfristig nachhaltiges Niveau sowie zur Reduktion der Treibhausgas-Emissionen
bei gleichzeitiger Steigerung des Anteils der er- und zur Unterstützung der Umsetzung der öster-
neuerbaren Energiequellen können nur erreicht reichischen Klimastrategie zu leisten. Das Gesetz
werden, wenn es gelingt, den fossilen Energieträ- nennt hierzu eine Reihe von quantitativen Zielen
gerverbrauch drastisch zu reduzieren und zugleich betreffend den Einsatz erneuerbarer Energieträger
die Energieeffizienz zu erhöhen. Die Effizienz des und die Verbesserung der Energieeffizienz, die in
gesamten Energiesystems muss also deutlich ver- der Ausrichtung des Programmes berücksichtigt
bessert werden (maximale Energiedienstleistung sind.
bei minimalem Ressourcenverbrauch).
Mit den Fördergeldern des Fonds sollen innovative
In den vergangenen Jahren ist der Energiever- Projekte unterstützt werden, die einen wesent-
brauch – und hier vor allem der elektrische Ener- lichen Beitrag für eine klima- und umweltfreund-
gieverbrauch – in Österreich trotz aller Anstren- lichere sowie energieschonende Zukunft bringen.
gungen weiterhin drastisch gestiegen. Der fossile
Primärenergieverbrauch, der für den Konsum der Der Klima- und Energiefonds versteht sich als ein
Energieressourcen und damit auch für die CO2- bedeutender Impulsgeber für die heimische
Neue Energien 2020Klimapolitik und die nachhaltige Restrukturierung Effizienter Energieeinsatz
des österreichischen Energiesystems. Er wirkt Die mit Hilfe bereits heute verfügbarer Technolo-
additiv, ist innovativ und impulsgebend. Seine Maß- gien und Komponenten theoretisch zu erreichenden
nahmen sollen systemverändernden Einfluss ha- Energieeinsparungspotenziale bei der Erbringung
ben. Maßnahmen werden primär in jenen Sektoren von Energiedienstleistungen betragen in einzelnen
gesetzt, die die größten Treibhausgas-Emittenten Bereichen bis zu 90 %.
sind: Mobilität, Gebäude, Produktion und Energie- Es gilt, Lösungen zu entwickeln, die es ermög-
bereitstellung. lichen, theoretische Potenziale auch praktisch
umzusetzen.
2.2 Ausrichtung des Programms Erneuerbare Energieträger
Erneuerbare Energieträger spielen in einem zu-
Da ein wichtiger Beitrag zur Lösung der Treibhaus- kunftsfähigen europäischen Energiesystem eine
problematik in einem veränderten Energiesystem wichtige Rolle, um die Abhängigkeit von fossilen
liegt, wurde das Forschungs- und Technologiepro- Energieträgern zu reduzieren, dem Druck zu nukle-
gramm Neue Energien 2020 des Klima- und Ener- aren Lösungen zu begegnen und gleichzeitig
giefonds initiiert. Es baut auf den Ergebnissen des die Treibhausgas-Emissionen des Energiesystems
Strategieprozesses e2050 und auf den Erfahrungen zu verringern. Es gilt daher, die Technologie erneu-
der Ausschreibung ENERGIE DER ZUKUNFT 2007 erbarer Energien weiter zu entwickeln und zu
sowie der 1. und 2. Ausschreibung NEUE optimieren.
ENERGIEN 2020 auf und berücksichtigt die beson-
deren Anliegen und Schwerpunktsetzungen des
Klima- und Energiefonds. Das Programm orien- 2.3 Programmstrategie
tiert sich an drei grundlegenden Ausrichtungen:
intelligenten Energiesystemen, effizientem Ener- Ambitionierte Ideen und Konzepte mit langfristiger
gieeinsatz und erneuerbaren Energieträgern. Von Perspektive sollen durch technologische
besonderem Interesse sind Fragestellungen, die zu Forschungs- und Entwicklungsarbeiten realisiert
mehr als einer dieser Ausrichtungen beitragen kön- und mit Hilfe von Pilot- und Demonstrations-
nen. Das Programm soll aber auch dazu beitragen, Anlagen in Richtung Marktnähe geführt wer-
Entscheidungsgrundlagen für die österreichische den. Dabei können regionale Modellsysteme als
Energie- und Klimapolitik zu erarbeiten. „Leuchttürme der Innovation und Umsetzung“
eine besondere Rolle spielen. Aber auch riskante
und heute noch nicht marktfähige Forschungs-
Strategische Entscheidungsgrundlagen und Technologieentwicklungen mit hohem Zu-
kunftspotenzial sollen unterstützt werden.
Energie- Effizienter Erneuerbare Neben diesen primär technologiebezogenen
systeme Energieeinsatz Energien Fragestellungen hat das Programm auch die
Aufgabe, auf gesellschaftliche Fragestellungen
einzugehen und Wissen für kurz-, mittel- und
Abb: 2.11. Ausrichtung des Programms
Abb. langfristige Planungsprozesse zu erarbeiten.
Um zum gesellschaftlichen Diskurs um eine
Intelligente Energiesysteme nachhaltige, klimaschonende Energiezukunft
Ziel muss die Optimierung des gesamten Energie- beitragen zu können, sind Themen wie die
systems sein, deshalb sind systemische Lösungs- Bewertung von langfristigen Energiestrategien,
ansätze und die Systemintegrierbarkeit von Nutzerverhalten und gesellschaftliche
Lösungen und Technologien von besonderer Veränderungsprozesse zu berücksichtigen.
Bedeutung. Die Betrachtung der integrierenden Insbesondere für Maßnahmen und Strategien,
Elemente von Energiesystemen, wie beispielsweise die erhebliche Investitionen der öffentlichen Hand
der Netze oder des baulichen und räumlichen erfordern, ist eine transparente Abschätzung der
Kontexts, hat zentralen Stellenwert. volkswirtschaftlichen Kosten eine wesentliche
Voraussetzung für Entscheidungen.
Neue Energien 2020 2.4 Programmziele
Zur Erreichung der übergeordneten Ziele des
Klima- und Energiefonds werden entsprechend
der Programmausrichtung mehrere Einzelziele
definiert.
Abb: 2.2
10 Neue Energien 202003. Themenfelder der
Ausschreibung
Durch klare Definition von Fragestellungen möchte Förderansuchen können zu folgenden Projektarten
der Klima- und Energiefonds gezielt Schwerpunkte eingereicht werden:
setzen. Es werden Projektvorschläge gesucht, die • Grundlagenforschung (GLF)
in den nachfolgend angeführten Themenfeldern zu • Technische Durchführbarkeitsstudien (TDF)
der für das Programm definierten Zielsetzung und • Industrielle Forschung (IF)
Ausrichtung beitragen können. • Experimentelle Entwicklung (EE)
• Demonstrations-Projekte (DEMO)
Das Energieforschungsprogramm „Neue Energien • Studien (STUD)
2020“ orientiert sich bei seiner Förderpolitik am • Stipendien (STIP)
Prinzip „Strategie ist die Ökonomie der Kräfte“. Das
bedeutet, dass es in dem Programm die erwähnten Zu jedem Themenpunkt sind die Projektarten ange-
ausgewählten Förderspezialthemen gibt, mit der führt, zu welchen sich der Klima- und Energiefonds
Perspektive die Mittel im Einzelfall neu zu kon- prioritär Einreichungen erwartet.
zentrieren, wenn sich an einer Stelle ein technolo-
gischer Durchbruch abzeichnet. Die Förderung im Der Schwerpunkt der Ausschreibung liegt auf
Bereich „themenoffene Fragestellungen“ ist mit angewandter Forschung. Projekte der Grund-
12 Mio. Euro begrenzt. lagenforschung sowie Studien werden nur in einge-
schränktem Ausmaß und für bestimmte Themen-
Insgesamt ist die 3. Ausschreibung mit 40 Mio. Euro stellungen gefördert.
dotiert.
Neue Energien 2020 113.1 Energiesysteme, Netze und Verbraucher
Intelligente Systemtechnologien als Schlüssel zu die Menschen in die Lage zu versetzen, mit dem
Effizienz und Nachhaltigkeit der Energieversorgung kostbaren Gut Energie sorgsam haushalten
Eine Kooperation von BMVIT und Klima- und und unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zur
Energiefonds effizienten Energienutzung im Gesamtsystem
beitragen zu können.
Die Einbindung aller relevanten – und damit zum
Teil auch neuer – Akteure bereits in der Entwick-
Die aktuellen energiepolitischen Ziele einer Steige- lung und Erforschung neuer Ansätze ist unabding-
rung des Anteils der erneuerbaren Energiequellen, bar, um die veränderten Rollen im neuen Energie-
der Effizienzsteigerung und einer Minderung der system zu berücksichtigen, den Übergangsprozess
CO2-Emissionen auf ein langfristig nachhaltiges zu gestalten und nachhaltige, umsetzbare Lö-
Niveau können nur erreicht werden, wenn es ge- sungen in diesem hoch komplexen Aufgabenfeld zu
lingt, die Effizienz des gesamten Energiesystems verwirklichen.
maßgeblich zu verbessern (maximale Energie-
dienstleistung bei minimalem Ressourcenver- Die zunehmende Durchdringung der Gesellschaft
brauch). Entscheidende Schlüssel zu dieser durch Informations- und Kommunikationstechno-
„Effizienzrevolution“ liegen in der optimalen In- logien (IKT) hat auch zu einer deutlichen Zunahme
tegration von erneuerbaren Energiequellen und des Energieverbrauchs in diesem Bereich geführt.
der Effizienzsteigerung mittels System-integralen Gleichzeitig sind die Einsparungsmöglichkeiten
Ansätzen bei der Energieverteilung und den End- durch eine gezielte Nutzung der IKT enorm, und
verbrauchern. in vielen Bereichen spielen sie eine zentrale Rolle
als Enabler. So wird beispielsweise das Verteilnetz
Um die Herausforderungen einer nachhaltigen En- durch eine IKT-Infrastruktur bis zu den Hausan-
ergieversorgung zu meistern, bedarf es dreierlei: schlüssen ergänzt (Smart Grid). Damit können Er-
• erstens der Erforschung der Möglichkeiten und zeugung und Verbrauch von Energie zeitlich besser
Entwicklung der Voraussetzungen für eine aufeinander abgestimmt und Energie zusätzlich
massiv dezentrale Erzeugung unter Nutzung durch Anbindung der Akkumulatoren von Elektro-
erneuerbarer Energiequellen und Einbindung Fahrzeugen (Vehicle-to-Grid) zwischengespeichert
von Energiespeichern, werden. Das Smart Grid verbindet also Erzeuger,
• zweitens der Entwicklung von effizienten Verbraucher und Speicher zu einem intelligenten
Technologien bei der Energieverteilung sowie Energieversorgungssystem (Smart System). Ein be-
der systemischen Integration der vorhandenen sonderer Schwerpunkt dieser Ausschreibung liegt
Energieinfrastruktur und der innovativen Be- daher auf dem Bereich Green ICT.
standteile in ein intelligentes Energiesystem,
• drittens der geeigneten Gestaltung von Schließlich sollen die erarbeiteten Konzepte,
Schnittstellen im sozio-technischen System, um Technologien und integralen Lösungsansätze in
12 Neue Energien 2020Modellregionen erprobt und demonstriert werden, IKT, welche eine nachhaltige, ressourcenschonende
damit einerseits Praxiserfahrungen in die weitere und effiziente Energieversorgung ermöglichen
Entwicklung einfließen können und andererseits (Green through ICT), z. B.:
anschauliche, erlebbare und multiplizierbare Best- • Informations- und Kommunikationsstrukturen
Practice-Beispiele geschaffen werden. für massiv verteilte Energiesysteme und deren
Optimierung
Im Zuge der vorliegenden Ausschreibung werden • Intelligente Managementkonzepte für Energie-
Projekteinreichungen zu folgenden Schwerpunkten systeme
und Themen innerhalb des Feldes „Energie- • Gewährleistung von Sicherheit, Zuverlässigkeit
systeme, Netze und Verbraucher“ erwartet: und Datenschutz
• Einsatzmöglichkeiten verteilter, dezentraler
3.1.1 Integration dezentraler Intelligenz (z. B. zur Minimierung der erforder-
Erzeugung lichen IT- Infrastruktur)*
Der erste Themenschwerpunkt umfasst die Er- Projektarten: GLF (nur für mit * gekennzeichnete Themen), TDF,
IF, EE, DEMO
forschung der Möglichkeiten und Entwicklung der
technologischen Voraussetzungen für eine massiv
dezentrale Erzeugung. Besonderes Augenmerk gilt Leistungselektronik zur Verbesserung der
dabei der Nutzung erneuerbarer Energiequellen Effizienz bei der Energieumwandlung, -versor-
und Einbindung von Energiespeichern (z. B. gung und -endnutzung (Schwerpunkt Green ICT)
Akkumulatoren von Elektrofahrzeugen, Nutzung z. B.:
von Gas- und Wärmespeichern etc.) sowie der Be- • Entwicklung von neuen Basistechnologien und
rücksichtigung von Potenzialen für Demand Komponenten für die verlustarme Umwand-
Response und Demand Management. lung, Speicherung, Verteilung und Regelung von
Energie
Schlüsseltechnologien für verteilte intelligente • Leistungselektronik an Systemgrenzen als
Energiesysteme Interface
Gesucht sind Technologien und Lösungen, die neue • Intelligente Wechselrichter zur Verbesserung
Freiheitsgrade und Möglichkeiten im Energie- der Netzqualität
Projektarten: IF, EE
system erschließen, z. B.
• Intelligente Netze für leitungsgebundene
Energieträger (regionale (Bio-)Gas-, Kälte- und Schnittstellen und Synergien bei der Integration
Wärmenetze und Energiespeicher) von dezentraler Erzeugung (Distributed
• Aktive, intelligente elektrische Verteilnetze Generation, DG)
(dezentrale Regelalgorithmen und aktives loka- z. B.:
les Lastmanagement) • Nutzung der möglichen Netzdienstleistungen
• Multifunktionale Energiezentralen im Hinblick von DG (Ancillary Services, z. B. Blindleistungs-
auf ihre Rolle in intelligenten Netzen (Kompo- einspeisung, Schieflastkorrektur, Filterung von
nentenentwicklung, Geschäftsmodelle) Harmonischen)
• Zusammenschaltung von kleinen, dezentralen • Netzanbindung unter verschärften zukünftigen
Kraftwerken zu einem Verbund (virtuelle Kraft- Anforderungen (Normen, Standards)
werke) • Vorbereitende Arbeiten für die Weiterent-
• Wissenstransfer zu und Praxiserprobung von wicklung von Normung und Standards
Energieversorgungssystemen mit stark dezent- • Kombination von DG mit anderen Systemkom-
raler Charakteristik* ponenten, insbesondere dezentralen Speichern,
Projektarten: GLF (nur für mit * gekennzeichnete Themen), TDF, Kühlsystemen und Wärmepumpen
IF, EE, DEMO • Erhöhung von Wirtschaftlichkeit, Effizienz und
Wirkungsgraden beim Einsatz von erneuer-
Informations- und Kommunikationstechnologien baren Energieträgern (z. B. direkte Nutzung von
(IKT) als Enabler für intelligente Energiesysteme Biogas oder Wärme)
(Schwerpunkt Green ICT) Projektarten: TDF, IF, EE, DEMO
Technologien und Konzepte aus dem Bereich der
Neue Energien 2020 13Sicherheit, Zuverlässigkeit, Effizienzverbes- strukturen (z. B. unter Ausnutzung von Nieder-
serung und Flexibilisierung durch dezentrale temperatur-Abwärmequellen, lokale Verwen-
Konzepte dung von Biogas in Mikronetzen zur Erhöhung
z. B.: von Wirtschaftlichkeit und Wirkungsgraden)
• Entwicklung von Technologien und System- • Multifunktionale Energiezentralen im Hinblick
ansätze zur Verbesserung von Versorgungs- auf ihre Rolle im Multi-Commodity-Umfeld
sicherheit und Effizienz durch dezentrale • Entwicklung und Forcierung kostengünstiger
Konzepte und innovative Lösungen für die lokaler Mikronetzkonzepte und deren tech-
Integration, Abstimmung und Steuerung in nische und wirtschaftliche Integration ins
Gesamtnetzen Gesamtsystem
• Blackstart-Konzepte für regionale Stromnetz- • Konzeption und Durchführung von Multi-
Inseln zur Wiederherstellung von stabilen Ver- Level-Governance-Mechanismen zur Koordina-
sorgungszuständen nach Störungen tion und Steuerung auf internationaler, natio-
Projektarten: TDF, IF, EE, DEMO naler und regionaler Ebene
Projektarten: TDF, IF, EE, DEMO
3.1.2 Gesamtintegration in ein intelligentes
Energiesystem Systemintegration zentraler und dezentraler
Die technologische Innovation verspricht dort den Energiesysteme
größten Effizienzgewinn, wo das Zusammenspiel Methoden und Instrumente zur ressourceneffi-
der komplexen Einzeltechniken und der vorhande- zienten Integration von Energiesystemen unter
nen Energieinfrastruktur verbessert werden kann. besonderer Berücksichtigung spezifisch österrei-
Es geht insbesondere darum, die Energienachfrage chischer Gegebenheiten, z. B.:
und das natürliche Dargebot der erneuerbaren • Einbindung von Großverbrauchern, -erzeugern
Energien aufeinander abzustimmen und Last- und –speichern in Smart Grids und Rückwir-
spitzen zu verringern. Ebenso wichtig ist der räum- kungen auf die Transportebene
liche Aspekt: Erneuerbare Energie ist im Gegensatz • Erweiterte Softwaretools für die Planung und
zu den herkömmlichen fossilen Energieträgern am den Betrieb von Smart Grids mit einem hohen
besten dort zu produzieren, wo sie benötigt wird, da Anteil dezentraler erneuerbarer Energieerzeu-
die geringe Energiedichte einen weiten Transport- gung
weg unwirtschaftlich und unökologisch macht. Der • Vorhersagetools (Dargebot, Verbrauch….)
Trend zu mehr dezentraler Erzeugung macht aus • Praxistests mit Netzbetreibern und lokalen
bisherigen Verbrauchern nun auch Produzenten Produktionsstrukturen
und erfordert vom Netz sehr viel mehr Intelligenz Projektarten: TDF, IF, EE, DEMO
im Hinblick auf Optimierung, Logistik und Steue-
rung. In diesem Themenschwerpunkt sollen Metho- Entwicklung von Technologien und Innovationen
den und Instrumente entwickelt werden, mit denen an den Schnittstellen der Energiesysteme
die Komponenten des Energiesystems, von der Entwicklung neuer Basistechnologien und Kompo-
Ressource bis zur Energiedienstleistung inklusive nenten, die zur Steigerung der Energie- und Res-
der Speichermöglichkeiten und ihrer vielfältigen sourceneffizienz vor allem an den Schnittstellen
Wechselwirkungen, zu einem effizienten Gesamt- zwischen Energiesystemen führen. Der Schwer-
system integriert werden. Projekte zu diesem The- punkt liegt auf Technologien und Komponenten, die
menkreis sollen die jeweils relevanten Akteure aus wirtschaftlich in Österreich verwertet werden, z. B.:
den unterschiedlichen Bereichen einbinden. • Gestaltung der Schnittstellen zwischen
Endverbrauchern und Netz durch verbesserte
Zusammenspiel unterschiedlicher Kontrolle und Steuerung (Demand Response, ...)
Versorgungsnetze • „Intelligent Metering“ – Gestaltung von
Systemansätze, Komponenten und Strukturen zur geeigneten Schnittstellen, welche die Ein-
flexiblen, optimalen Integration vorhandener Res- bindung von Konsumentenentscheidungen
sourcen, z. B.: ermöglichen und zu einer Flexibilisierung der
• Optimierung des Ressourceneinsatzes im Nachfrage sowie zur Einsparung von Energie
Multi-Commodity-Umfeld motivieren.
• Entwicklung hocheffizienter, leitungsge-
bundener dezentraler Energieversorgungs-
14 Neue Energien 2020• Technologieentwicklung zur „Emanzipation eine Entkoppelung des Energieverbrauchs vom er-
der Betroffenen“ – diese werden als Player bzw. zielten Energienutzen und Komfortgewinn soll eine
Akteure benötigt faktorielle Effizienzsteigerung erzielt werden.
• Optimierte Beleuchtungssysteme, System-
lösungen für Beleuchtung Effizienzsteigerung beim Einsatz von Geräten und
• Beiträge zur Standardisierung und Systemen unter Berücksichtigung von Energie-
Harmonisierung von Schnittstellen und Treibhausgasbilanzen
Projektarten: TDF, IF, EE, DEMO Produktentwicklungen und Systemverbesserungen
zur Erzielung deutlicher Effizienzsteigerungen bei
Netzmanagement in Zusammenhang mit Endverbrauchsgeräten und deren Anwendung (En-
Elektromobilität ergie- und Rohstoffeffizienz), z. B.:
Technologien und Konzepte für die Netzanbindung • Energieeinsparung durch Einsatz innovativer
von Elektrofahrzeugen (Grid-to-Vehicle und Vehicle- LED-Technologie für Beleuchtung, Anzeigen
to-Grid), z. B.: und Bildschirme in sämtlichen Anwendungs-
• Laderegelstrategien bereichen (private Endverbraucher, Gewerbe,
• Ladekonzepte für eine Optimierung der Industrie, öffentlicher Raum,…)
Netzauslastung bzw. optimierte Anpassung an • Stromsparende Antriebe (inkl. Drehmoment-
Erzeugungsspitzen, vorrangig generiert durch und Drehzahlregelung) für Industrie, Gewerbe,
erneuerbare Einspeisung Gebäudetechnik und Haushalt
• Konzepte für die Netzrückspeisung • Halbleitertechnologien für reduzierten Energie-
• Standards für Speichermanagement und verbrauch, insbesondere für Spannungswand-
Netzmanagement (Kommunikationsprotokolle lung, Regelung (z. B. Klimaanlagen, Beleuch-
und Schnittstellen der Software und Hardware, tung) und Vermeidung von Stand-by-Verlusten
inkl. Netzstecker) (z. B. TV-Geräte, Set-Top-Boxen)
Projektarten: TDF, IF, EE, DEMO • Neue Funktionsprinzipien, Geräte und System-
lösungen, die Energiedienstleistungen auf neu-
3.1.3 Effiziente Energienutzung unter artige Weise bereitstellen und dafür alternative
wirtschaftlichen Gesichtspunkten Energieformen nutzen (z. B. thermisch statt
Dieser Themenschwerpunkt umfasst die Ent- elektrisch)
wicklung effizienter Technologien und Lösungen • Maßnahmen zur Verbesserung der Marktdurch-
bei den Endverbrauchern sowie von Methoden zur dringung mit hocheffizienten Geräten und
Entscheidungsfindung sowohl auf der Seite der zum Nachrüsten bestehender Systeme (z. B.
Endverbraucher als auch beim Aus- und Umbau, Aufzüge) mit spezieller Berücksichtigung von
der Vernetzung und dem Betrieb der hochkomple- Lebenszyklenanalysen hinsichtlich Energie-
xen Energiesysteme. Das kognitive Vermögen des und Treibhausgasen sowie anderer Ressourcen
Menschen reicht nicht mehr aus, die Systemzu- (Wasser, seltene Metalle, …)
sammenhänge zu erfassen, etwa wenn langfris- Projektarten: TDF, GLF, IF, EE, DEMO
tige Investitionsentscheidungen getroffen werden
sollen. Die gravierenden Umstrukturierungen Ressourcenschonende Nutzung der Informations-
auf der technologischen Seite – wie auch auf der und Kommunikationstechnologien (Schwerpunkt
Nachfrageseite – sind zu untersuchen. Es sind Green ICT)
Entscheidungsmodelle und -hilfen auf allen Ebenen Die voranschreitende Durchdringung aller Lebens-
gefragt, von der lokalen bis zur globalen, von der bereiche mit Informations- und Kommunikations-
Analyse der betriebswirtschaftlichen Investitions- technologien ist mit einem beträchtlichen Zuwachs
entscheidung bis zur Abschätzung der volkswirt- an Energiebedarf verbunden und verlangt nach
schaftlichen Effekte, von der Entscheidungsfindung Konzepten und Technologien zur Verbesserung der
eines Haushaltsvorstandes oder einer Gemeinde Energieeffizienz von IKT-Geräten, -Diensten und
bis zur Interessensvertretung einer internationalen -Infrastruktur (Green ICT), z. B:
Interessensgruppe. Projektvorschläge sollen zur • Neue Hardware- und Software-Architekturen
Mobilisierung des enormen Einsparungspotenzials für die effiziente und bedarfsgerechte Strom-
bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung des Lebens- versorgung von IKT-Systemen und deren Kom-
standards beitragen. Mit anderen Worten: Durch ponenten
Neue Energien 2020 15• Intelligente Energiemanagementkonzepte und Steigerung der Angebotsqualität und verbes-
ganzheitliche Optimierung der Versorgung und serter Nachhaltigkeit
Kühlung von IKT-Systemen, einschließlich Ser- • Innovative Leasing- und Contracting-Modelle
ver-Räumen und Rechenzentren (z. B. öffentliche Beleuchtung als Dienst-
• Energieeffizienz in der Kommunikations- leistung)
infrastruktur (Netze, Vermittlungseinrich- Projektarten: TDF, IF, EE, DEMO
tungen, Basisstationen, Modems, Switches,
Router etc.) Effizienter Endverbrauch in Privathaushalten
• Optimierte Kapazitätsauslastung durch Bewusstseinsbildende Maßnahmen, Anreizmecha-
Konsolidierung und Virtualisierung von Servern nismen und intelligente Lösungen auf Verbraucher-
• Ressourcenschonende Betrachtung über den seite (Smart Metering, Demand Side Management
gesamten Lebenszyklus hinweg etc.), welche Energieeinsparungen ohne wahrge-
Projektarten: TDF, GLF, IF, EE, DEMO nommenen Komfortverlust ermöglichen, z. B.:
• Innovative Ansätze zur Ermöglichung der
Verlagerung von Produkten zu Diensten persönlichen Wahrnehmung des privaten End-
(Schwerpunkt Green ICT) verbrauchs durch den/die Konsumenten
Innovative Informations- und Kommunikations- • Anreizorientierte oder automatisierte Reduktion
technologien erlauben immer öfter den Ersatz von Lastspitzen bzw. unnötigem Stromver-
physischer Produkte oder physischen Transports brauch
durch elektronische Dienste und fördern den • Innovative Konzepte für die energieeffiziente
Übergang von der Produkt- hin zur Dienstleistungs- Hausinstallation
gesellschaft (Product-to-Service-Shift). Dies stellt • Umgang des Endverbrauchers in mit den
eines der größten Potenziale für Energieeinspa- technischen Systemen (Bedürfnisse,
rung durch IKT dar. Gesucht sind neue Konzepte, Funktionen etc.)
Forschungs- und Demonstrations-Projekte sowie • Geändertes Nutzerverhalten als Einflussfaktor
volkswirtschaftliche Analysen betreffend die Ener- in Energiesystemen, Energiebedarf und
gie- und Ressourceneffizienz (inkl. Wasser, seltene Lebensstile, Rebound-Effekte etc.
Metalle etc.) derartiger Entwicklungen. Projektarten: TDF, GLF, IF, EE, DEMO
Projektarten: TDF, GLF, IF, EE, DEMO
Aktive Teilnahme von Endverbrauchern
An der Energiedienstleistung orientierte an der regionalen Energieversorgung,
Angebote Plushäuser im Smart Grid
Die Anbindung großer Energieverbraucher (z. B. Die Zunahme an Energie produzierenden Gebäuden
Produktionsanlagen, Kühllasten, Beleuchtung) an in Österreich wirft die Frage nach ihrer Einbindung
intelligente Netze ermöglicht ressourceneffiziente in intelligente Netze auf. Gefragt sind innovative
Konzepte durch die Einbindung und gegebenenfalls Projekte, die zur optimalen Einbindung von Energie-
Koordination bzw. Steuerung der Lastseite. Ge- verbrauchern und -Erzeugern (im kleinen Leis-
fragt ist die systematische Entwicklung konkreter tungsbereich) – „Prosumer“ beitragen z. B.:
Lösungen und Angebote, insbesondere die Entwick- • Sinnvolle Integration erneuerbarer Energie-
lung neuer Produkt-Service-Systeme unter Einsatz träger unter Berücksichtigung von Wirtschaft-
zentraler und/oder dezentraler Technologien sowie lichkeit und Anforderungen der Nutzer
der Einbeziehung der Nutzer und anderer wesent- • Heizung, Klimatisierung und Raumlüftung unter
licher Stakeholder in den Entwicklungsprozess, Berücksichtigung von Gesamtsystemaspekten
z. B.: und regional spezifischen Gegebenheiten
• Technologieentwicklung, methodische • Erhöhung des Eigennutzungsgrades erneuer-
Hilfsmittel und Tools für die ressourceneffizi- barer Energieträger im Gebäude (z. B. mittels
ente Steuerung, Koordination und Kontrolle der thermischer Speicherung oder Lastverschie-
Anbindung von Anlagen an intelligente Netze, bungen, optimaler Energie- und Technologie-
z. B. Smart Grids mix)
• Neue Modelle, die die nachgefragten Energie- • Geschäfts- und Marktmodelle für „Prosumer“
dienstleistungen (z. B. Licht, Kühlung) direkt • Auswirkungen und Möglichkeiten im
bereitstellen, ohne Komfortverlust bzw. mit Zusammenhang mit Smart Grids
Projektarten: TDF, IF, EE, DEMO
16 Neue Energien 20203.1.4 Beiträge zur Realisierung von Marktchancen, Handlungsrahmen und Geschäfts-
Smart-Grid-Modellregionen modelle für innovative Technologien
Innovative, klimafreundliche und ressourcen- Durch die Veränderung der Systemgrenzen und
schonende Strategien der regionalen Entwicklung eine steigende Anzahl von Schnittstellen zwischen
erfordern neue Partnerschaften, Geschäftsmodelle regionalen und zentralen Energieversorgern, Net-
und Kunden-/Lieferanten-Beziehungen. Die Bil- zen und Endverbrauchern ergeben sich neue Her-
dung neuer, kleinräumig angepasster Strukturen ausforderungen für die Entwicklung marktfähiger
bedingt ein gesteuertes Zusammenwirken von Geschäftsmodelle. Gefragt sind Untersuchungen
Erzeugern, Verbrauchern und Netzbetreibern, das von öffentlichem Interesse mit einem breiten An-
über die herkömmlichen Steuerungsmechanismen wendungsbereich (d. h. nicht nur für einzelne
der Energiemärkte und regulatorischen Rahmen- Unternehmen oder Branchen), z. B.:
bedingungen hinausgeht und diese um innovative • Studien und Pilotprojekte, in denen
Elemente erweitert. Gesucht sind umfassende Pro- systematisch Szenarien für verschiedene An-
jektvorschläge, welche auf regionaler Ebene alle sätze zur Integration dezentraler oder regio-
relevanten Akteure einbeziehen. Dabei ist zwar von naler Energieversorger analysiert werden
den konkreten regionalen Gegebenheiten und spe- • Erarbeitung von Grundlagen und Beiträgen für
zifischen Erzeugungs- und Verbraucherstrukturen legislative und regulatorische Rahmenbedin-
auszugehen; dennoch sollen die Vorhaben Modell- gungen für verschiedene Lösungsoptionen
charakter, ein hohes Maß an Übertragbarkeit und • Grundlagen und Beiträge zur Entwicklung von
Beispielwirkung für andere Regionen aufweisen. Geschäftsmodellen, die der öffentlichen Diskus-
sion aller Akteure dienen und Chancen sowie
Demonstration und Praxistests für Smart Grids Risiken aufzeigen
Die konkrete Umsetzung innovativer Technologien • Adäquate Wirtschaftlichkeitsbetrachtung über
und integraler Ansätze aus dem gesamten The- den gesamten Lebenszyklus
menfeld „Energiesysteme, Netze und Verbraucher“ • Analysen und Strategien für die Gestaltung
soll deren Praxistauglichkeit demonstrieren und von Standards und Normen an den Schnittstel-
handfeste Messdaten zu lokalen Produktionskapa- len dezentraler Energiesysteme
zitäten, Netzanbindungserfordernissen und wirt- • Simulation, Modellrechnung und Markt-
schaftlicher Machbarkeit liefern, z. B.: regulation für Smart Grids, Relevanz in Öster-
• Mustersiedlungen oder Pilotprojekte mit reich und seinen Regionen
möglichst dichter Nutzung solarer und/oder • Aspekte der Exportfähigkeit von Technologien
biogener Primärenergieträger und optimierter und Systemen (z. B. schlüsselfertige Lösungen
Infrastruktur zur Strom-, Wärme- und Kälteer- für Smart Grids und Micro Grids)
zeugung Projektarten: TDF, GLF, IF, DEMO, STUD
• Pilotprojekte im Rahmen der bestehenden
Bemerkung: Studien zu diesem Themenkreis können unter-
Siedlungs- und Netzinfrastruktur (z. B. hohe
schiedliche Adressaten im Bereich der wirtschaftlichen Umset-
Dichte an PV-Dach- und Fassadenanlagen und
zung haben und sind grundsätzlich bis zu 100 % förderbar. Es
Adaptierung der bestehenden Stromnetze) ist jedoch eine der Interessenlage entsprechende Einbindung
• Pilotprojekte für die bidirektionale Netz- und ggf. auch finanzielle Beteiligung der Adressaten bzw. Auf-
anbindung von Elektrofahrzeugen traggeber vorzusehen und zu argumentieren.
• Nutzerverhalten als Einflussfaktor in Energie-
systemen (Smart Metering, Demand Side Ma- Sozioökonomische Aspekte und Strategie-
nagement etc.) entwicklung
Projektarten: TDF, DEMO Forschungsarbeiten, die Schnittstellenaspekte
zwischen Energiesystem, Netz und Verbraucher
Demonstrationen und Praxistests für die bidirektionale Netz- beleuchten und helfen, geeignete Strategien und
anbindung von Elektrofahrzeugen resp. ähnlicher Themenstel- Entscheidungsgrundlagen für Österreich und Ös-
lungen sind mit der Klima- und Energiefonds-Ausschreibung
terreichs Regionen zu entwickeln, z. B.:
Technologische Leuchttürme der Elektromobilität in/aus
Österreich abzustimmen. • Gesellschaftliche Integration dezentraler
Energiewirtschaftssysteme und Wechselwir-
kungen mit den Bereichen Raumplanung und
Siedlungswesen
Neue Energien 2020 17• Nutzung von Verbrauchsdaten durch Netz-
betreiber unter Berücksichtigung von gesamt-
wirtschaftlichen und individuellen Interessen
(z. B. Datenschutz)
• Entwicklungsszenarien der unterschiedlichen
Netzebenen in der österreichischen Energie-
wirtschaft
• Entwicklung von Technologie-Roadmaps für
verbesserte Schnittstellen in intelligenten
Netzen
• Unterstützungsaktionen: Aufbau von Zentren,
Netzwerken und Technologieplattformen
• Entwicklung und Evaluierung von möglichen
Varianten für zukünftige Wohn- und Arbeits-
formen und Lebensstile
• Demografische Entwicklungen und Zusammen-
hänge zwischen Lebensstandard und Energie-
verbrauch; Soziale und ökologische Perspekti-
ven
• Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen und
Bewertungsmodelle dezentraler Energienetze
• Dissemination und Know-how-Transfer in
Richtung EVU, lokaler Akteure und Produzenten
von erneuerbaren Energieträgern; Dialog-
kommunikation und Entwicklung realistischer
Praxisszenarien
Projektarten: TDF, GLF, STUD
Bemerkung: Studien zu diesem Themenkreis können unter-
schiedliche Adressaten im Bereich der wirtschaftlichen Umset-
zung haben und sind grundsätzlich bis zu 100 % förderbar. Es
ist jedoch eine der Interessenlage entsprechende Einbindung
und ggf. auch finanzielle Beteiligung der Adressaten bzw. Auf-
traggeber vorzusehen und zu argumentieren.
18 Neue Energien 20203.2 Fortgeschrittene Speichertechnologien
Die Speicherung von Wärme und Kälte als auch Belade- und Endladeleistung, das vom Wärme-
elektrischer Energie sind eine der wesentlichsten speicher eingenommene Volumen, Zeit zwischen
Fragestellungen für zukünftige Energiesysteme. Be- und Entladung, Transportierbarkeit, Sicherheit
Zukünftige Energiesysteme bedürfen neuer inno- und die Integrierbarkeit in Gebäudesysteme.
vativer Speichertechnologien, die den Schlüssel
für ein nachhaltiges Energiesystem darstellen. Zur Die aktuelle Ausschreibung widmet sich nun den
Entwicklung neuer Speicherkonzepte stellen sich vordergründigsten Forschungsfragen im Bereich
Herausforderungen in chemischen und material- der Speichertechnologien, um die aktuell notwen-
technischen Bereichen, die durch verstärkte Grund- digen Lösungen entwickeln zu können. Für die
lagenforschung behandelt und dann in angewandte Erzielung deutlicher Wirkungen im Sinne der Ziele
Entwicklung übergeführt werden sollen. sind umfassende Aktivitäten auf unterschiedlichen
Ebenen zu starten.
3.2.1 Elektrische Speicher
Zentrale und dezentrale Stromspeicher stellen Kurzfristig gilt es, bestehende Speichersysteme
ein entscheidendes Element eines zukünftigen durch die neuen Konzepte und Möglichkeiten zur
Stromversorgungssystems mit einem hohen An- Systemintegration zu optimieren. Mittelfristig ist
teil erneuerbarer Energieträger dar und sind die eine neue Generation von Speichern (s. g. Faktor 8
Voraussetzung, um stark fluktuierende Energien Speicher) zu entwickeln, wozu grundlegende Frage-
wie Sonnen- und Windenergie zu integrieren. Der stellungen zu bearbeiten sind. Um langfristig einen
verstärkte Einsatz mobiler Anwendungen (Laptop möglichst hohen Wärmebereitstellungsgrad durch
etc.) ist wesentlich von der Entwicklung der hoch- solarthermische Systeme zu erreichen, ist die
effizienten Speicher abhängig. Entwicklung von sorptiven und thermochemischen
Beispiele: Speichern unerlässlich.
• Entwicklung mobiler Stromspeicher
• Entwicklung von alternativen dezentralen Die wesentlichen Entwicklungsziele sind:
Energiespeichern zur Speicherung von elek- • Ausschöpfen des Optimierungspotenzials bei
trischer Energie (Druckluftspeicher, Schwung- Wasserspeichern (Wärme und Kälte)
radspeicher,…) (Temperaturschichtung, Schwerkraftzirkulati-
Projektarten: TDF, GLF, IF, EE, DEMO onen, Wärmetauscher, Wärmeleitung im Was-
ser, Optimierung von Auslegung und Normen,
3.2.2 Thermische Speicher Definition von Standards etc.)
Im Bereich der thermischen Speicher ist die Ent- Projektarten: IF, EE, DEMO
wicklung neuer kompakter, wirkungsvoller sowie • Weiterentwicklung der Wärmedämmung von
preiswerter Langzeitwärmespeicher entscheidend Speichern durch den Einsatz neuer Dämmma-
für die weitere Entwicklung in Richtung vollsolare terialien (Vakuumisolation, Superisolation, Ein-
Wärmebereitstellung. Einige der Schlüsselfaktoren, satz nachwachsender Rohstoffe, Entwicklung
die für Wärmespeicherungssysteme berücksichtigt von integrierten Speicher-Gesamtkonzepten).
werden müssen, sind folgende: Kosten, Kapazität, Projektarten: IF, EE, DEMO
Neue Energien 2020 19• Weiterentwicklung von gebäudeintegrierten
Konzepten (Integration der Wärmespeicher-
funktion in traditionelle Bauteile des Gebäudes,
Erhöhung der Speichermassen durch Beimi-
schung von Phasenwechselmaterialien).
Demonstrationen und Praxistests für die
bidirektionale Netzanbindung von Elektrofahr-
zeugen resp. ähnlicher Themenstellungen sind
mit der Klima- und Energiefonds-Ausschrei-
bung Technologische Leuchttürme der Elektro-
mobilität in/aus Österreich abzustimmen.
Projektarten: IF, EE, DEMO
• Entwicklung von Speicherkonzepten für unter-
schiedliche Anwendungsbereiche (Entwicklung
von Konzepten zur Erhöhung der Speicherdauer
sowie Speichereffizienz für unterschiedliche
Anwendungsbereiche (z. B. für Batch-Prozesse
in Industriellen Anwendungen).
Projektarten: TDF, IF, EE, DEMO
• Verstärkte Materialforschung im Bereich
Phasenwechselmaterialien (z. B. Paraffine),
sorptiver sowie thermochemischer Materialien
(Silicagele, Zeolithe, u. a.).
Projektarten: GLF, TDF, IF
• Verstärkte Forschungsarbeiten im Bereich
sorptiver und thermochemischer Verfahren und
Technologien als Kurzzeit- und Langzeitspei-
cher inkl. Optimierung der Be- und Entlade-
technik.
Projektarten: GLF, TDF, IF
• Entwicklung von Simulationstools zur
Generierung von neuen Verfahren sowie An-
wendungsdesigns
Projektarten: TDF, IF, EE
• Faktor 8 Forschung (Reduktion der spezifische
Speichervolumen von heute 17 m³/MWh um den
Faktor 8 auf 2 m³/MWh durch den Einsatz von
neuen Speichermaterialien, Reduktion des für
den Speicher erforderlichen umbauten Raums).
Projektarten: GLF, TDF, IF
20 Neue Energien 20203.3 Energieeffizienz in Industrie und Gewerbe
In Industrie und Gewerbe wird derzeit in Österreich erfolgreiche Umsetzung in einem Pilotbetrieb
ca. ein Drittel der Primärenergie eingesetzt hilfreich. Daher werden für unterschiedliche Indus-
und damit ca. ein Drittel der CO2-Emissionen ver- triebranchen und Gewerbesektoren Konzepte
ursacht. Eine Vision für den Industrie- und und Lösungen für erneuerbare Energie in Produk-
Gewerbebereich ist, bis 2050 die klassischen tionsprozessen auf verschiedenen Temperaturni-
Energietechnologien im Niedertemperaturbereich veaus sowie ganzheitliche Konzepte mit
zu ersetzen. Lastmanagement und Energiespeicherung gesucht,
die eine hohe Vorbildwirkung innerhalb und außer-
3.3.1 Neue Produktionsverfahren und halb der Branche aufweisen.
Technologien • Integration erneuerbarer Energien in
Eine der Vorbedingungen zur Erhaltung und zum Produktionsprozesse (Solarthermie, Biomasse),
Ausbau Österreichs als erfolgreicher Industrie- • Anpassung der Prozessparameter an die
standort ist die Entwicklung neuer innovativer Eigenschaften der erneuerbaren Energieträger,
Produktionsverfahren mit faktoriell geringerem • Speichertechnologien zur Erhöhung von
Energieverbrauch (z. B. auf Basis anderer Grund- Deckungsgrad und Wirtschaftlichkeit der
operationen, durch neue Trennverfahren, CO2-freien Lösungen.
Lösungsmittel, geänderte Reaktionsbedingungen, Projektarten: TDF, IF, EE, DEMO
biotechnologische Verfahren) und erhöhter Nach-
haltigkeit. Dies erfordert sowohl grundlegende 3.3.3 Wärmeintegration und Einsatz
Forschungsarbeiten als auch angewandte erneuerbarer Energieträger
Forschung und Technologieentwicklungen. Die Mehrzahl der Produktionsprozesse läuft zumin-
• Innovative Verfahren mit möglichst breiten und dest in kleineren Betrieben im Chargenbetrieb
branchenunabhängigen Einsatzpotenzialen, und nur in wenigen Schichten. Die Systemoptimie-
• branchenspezifische Lösungen für innovative rung zur Integration unregelmäßig anfallender
Technologien bzw. integrierte Lösungen in erneuerbarer Energieträger wie Solarenergie in
Prozessen, diskontinuierlich arbeitende Produktionsprozesse
• Technologien und Verfahren, bei denen die bedarf daher guter Konzepte. Die Integration von
Erhöhung der Energieeffizienz mit einer Solarenergie, Biomasse und Wind in Produkti-
rationelleren Nutzung anderer Roh- und onsprozesse erfordert auch eine Entwicklung
Hilfsstoffe verbunden ist, geeigneter Kollektoren und Speichertechnologien.
• Einsatz intelligenter IKT-Lösungen zur Fragen der Finanzierung und Bereitstellungsflexi-
Steigerung der Energieeffizienz in blität sind zu integrieren.
Produktionsprozessen, z. B. bei der Motoren- • Analyse der praktischen Probleme (Wärme-
steuerung. tauscherflächen, schnelle Wärmeübertragung
Projektarten: TDF, IF, EE, DEMO etc.) und Entwicklung von wirtschaftlichen
Lösungen,
3.3.2 Low CO2-Branchenlösungen • exergetische Analyse der Prozesse,
Für eine rasche Verbreitung energieeffizienter, • Entwicklung von Mess- und Regeltechniken
nachhaltiger und CO2-neutraler Lösungen ist eine von Komponenten und Systemen (Green ICT),
Neue Energien 2020 21Sie können auch lesen