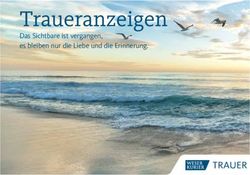Pharmazeutische Industrie und "Neue Deutsche Heilkunde"
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Pharmazeutische Industrie und »Neue Deutsche Heilkunde«
Ulrich Meyer
Summary
Pharmaceutical Industry and “New German Medicine” (“Neue Deutsche Heilkunde”)
The so-called “New German Medicine”, initially propagated in the health policy of the
National Socialist Party, promoted greater use of phytotherapeutic and homeopathic drugs
by the medical community. In response, the “Reichsfachschaft der pharmazeutischen In-
dustrie e. V.” (“Association of Pharmaceutical Industry of the Reich”) was obliged to
pursue a carefully chosen double strategy, given that the members of the Association were
Open Access Download von der Verlag Österreich eLibrary am 20.06.2022 um 16:03 Uhr
both manufacturers of natural remedies and manufacturers of allopathic drugs.
However, the fact that I.G. Farben completely ignored the “New German Medicine” sug-
gests that the large chemical-pharmaceutical manufacturers did not take this policy very
seriously. The only documents pertaining to increased research in the area of natural reme-
dies stem from the medium-sized manufacturers Knoll and Schering. In the case of both
companies it is noteworthy that they worked towards obtaining a scientific foundation for
the developed preparates, and that they employed conventional methods of chemical
analysis and proof of activity.
The growth of the classical manufacturers of natural remedies, such as the company Will-
mar Schwabe was, as far as any growth at all could be observed, significantly smaller than
had been theoretically postulated. There is no causal relationship between any commercial
success during the period in which the Nazis were in power and today’s commercial pros-
perity.
Moreover, from the viewpoint of the pharmaceutical industry, the “New German Medi-
cine” seems to have passed its zenith before 1936, when the 4-year plan for war
preparation entered into force.
Einleitung
Die von der NS-Gesundheitspolitik forcierte »Neue Deutsche Heilkunde«
propagierte den verstärkten Einsatz phytotherapeutischer oder auch ho-
möopathischer Arzneimittel in der ärztlichen Praxis. Trotz einiger medizin-
historischer Untersuchungen1 ist bislang wenig darüber bekannt, ob und
inwieweit die deutsche (chemisch-)pharmazeutische Industrie auf diese ge-
sundheitspolitische Vorgabe reagierte. Die grundlegenden Arbeiten von
Gerald Schröder2 zur NS-Pharmazie fokussieren auf die Vorkriegsjahre und
schildern die Problematik primär aus der Sicht der in der öffentlichen Apo-
theke tätigen Offizin-Apotheker3.
1 Vgl. Haug (1985); Bothe (1991); Karrasch (1998).
2 Vgl. Schröder: NS-Pharmazie (1988); Schröder: Wiedergeburt (1980); Schröder:
Wiederbelebung (1982). Auch Siebert (1992) nimmt die Perspektive des Offizin-
Apothekers ein.
3 Offizin=Raum der Apotheke, der der Abgabe von Arzneimitteln dient.
MedGG 23 2004, S. 165-182
Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart
Franz Steiner Verlag166 Ulrich Meyer
Im folgenden soll dargestellt werden, wie sich die deutsche pharmazeutische
Industrie in der Auseinandersetzung um die »Neue Deutsche Heilkunde«
positionierte.
Die Position der Reipha im Spiegel der »Pharmazeutischen
Industrie«
Als Sprachrohr der 1933 aus Vorläuferverbänden4 gegründeten
»Reichsfachschaft der pharmazeutischen Industrie e.V.«5 (Reipha) diente
die Hauszeitschrift Die Pharmazeutische Industrie, die eine Rekonstruktion
zumindest der offiziell vertretenen Positionen erlaubt.
Open Access Download von der Verlag Österreich eLibrary am 20.06.2022 um 16:03 Uhr
Im Hinblick auf die »Neue Deutsche Heilkunde« war die Reipha um eine
reibungslose Integration der »biologischen Heil- und Nährmittelindustrie«
bemüht6 und bezog 1934 deutlich Stellung. »Weder die Allopathie, noch
die Homöopathie und auch nicht die Naturheilkunde« könne »für sich in
Anspruch nehmen, die allein seligmachende Lehre zu sein.« »Die Therapie«
sei »kein ›heiliger Krieg‹«.7 Entsprechend fiel auch die Gestaltung des
Messestandes auf der Ausstellung »Deutsches Volk – Deutsche Arbeit« aus,
die vom 21. April bis 3. Juni 1934 in Berlin stattfand. Hier wurde unter der
Überschrift »Die pharmazeutische Industrie schafft die für Deutschland und
für einen großen Teil der Welt notwendigen Heilmittel aus Stoffen der Na-
tur« eine Neudefinition des Naturheilmittels versucht. Sera, Impfstoffe,
Hormone, Vitamine und Alkaloide standen nun als vermeintliche Natur-
heilmittel im Vordergrund der Präsentation, die synthetischen Arzneimittel
hingegen traten – scheinbar – zurück.8 (Abb. 1) Insbesondere der Verweis
auf Sera und Impfstoffe erscheint ›pikant‹, denn gerade diesen Präparaten
begegneten Anhänger der Naturheilkunde traditionell mit größter Zurück-
4 Dabei handelte es sich um den Verband der pharmazeutischen Großindustrie, den
Verband Pharmazeutischer Fabriken Deutschlands und den Zentralverband der
chemischen-technischen Industrie. Am 1. März 1935 ging die Reipha in der
Fachgruppe »Pharmazeutische Erzeugnisse« der Wirtschaftsgruppe »Chemische
Industrie« der Hauptgruppe V der deutschen Wirtschaft innerhalb der Reichsgruppe
Industrie auf. Vgl. Heyl: Sinn (1935). Da das erste Heft der neugegründeten Zeitschrift
erst am 5. Dezember 1933 erschien, wird der Jahrgang 1934 heute als Band 1 gezählt.
5 N. N.: Einführung (1933), S. 1f.
6 Vgl. Kunze: Bedeutung (1934), S. 633 f. Die 1935 in Nachfolge der Reipha gegründete
Fachgruppe Pharmazeutische Erzeugnisse hatte fünf naturheilkundlich orientierte
Fachabteilungen: I. Hersteller von Arzneimitteln der Naturheilkunde und der
Homöopathie, IV. Hersteller von Reformhaus-Waren, V. Hersteller von
Badezusätzen, VI. Hersteller von Heilwässern und Quellenprodukten, VII. Hersteller
von Thüringer Hausmitteln. Die frühere »Reichsfachschaft der biologischen Heil- und
Nährmittelindustrie« ging 1935 in der Fachabteilung IV auf. Vgl. N. N.:
Mitgliederversammlung (1935), S. 500, und Kunze: Jahreswechsel (1936), S. 3f.
7 Heyl: Bedeutung (1934), S. 213-219.
8 N. N.: Ausstellung (1934), S. 299f.
Franz Steiner VerlagPharmazeutische Industrie und »Neue Deutsche Heilkunde« 167
haltung bis strikter Ablehnung.9 1935 sollte mit dem Beitrag »Der Weg zum
›biologischen‹ Heilmittel« eine »Reihe von Veröffentlichungen« zur Natur-
heilkunde eröffnet werden, die indes nie in der Pharmazeutischen Industrie
erschien. Im Vorspann wurde »wie [...] schon bei früheren Gelegenheiten
betont«, es sei unrichtig, »wenn irgendeine ›Richtung‹ sich als die allein zu-
treffende« bezeichne.10 Der Ausbau des heimischen Arzneipflanzenanbaus
und der Arzneipflanzensammlung wurde zwar von der Industrie wie »von
der gesamten Verbraucherschaft« – angeblich – »ausnahmslos begrüßt«,
doch gleichzeitig äußerte man betriebswirtschaftliche Bedenken. Der Anbau
müsse »nicht nur in Zeiten der Not oder der Möglichkeit einer Einfuhr-
sperre, sondern auch darüber hinaus lebensfähig« sein. Der Einkauf teurer
deutscher Drogen dürfe nicht die »Konkurrenzfähigkeit im Ausland, auf
Open Access Download von der Verlag Österreich eLibrary am 20.06.2022 um 16:03 Uhr
dem Weltmarkt« beeinträchtigen, denn diese sei »von ausschlaggebender
Bedeutung.« Einfuhrregelungen und -sperren sollten minimiert werden auf
diejenigen Drogen, »in denen der deutsche Anbau in der Lage« sei, »quanti-
tativ, qualitativ und preislich den Bedarf der deutschen Verbraucher – der
chemisch-pharmazeutischen Industrie und der Großhändler – zu befriedi-
gen.«11 Diese von ökonomischer Vernunft geprägten Überlegungen standen
in deutlichem Gegensatz zu den ideologisch beeinflußten Positionen der
1934 gegründeten »Deutschen Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Be-
schaffung heimischer Heil-, Gewürz- und Duftpflanzen« und der 1935 ins
Leben gerufenen »Reichsarbeitsgemeinschaft für Heilpflanzenkunde«. Als
Ursache für den Rückgang der Arzneipflanzengewinnung in Deutschland
galt der Reichsarbeitsgemeinschaft nämlich die »merkantile Einstellung der
Kreise, denen das Geschäft auch auf diesem Gebiet mehr bedeutete als die
nationale Notwendigkeit und die deutsche Volksgesundheit«.12
In bezug auf die Heilpflanzenkunde gab das Hauptamt für Volksgesundheit
der NSDAP erst 1943 die Devise aus, »daß eine Rationalisierung des
ganzen Gebietes und die Beseitigung eines seit Jahrhunderten
mitgeschleppten Ballastes von unkritischen Behauptetem, ja Aberglauben,
unbedingt zu erstreben« sei. »Die künstliche Aufblähung« der Indikationen
und die »kritiklose Anpreisung« sollten »zugunsten einer Förderung auf
dem Boden eines überlegenen Wissens« abgestellt werden. Nur so könne die
Phytotherapie »im Konkurrenzkampf der Heilmittel lebendig bleiben.«13
9 Vgl. z. B. Maehle (1991); Helmstädter (1990).
10 Wolff (1935).
11 N. N.: Arzneipflanzen-Anbau (1935), S. 53f.
12 Zitiert nach Aue (1983), S. 269.
13 Schenck (1943), S. 3-5. Zur Person von Ernst-Günther Schenck (geb. 1904) vgl. Bothe
(1991), S. 172.
Franz Steiner Verlag168 Ulrich Meyer
Die pharmazeutische Industrie hatte sich bereits 1939 am Prüfungsinstitut
für biologische Heilmittel in Nürnberg beteiligt.14
Angriffe militanter Naturheilkundler gegen Serumtherapie und Schutzimp-
fung, die in der Zeitschrift Volksgesundheit aus Blut und Boden publiziert wor-
den waren, geißelte die Industrie »als schwere Schädigung der deutschen
Volksgesundheit und Volkswirtschaft«, wobei auch hier der Hinweis auf die
Beeinträchtigung der »Exportkraft« nicht fehlen durfte. Es sei kaum mög-
lich, »mit Leuten sachlich zu verhandeln, die die wissenschaftlichen Arbeits-
ergebnisse der deutschen pharmazeutischen Industrie als ›Erbgifte‹ und als
›allergröbste‹ Blutverunreinigung« bezeichneten.15
Open Access Download von der Verlag Österreich eLibrary am 20.06.2022 um 16:03 Uhr
Die Reaktionen einzelner chemisch-pharmazeutischer Unternehmen
Das größte und einflußreichste chemisch-pharmazeutische Unternehmen
des Dritten Reiches, die I. G. Farben AG, scheint die »Neue Deutsche Heil-
kunde« nicht einmal registriert, geschweige denn als potentielle Bedrohung
gesehen zu haben.16
Bei der Darmstädter Firma Merck beschränkte man sich darauf, ohnehin
hergestellte Präparate gemäß dem Schwabeschen Arzneibuch zu prüfen und
zu kennzeichnen, nachdem diese Hauspharmakopöe 1934 amtliche Gültig-
keit erlangt hatte.17 In den Jahren 1933 und 1934 wurden »Heilmittel der
Eingeborenen aus tropischen Pflanzen [...] in grosser Zahl untersucht und
brachten wissenschaftlich« zwar »viel Neues, aber keines erwies sich den
bekannten Arzneimitteln der Kulturvölker überlegen.«18
Größere Aktivitäten lassen sich hingegen für die in Ludwigshafen ansässige
Knoll AG belegen, wo noch 1942 an zentralem Platz des Werksgeländes ein
nach Indikationen gegliederter Heilpflanzengarten angelegt wurde. Bereits
1934 hatte man eine eigene Abteilung für Pflanzenchemie eingerichtet, die
bis Kriegsende bestand und die der Apotheker Gerhard Schenck (1904-
1993) bis 1939 leitete. Knoll befaßte sich mit der Entwicklung und Herstel-
lung von Gesamtextrakten herzglykosidhaltiger Arzneipflanzen, die als Ole-
ander-, Scilla-, Adonis- und Convallaria-»Perpurate« in den Handel kamen.
Diese »Perpurate« stellen die Vorläufer der heutigen »Miroton«-Präparate
dar. Es handelte sich um »nach einem besonderen Verfahren gewonnene,
biologisch eingestellte Gesamtextrakte mit voller Ausbeute an Wirkstof-
14 Vgl. N. N.: Prüfungsinstitut (1939), S. 74ff., und Conrad (1998), S. 4. Weiterer Träger
des Prüfinstituts war der Verein Deutsche Volksheilkunde e.V. Nürnberg.
15 Heyl: Bedeutung (1934), S. 218.
16 Vgl. BA, Schreiben von Herrn Hans-Hermann Pogarell vom 9. März 2001.
17 MA, Bestand E 3, Protokolle Direktionsbesprechungen 1932-1945, Protokoll vom 14.
Dezember 1934.
18 MA, Bestand F 3, Nr. 38c, Bericht »Arbeiten der Forschungsabteilungen 1933 und
1934«, S. 27.
Franz Steiner VerlagPharmazeutische Industrie und »Neue Deutsche Heilkunde« 169
fen.«19 Berücksichtigt man die Bedeutung des Codeins und seiner Derivate
für den Aufstieg der Firma Knoll, so erscheinen die Untersuchungen zum
Giftlattich (Lactuca virosa)20 besonders bemerkenswert. Eine Zubereitung
aus dem Milchsaft kam 1937 als Antitussivum unter dem Namen »Latucyl«
auf den Markt, für den Lattich waren großangelegte Anbauversuche im
Deutschen Reich und dem »angeschlossenen« Österreich durchgeführt
worden. Als weitere Resultate der phytochemischen Forschung gelangten
das Tierarzneimittel »Enoulan« (standardisiertes Weizenkeimölpräparat,
Einführung 1940), »E-Viterbin« (Vitamin-E-Präparat mit Begleitstoffen des
Getreidekeimes, Einführung 1941) und das Dermatikum »Eutyol« (Fichten-
holzgerbstoffextrakt, Einführung 1944) in den Handel.21 Schenck konnte
die bei Knoll durchgeführten Untersuchungen für seine Habilitation nutzen,
Open Access Download von der Verlag Österreich eLibrary am 20.06.2022 um 16:03 Uhr
die 1936 an der Universität München mit der Schrift »Studien über deut-
sche Heilpflanzen« erfolgte.22
Besonders gut dokumentiert ist die Reaktion der Schering AG auf die
»Neue Deutsche Heilkunde«. Hier kam es 1934 zur Gründung der
Abteilung »Bio-Schering«, die sogar über ein eigenes Logo verfügte. Das
dem Benzol-Ring nachempfundene Scheringsche Sechseck wurde mit einer
stilisierten Blüte ausgefüllt.23 (Abb. 2) Das Sortiment umfaßte drei
Präparate: den Heilschlamm »Pelose« aus dem nahe Rathenow gelegenen
Schollener »Wundersee«, das Wermut-Tonikum »Fortamin« und die
Baldrianzubereitung »Kessoval«.
Das von der Firma Richard Schering24 übernommene Präparat25 »Kes-
soval« basierte auf feinkörnig pulverisierten Baldrianwurzeln, die mit
Gummilösung gebunden, getrocknet, verpreßt und dragiert wurden.26 Eine
Besonderheit soll in der Verwendung einer »Radix kesso« gelegen haben,
»die zum Unterschied von der europäischen Varietät, die nur 1 % Baldri-
anöl« enthalte, »8 % dieses Oels« aufwies. Außerdem betrage »der Aschege-
halt nur 5 % [...], während er sich im allgemeinen zwischen 10 und 15 %«
19 N. N.: Knoll (1949), S. 64.
20 Lactuca virosa ist seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart hinein
immer wieder Gegenstand phytochemischer und pharmakologischer Untersuchungen.
Vgl. Eberhardt (1990), S. 128ff., und Funke/Melzig/Siems/Schenk (2002), S. 40-45.
21 Vgl. Thomas (1986), S. 83, S. 89f.
22 Vgl. zur Person von Schenck: Beyer: Schenck (1969), S. 307, und Beyer: Schenck
(1993), S. 1023f.
23 Vademecum (1936), Abschnitt Medizinische Spezialpräparate, ohne Seitenangabe.
24 Richard Schering, Sohn des Firmengründers Ernst Schering (1824-1889), hatte 1881
eine eigene Fabrik eröffnet, woran die Schering AG ab 1924 50 Prozent der Anteile
hielt. Vgl. N. N.: 25 Jahre (1972), S. 86f.
25 Vgl. SchA, Akte B 2 1377 b), Bericht über Abteilung Bio-Schering vom 31. Mai 1935.
26 SchA, Akte B 5 372, Herstellungsvorschrift für Kessoval vom 30. Juni 1944.
Franz Steiner Verlag170 Ulrich Meyer
bewege.27 Das offensichtlich nach der »Radix kesso« benannte Valeriana-
Präparat »Kessoval« wurde den Ärzten als ein »harmloses Einschläferungs-
mittel [...] von besonders zuverlässiger Wirkung« vorgestellt, das 200 Milli-
gramm Baldrianwurzel pro Dragee enthielt.28 Bemerkenswert sind die
Bemühungen, die günstigen Ergebnisse bei einzelnen Patienten »zu objekti-
vieren und bildmäßig29 zu veranschaulichen.« Hierzu wurden aufwendige
Einfachblindversuche an »Kranken mit Tremorneigung«, darunter sogar
solche mit Morbus Parkinson, durchgeführt. Auch bei Hypertonie-
Patienten ließ sich eine Blutdrucksenkung im Einfachblindversuch
nachweisen.30 1935 erfolgten für »Kessoval« »Propagandasendungen an
sämtliche Aerzte, Homöopathen und Naturheilkundige«. Man ging davon
aus, daß dank »der anerkannten Wirksamkeit des Präparates bei der
Open Access Download von der Verlag Österreich eLibrary am 20.06.2022 um 16:03 Uhr
heutigen Einstellung von Aerzteschaft und Verbrauchern weitere
Erfolgsaussichten durchaus gegeben« seien.31 Leider liegen bis auf einige
Monate der Jahre 1934/1935 keine Absatzzahlen für »Kessoval« vor. Die
Fabrikation des Präparates wurde 1944 eingestellt, da die Schering AG die
kriegsbedingt notwendige Herstellungserlaubnis nicht mehr beantragt
hatte.32
Das Präparat »Fortamin« entstand aus der Beschäftigung des
Unternehmens mit der für die Santonin-Gewinnung genutzten Wermut-Art
27 Stephan (1937), S. 122-128.
28 SchA, Bestand 13, Akte 220, Ärztebrief vom 15. September 1936.
29 Hierbei bediente man sich drei verschiedener Versuchsanordnungen: »Den Patienten
wurde ein etwa linsengroßer Spiegel auf dem Zeigefinger der am meisten zitternden
Hand befestigt. Der durch eine Lichtquelle von vorn beleuchtete Spiegel reflektierte
den Lichtstrahl punktförmig auf eine mit Achsenkreuz versehene Mattscheibe. Hinter
der Mattscheibe war in 1 Meter Entfernung eine Kamera aufgestellt. Die Kranken
wurden dann angewiesen, den Schnittpunkt des Achsenkreuzes auf der Mattscheibe
mit dem Spiegelreflex zu fixieren. Auf der photographischen Platte entstanden auf
diese Weise sternförmige Figuren, aus deren Größe man die Stärke der
Zitterbewegungen direkt ablesen konnte [...] Da sich diese photographische Methode
als zu umständlich erwies, wurden entsprechende Versuche in der Weise angestellt,
daß den Kranken auf dem Zeigefinger der am meisten zitternden Hand eine
Stecknadel mit Leukoplast befestigt wurde. Die Kranken wurden dann veranlaßt, das
Achsenkreuz eines senkrecht aufgestellten berußten Papierstreifens mit gestrecktem
Arm zu fixieren. Der Papierstreifen wurde mit Gummizügen gespannt gehalten und
war federnd befestigt. Versuchsdauer ebenfalls eine Minute [...] Als dritte objektive
Untersuchungsmethode wurden die Zitterbewegungen in analogen Versuchen auf dem
Kymographen mit Hilfe des Schaltenbrandschen Myographen registriert.« Stephan
(1937), S. 124f.
30 Stephan (1937), S. 127.
31 SchA, Akte B 2 1377 b), Bericht über Abteilung Bio-Schering vom 31. Mai 1935.
32 SchA, Akte S 1 105, Schreiben »Herstellungsanweisung für chemische Erzeugnisse«
vom 10. Oktober 1944. Bei der »Herstellungsanweisung« handelt es sich nach
heutigem Sprachgebrauch um eine Herstellungserlaubnis.
Franz Steiner VerlagPharmazeutische Industrie und »Neue Deutsche Heilkunde« 171
Artemisia maritima.33 Das 1935 eingeführte »Fortamin« stellte eine
»hochkonzentrierte Lösung von Bitterstoffen« dar. Es sollte neben der
allgemein bekannten appetitanregenden Wirkung auch solche
Schwächezustände positiv beeinflussen, die »sich nicht durch eine
mangelnde Nahrungsaufnahme oder –ausnützung erklären« ließen,
darunter »leichte Ermüdbarkeit« und »verminderte Arbeitsfähigkeit«. Als
Wirkungsmechanismus postulierte der Schering-Pharmakologe Karl
Junkmann (1897-1976)34 aufgrund diverser Tierversuche, daß »Fortamin«
»die Ansprechbarkeit für sympathikotrope Mittel wie Adrenalin« steigere,
»die für vagotrope Mittel« jedoch herabsetze. Dabei sei es für den
therapeutischen Einsatz wesentlich, »dass die Adrenalinwirkung auf den
gleichzeitig registrierten Blutdruck nicht verstärkt« würde.35 Mit Blick auf
Open Access Download von der Verlag Österreich eLibrary am 20.06.2022 um 16:03 Uhr
die gängigen Stimulantien der Zeit, wie Adrenalin, Ephedrin und Cocain –
wenig später wäre auch das von Fritz Hauschild (1908-1974) entwickelte
Pervitin36 zu nennen gewesen! – führte Junkmann für die Bitterstoffe des
»Fortamins« ins Feld, daß ihre Wirkung »zwar nicht so rasch« eintrete,
»dafür aber [...] kaum die Gefahr der Überdosierung« bestehe, »denn auch
lange Zeit fortgesetzter Gebrauch, selbst in großen Mengen«, habe »noch
nie zu einer unphysiologischen Übererregbarkeit des vegetativen Nerven-
systems geführt, wie sie bei den obengenannten Reizgiften gewohnt« seien.37
In Anzeigen wurde zudem betont, daß »Fortamin« nicht die früher
gebräuchlichen Roborantien Arsen und Strychnin enthielt.38
Junkmann prüfte die Produktionschargen des »Fortamins« fortlaufend
quantitativ auf Wasser-, Asche- und Stickstoffgehalt sowie qualitativ auf
Chlorophyll. Zur Prüfung der sympathikotropen Wirkung dienten die Mo-
delle des Kaninchen-Dünndarms und -Uterus’.39
Für »Fortamin« wurde intensiv Werbung betrieben. Beispielsweise öffnete in
einer in der Münchener Medizinischen Wochenschrift vom 4. Juli 1936 erschie-
nenen Anzeige ein äußerst muskulöser Mann aus eigener Kraft einen mehr
als armdicken Stahlreif, nachdem er die »›Die Tinktur des langen Lebens‹ –
Das Stärkungsmittel aus Bitterstoffen im Mittelalter« zu sich genommen
und dadurch »Kräftesteigerung beim Sport« verspürt hatte.40 (Abb. 3) Indes
33 Junkmann: Fortamin (1937). Als weitere Bitterstofflieferanten waren neben der
Schafgarbe Bitterklee, Enzian, Tausendgüldenkraut und Polygala amara im Gespräch.
Vgl. SchA, Ordner Herstellungsvorschriften, Aktennotiz »Bitterstoff (Fortamin)-
Herstellung« vom Januar 1943.
34 Zu Junkmann vgl. z. B. Langecker (1976), S. 1400f.
35 Junkmann: Fortamin (1937), S. 119.
36 Vgl. Meyer (2002), S. 400ff.
37 Junkmann: Bitterstofftonikum (1935), S. 146-149.
38 Anzeige in: Hausmitteilungen der Schering A. G. Berlin 13, Heft 2 (1941).
39 SchA, Bestand 05, Akte 30, Berichte Dr. Junkmann 1935-1938.
40 Kopie in SchA, Akte S 1 110.
Franz Steiner Verlag172 Ulrich Meyer
entwickelte sich der Absatz des Präparates nicht wie erhofft. Am 31. Mai
1940 stellte man in einer Besprechung fest, »dass die Entwicklung des
Fortamin auch in Deutschland stagnierend« sei, »obgleich die
Propagandaquote etwa 50 %« betrage. »Von einer Aufwertung des
Fortamin durch Kombination mit Hormonen« nahm Schering jedoch
Abstand, da aus »Gründen klarer Preisbildung an dem Vertrieb der reinen
Hormonpräparate [...] festgehalten werden« sollte.41 Die Besprechung war
durch die Aktennotiz »FORTAMIN-Geschäft in Lateinamerika 1936/39«
vom 21. Mai 1940 ausgelöst worden, in der man sogar einen »Verlust auf
der ganzen Linie« konstatiert hatte. Als Grund für die mangelnde
Akzeptanz des Präparates nahm die Medizinisch-Wissenschaftliche
Abteilung an, daß die »Voraussetzung der schnellen und offensichtlichen
Open Access Download von der Verlag Österreich eLibrary am 20.06.2022 um 16:03 Uhr
Wirkung [...] bei Fortamin nicht erfüllt« sei. In Südamerika sahen die
Schering-Niederlassungen Chancen für ein »Forta con Testoviron«, da
»besonders bei Männern« derartige Präparate als »›hormonale
Stärkungsmittel‹ weitere Verbreitung« finden könnten.42
Wegen Mangels an Arbeitskräften stellte man die Fortamin-Produktion
1943 ein.43 Wie im Falle des »Kessovals« wurde die kriegsbedingt notwen-
dige Herstellungserlaubnis 1944 nicht erneut beantragt.44
Als besonderes Kuriosum kann die Übernahme von Gewinnung und Ver-
trieb des »Pelose«-Heilschlammes gelten, die seitens der Schering AG im
Oktober 1934 erfolgte. Schering sah seine »Aufgabe zunächst darin, die
wissenschaftlichen Grundlagen dieses neuartigen Heilschlamms zu schaffen,
um auf dieser Basis den Vertrieb der ›Pelose‹ in dem bei uns üblichen
Rahmen aufzuziehen.«45 Folgerichtig publizierte Schering analytisch fun-
dierte »Forschungsergebnisse zur Geologie des Heilschlamms von Schol-
lene«46 sowie Berichte über »Erfahrungen mit einem neuen deutschem Heil-
schlamm«, die das meßbar außergewöhnlich große Wärme- und Kältehal-
tevermögen der »Pelose« hervorhoben.47 Bereits im folgenden Jahr wurde
die »Propaganda« für dieses Präparat durch »Bearbeitung von Badeanstal-
ten« und Kontaktaufnahme zur Heilpraktikerfachschule Berlin verstärkt.
»Ärzte, Reformärzte, Heilpraktiker« erhielten schriftliches Informationsma-
41 SchA, Akte B 2 0687, Notiz über die Besprechung am 30. Mai 1940.
42 SchA, Akte B 2 0687.
43 Vgl. SchA, Akte B 2 0687, Schreiben an die Prüfungsstelle »Chemische Industrie«
vom 19. Februar 1943.
44 SchA, Akte S 1 105, Schreiben »Herstellungsanweisung für chemische Erzeugnisse«
vom 10. Oktober 1944.
45 SchA, Akte B 2 1377 b), Schreiben an die Fachgruppe Pharmazeutische Erzeugnisse
der Wirtschaftsgruppe Chemische Industrie vom 22. September 1943.
46 Potonie/Benade (1936).
47 Wagner (1937), S. 129ff.
Franz Steiner VerlagPharmazeutische Industrie und »Neue Deutsche Heilkunde« 173
terial, letztere durften sich sogar über die »Uebersendung eines unaufgefor-
derten Musters mit 250 g« »Pelose« freuen.48 Werbeschriften ließ Schering
in großen Stückzahlen drucken. Laut einer Inventur vom 1. Juli 1943 stan-
den 7.475 Stück Sonderdrucke, 28.050 Prospekte und 7.750 Klappkarten
zur Verfügung.49 (Abb. 4) Der aufwendig illustrierte Prospekt »Schollene
und sein Wundersee« verdient besondere Beachtung. Hier wurden auf dem
Titelblatt germanisch anmutende junge Frauen »Am Strand des Wunder-
sees« präsentiert, während im Inneren »Eine der malerischen ›schwimmen-
den Inseln‹« die Aufmerksamkeit des Lesers wecken sollte. Zu lesen war:
Schollene [...] Seit Hunderten von Jahren leben dort fleißige Fischer- und
Ackerbürgerfamilien, ihren Beruf und ihre Liebe zur Heimat vom Vater auf den Sohn
Open Access Download von der Verlag Österreich eLibrary am 20.06.2022 um 16:03 Uhr
vererbend [...] Das Kleinod [...] ist der etwa zwei Quadratkilometer große See, den der
Volksmund den »Wundersee von Schollene« getauft hat [...] Zwei Merkwürdigkeiten
[...] werden durch das Schlammvorkommen erklärt, seine schwimmenden Inseln und
sein oft märchenhaft silberner Glanz [...] Die in Schollene ansässige Landbevölkerung
kannte schon seit langer Zeit die hervorragenden Heilwirkungen seines Schlammes.
Erst den letzten Jahren war es vorbehalten, diesen in seiner Art einzigen deutschen Na-
turheilschlamm, die »Pelose«, wie man den Heilschlamm nach dem Griechischen be-
zeichnete, eingehend zu erforschen, seine Hochwertigkeit zu erkennen und seine An-
wendung weitesten Kreisen zugänglich zu machen.50 (Abb. 5)
Ähnlich illustriert und lyrisch formuliert war ein Beitrag für die Werkszei-
tung Schering-Blätter, der unter der Überschrift »Wir fahren nach Schollene«
1935 erschien.51
»Um in Laienkreisen den Schollener See und den daraus gewonnenen Heil-
schlamm möglichst bekanntzumachen«, versuchte die Presse-Abteilung,
»Aufsätze, Bilder und Referate über die Pelose in der Tagespresse unterzu-
bringen«, was auch gelang. Man war der Auffassung: »Die heutige starke
Propagierung naturgemässer Heilfaktoren dürfte auch unserer Pelose die
Aufmerksamkeit weiterer Kreise sichern, zumal das an sich grosse Indika-
tionsgebiet sicherlich noch erweitert werden« könne.
Die Auswertung des Propagandamomentes »Deutscher Heilschlamm« dürfte sich
auch bei zurückhaltendem Gebrauch gegenüber unserer Hauptkonkurrenz, dem
Pistyan-Schlamm günstig auswirken, zumal die Abkehr von der Verwendung
ausländischer Erzeugnisse Hand in Hand
gehe »mit Devisenschwierigkeiten für die Einfuhr dieser Artikel.«52 Dem
»Kleinsiedler« wurde die »Pelose« unter dem Motto »Märkischer Schlamm
48 SchA, Akte B 2 1377 b), Bericht über Abteilung Bio-Schering vom 31. Mai 1935.
49 Vgl. SchA, Akte B 2 1377 b), Aufstellung »Werbematerial ›PELOSE‹ (Stand vom 1.
Juli 1943)«.
50 Prospekt »Schollene und sein Wundersee« (1935).
51 SchA, Akte S 1 106, Beitrag von F. Strauhal in Schering-Blätter Heft 6/1935, S. 118ff.
52 SchA, Akte B 2 1377 b), Bericht über Abteilung Bio-Schering vom 31. Mai 1935.
Franz Steiner Verlag174 Ulrich Meyer
heilt lahme Rinderhüften und verstauchte Ziegenbeine« auch für veterinär-
medizinische Zwecke ans Herz gelegt.53
Nachdem das Präparat in den Jahren 1934 bis 1937 120.700 RM Verlust
erbracht hatte, denen 1938/1939 bescheidene 12.100 RM Gewinn gegen-
überstanden, wendete sich im August 1940 das Blatt für die »Pelose«. Der
Vorstand der Schering AG war nun »prinzipiell damit einverstanden«,
seine »Interessen an dem [...] Heilschlamm PELOSE zu verkaufen, da der
Vertrieb und die Propaganda dieses Produktes« nicht in die »Fabrikations-
und Geschäftsinteressen passen« würde. Als potentieller Käufer erschienen
zunächst die Münchner Bastian-Werke, ein »auf dem Gebiete der
Bädertherapie in Deutschland zurzeit führendes« Unternehmen.54 Nach
Open Access Download von der Verlag Österreich eLibrary am 20.06.2022 um 16:03 Uhr
dem Scheitern der Verhandlungen mit den Bastian-Werken sollte der
weitere Vertrieb eingestellt werden55, bis mit der Firma Bewal- und
Rheumaweg-Fabrik und dem früheren Schering-Mitarbeiter Walter Hund
neue Interessenten auf den Plan traten.56 Hund erhielt – wohl aus alter
Verbundenheit – den Zuschlag.57 Ende 1944 mußte er beim
Reichsgesundheitsamt um die Verlängerung der Herstellungserlaubnis für
»Pelose« kämpfen, wobei er betonte, daß es sich eigentlich um »kein
Erzeugnis, sondern ein Naturprodukt« handle. Es werde »jetzt im Kriege«
auch an Lazarette in Großpackungen geliefert. Die 1944 abgegebenen
110.000 kg »Pelose« hätten ca. 660.000 Applikationen erlaubt, »für den
Kriegsgesundheitsdienst« sei »dies doch ein recht beachtlicher Beitrag«, und
»besonders auch viele Kriegsverletzungen« seien mit »Pelose« behandelt
worden. »Nicht unerwähnt« wollte man lassen, »dass der Eifelfango zur Zeit
nicht lieferbar« sei »und auch die ausländischen Fangoarten« fehlten.58
Hund gelang es, das »Pelose«-Werk in die DDR hinüberzuretten, bis es
Mitte der fünfziger Jahre verstaatlicht und schließlich in einen Betriebsteil
des VEB Polstermöbelwerkes Havelberg (!) überführt wurde.
53 Sonntagszeitung vom 13. Oktober 1935, Privatarchiv Erika Gorges, Schollene. Wir
danken Frau Gorges sehr herzlich für ihre freundliche Unterstützung.
54 SchA, Akte B 2 1377 b), Schreiben »Betr.: PELOSE« vom 23. August 1940.
55 Vgl. SchA, Akte B 2 1377 b), »Auszug aus den Notizen über die
Vorstandspostbesprechung am 8.4.« vom 9. April 1943.
56 Vgl. SchA, Akte B 2 1377 b), Aktennotiz »Betr.: Pelose« vom 7. Mai 1943.
57 Vgl. SchA, Akte B 2 1377 b), Schreiben an die Bewal- und Rheumaweg-Fabrik vom
15. Mai 1943.
58 SchA, Akte B 2 1377 b), Schreiben an das Reichs-Gesundheitsamt Berlin vom 19.
Dezember 1944.
Franz Steiner VerlagPharmazeutische Industrie und »Neue Deutsche Heilkunde« 175
»Neue Deutsche Heilkunde« und Naturheilmittelhersteller
Fritz Krafft bemerkte 1996 zur NS-Gesundheitspolitik:
Die »Naturheilkunde« fand in diesem Umfeld einen vorzüglichen Nährboden, und die
heute auf diesem Gebiet tätigen Firmen verdanken, wenn schon nicht ihre Entstehung,
so doch ihre wirtschaftliche Bedeutung dieser nationalsozialistischen »Wiedergeburt
der Pharmazie«59.
Die Schwabesche Pharmakopöe wurde aus dieser Perspektive zu einem für
die »firmeneigene Werbung gedachten Homöopathischen Arzneibuch«60
(HAB).
Bereits ein kurzer Blick in das HAB von 1934 zeigt jedoch, daß es sich um eine
Open Access Download von der Verlag Österreich eLibrary am 20.06.2022 um 16:03 Uhr
nüchterne Sammlung von Herstellungs- und Prüfvorschriften handelt, die jeden
werblichen Charakters entbehrt.
Die wirtschaftlichen Auswirkungen der »Neuen Deutschen Heilkunde« lassen
sich zumindest für den bedeutendsten Naturheilmittelhersteller des Deutschen
Reiches, die Firma Dr. Willmar Schwabe61, beleuchten. Die vom Leipziger
Archivar Volker Jäger bereits 1991 publizierten Zahlen zeigen, daß Schwabe
selbst im Jahr 1940 mit 3,8 Mio. RM den Umsatz des Jahres 1930 (4,1 Mio. RM)
noch nicht wieder zu erreichen vermochte. Erst die Kriegsproduktion brachte –
wie für die gesamte pharmazeutische Industrie – ein deutliches Umsatzwachs-
tum. 1944 belief sich der Jahresumsatz auf 6,7 Mio. RM.62
Für den zweitgrößten Hersteller, die in Dresden-Radebeul ansässige Firma
Madaus, ließ sich entsprechendes Zahlenmaterial bislang noch nicht ermit-
teln.63 Indes ist auch hier keine Brücke zur wirtschaftlichen Entwicklung in
der Nachkriegszeit zu schlagen, da das in der Sowjetischen Besatzungszone
gelegene Unternehmen entschädigungslos verstaatlicht wurde und im VEB
Arzneimittelwerk Dresden aufging.64 Die enteignete Familie mußte in Köln-
Merheim neu beginnen. Gleiches gilt im übrigen für die Firma Schwabe,
die in Leipzig beheimatet war. Sie bildete die Keimzelle des VEB Leipziger
Arzneimittelwerks, während die Eignerfamilie in den Westen übersiedelte
und in Karlsruhe-Durlach ein neues Werk aufbaute.65
Lediglich für die deutlich kleinere Firma Schaper & Brümmer (Salzgitter-
Ringelheim) läßt sich ein positiver Einfluß der »Neuen Deutschen Heil-
59 Krafft: Einstein (1996).
60 Krafft: Pharmacia (1999).
61 Zur Geschichte der Firma Schwabe vgl. Michalak (1991).
62 Vgl. Jäger (1991), S. 181, S. 185.
63 Recherchen im Sächsischen Staatsarchiv in Dresden und im Archiv des
Arzneimittelwerks Dresden (Radebeul) verliefen ergebnislos. Wir danken Herrn Dr.
Andreas Schuhmann (Freital/Sachsen) sehr herzlich für seine Unterstützung.
64 Vgl. Schuhmann (2002), S. 15-23.
65 Vgl. z. B. Herrmann (1998), S. 401-404.
Franz Steiner Verlag176 Ulrich Meyer
kunde« auf den Geschäftsgang feststellen. Der Umsatz stieg von 1934 bis
1939 von 190.000 auf 670.000 RM. Nichtsdestotrotz war das Unternehmen
1940 von der Stillegung bedroht und konnte dieser nur mit Hinweis auf
Export-Devisenerlöse und einer Umstellung auf Kriegsproduktion entgehen.
Diese ermöglichte eine weitere Steigerung des Umsatzes auf fast 4 Mio. RM
im Jahr 1944.66 Berücksichtigt man allerdings die Umsatzentwicklung der
Jahre 1952-1963, ein Zeitraum, in dem in der Bundesrepublik die Allopa-
thie deutlich an Boden gewann und die Naturheilkunde an Bedeutung ver-
lor, so differenziert sich das Bild auch für Schaper & Brümmer. Das Unter-
nehmen konnte in diesen Jahren den Umsatz von 2 auf 10 Mio. DM ver-
fünffachen.67 Die einzige relevante Frucht der »Neuen Deutschen Heil-
kunde« für Schaper & Brümmer blieb das Präparat »Esberitox«, das Erich
Open Access Download von der Verlag Österreich eLibrary am 20.06.2022 um 16:03 Uhr
Schaper (1901-1970) 1934, durch den radikalen Impfgegner Julius Streicher
(1885-1946)68 inspiriert, als Mittel gegen Impfschäden konzipiert hatte.69
Diskussion
Im Hinblick auf den Arzneimittelmarkt strebte die NS-Gesundheitspolitik
neben der Propagierung phytotherapeutischer oder auch homöopathischer
Arzneimittel eine »Wiedergeburt der Pharmazie« an. Diese sollte die indu-
striell gefertigten Arzneispezialitäten zurückdrängen und einen Aufschwung
von Rezeptur und Defektur in den Apotheken bewirken. Über den hohen
Anspruch und die nüchterne Wirklichkeit der »Wiedergeburt der Pharma-
zie« wurde an anderer Stelle berichtet.70
Vergleicht man die Reaktion der pharmazeutischen Industrie auf die »Neue
Deutsche Heilkunde« mit der auf die »Wiedergeburt der Pharmazie«, so
wird deutlich, daß letztere als weitaus bedeutendere Gefahr wahrgenommen
wurde. Von einer echten Wiederbelebung der Rezeptur und Defektur wäre
die gesamte Branche – unabhängig von der individuellen Ausrichtung des
einzelnen Herstellers – betroffen gewesen. Entsprechend heftig gestaltete
sich die Auseinandersetzung mit der deutschen Apothekerschaft.
In bezug auf die »Neue Deutsche Heilkunde« mußte die Reipha hingegen
diplomatisch agieren, da innerhalb des Verbandes selbst eine ganze Anzahl
von Naturheilmittel-Herstellern vertreten war. Die Reipha verfolgte eine
geschickte Strategie des »Sowohl-als-Auch«, wobei Angriffe fanatischer Na-
turheiler, z. B. auf die Behringsche Serumtherapie, stets abgewehrt wurden.
66 Vgl. Conrad (1998), S. 36, S. 48-54.
67 Conrad (1998), S. 83.
68 Zur Rolle von Streicher in den Auseinandersetzungen um die »Neue Deutsche
Heilkunde« vgl. Bothe (1991).
69 Vgl. Conrad (1998), S. 35.
70 Meyer: Pharmazeutische Industrie (2004).
Franz Steiner VerlagPharmazeutische Industrie und »Neue Deutsche Heilkunde« 177
Die völlige Ignoranz der I. G. Farben gegenüber der »Neuen Deutschen
Heilkunde« spricht dafür, daß die chemisch-pharmazeutische Großindustrie
das Phänomen von Anfang an weniger ernst nahm, als man heute
vermuten würde. Lediglich für die beiden mittelständischen Hersteller Knoll
und Schering lassen sich Aktivitäten auf dem Gebiet der Naturheilmittel
nachweisen. Auffallend ist bei beiden Firmen, daß sie sich um eine
naturwissenschaftliche Fundierung der entwickelten Präparate bemühten
und sich konventioneller Methoden der Analytik und des
Wirksamkeitsnachweises bedienten. Letztlich blieben ihre mehr oder
weniger als Naturheilmittel zu bezeichnenden Präparate Fremdkörper im
jeweiligen Sortiment, denn eine bewährte Vertriebsstruktur, z. B. zur
Ansprache der Heilpraktiker, fehlte. Beide Firmen ließen in ihren
Open Access Download von der Verlag Österreich eLibrary am 20.06.2022 um 16:03 Uhr
Bemühungen Ende der dreißiger Jahre nach, im Falle Scherings wurde seit
1938 nicht einmal mehr der Begriff »Bio-Schering« verwendet.71 Dies
spricht für die von Robert Jütte und anderen72 vertretene These, daß die
»Neue Deutsche Heilkunde« 1936 mit dem Inkrafttreten des
kriegsvorbereitenden Vierjahresplans ihren Zenit bereits überschritten
hatte.73
Der Aufschwung der Naturheilmittelhersteller war, wenn er denn überhaupt
stattfand, deutlich kleiner, als theoretisch postuliert wurde. Es besteht kein
kausaler Zusammenhang zwischen eventuellen geschäftlichen Erfolgen wäh-
rend der NS-Zeit und heutiger wirtschaftlicher Prosperität.
Lediglich beim staatlich forcierten Anbau von Heil- und Gewürzpflanzen
waren eklatante Steigerungen zu verzeichnen. Indes läßt sich aus der Erwei-
terung des Anbaus nicht unmittelbar auf eine erhöhte Produktion von Phy-
topharmaka bzw. Homöopathika schließen. Zum einen entfiel ein Teil des
Flächenzuwachses auf Küchengewürze und Duftpflanzen, zum anderen
wurde im Rahmen der Autarkiebemühungen der Bezug von Drogen aus
dem Ausland eingeschränkt.74
Es fällt auf, daß die Industrie sowohl in bezug auf die »Wiedergeburt der
Pharmazie« als auch im Hinblick auf die »Neue Deutsche Heilkunde« stets
betonte, daß unüberlegte Maßnahmen im Inland den Arzneimittel-Export
schwer schädigen würden. Die starke Auslandsorientierung der reichsdeut-
schen pharmazeutischen Industrie könnte auch eine Erklärung dafür sein,
daß ihre Hauszeitschrift im Vergleich zur Deutschen Apotheker Zeitung weni-
ger ideologiebehaftet erscheint und antisemitische Äußerungen weitestge-
71 Vgl. Vademecum (1938), S. 9. Im Vademecum des Jahres 1940 fehlten sogar die
Produktabbildungen.
72 Vgl. Haug (1985); Bothe (1991); Karrasch (1998).
73 Vgl. Jütte (1996), S. 52.
74 Vgl. Aue (1983), S. 277. Während die Anbaufläche von Heil- und Gewürzpflanzen
1934 nur 820 Hektar betragen hatte, erreichte sie 1940 mit 8.362 Hektar mehr als die
zehnfache Größe.
Franz Steiner Verlag178 Ulrich Meyer
hend fehlen.75 Die industrielle »Apotheke der Welt« wollte ihr Gesicht so
weit als möglich wahren.
Bibliographie
Archivalien
Bayer-Archiv (BA)
Schreiben von Herrn Hans-Hermann Pogarell vom 9. März 2001
Merck-Archiv (MA)
Open Access Download von der Verlag Österreich eLibrary am 20.06.2022 um 16:03 Uhr
Bestand E 3: Protokolle Direktionsbesprechungen 1932-1945
Bestand F 3, Nr. 38 c Bericht Arbeiten der Forschungsabteilungen 1933 und 1934
Schering-Archiv (SchA)
Bestand 13, Akte 220
Bestand B 2 Akte 1377 b)
Bestand B 5 Akte 372
Bestand S 1 Akte 105
Ordner Herstellungsvorschriften
Bestand 05, Akte 30
Bestand B 2 Akte 0687
Bestand S 1 Akte 106 Band S 1 Akte 110
Privatarchiv Erika Gorges, Schollene
Sonntagszeitung vom 13. Oktober 1935
Quellen
Anzeige in Heft 2 der Hausmitteilungen der Schering A. G. Berlin 13 (1941).
Heyl, Werner: Die Bedeutung der pharmazeutischen Industrie für Deutschlands Volksge-
sundheit und Kultur. In: Pharmazeutische Industrie 1 (1934), 213-219.
Heyl, Werner: Sinn und Aufgaben der Fachgruppe »Pharmazeutische Erzeugnisse«. In:
Pharmazeutische Industrie 2 (1935), 129-132.
Junkmann, Karl: Ein neues Bitterstofftonikum (Fortamin). In: Hausmitteilungen der Sche-
ring A. G. Berlin 7 (1935), 146-149.
Junkmann, Karl: Über Fortamin. In: Hausmitteilungen der Schering A. G. Berlin 9 (1937),
117-122.
75 Vgl. die von Schwarz (1996) vorgelegte Analyse der Deutschen Apotheker Zeitung.
Franz Steiner VerlagPharmazeutische Industrie und »Neue Deutsche Heilkunde« 179
Kunze, Ernst: Die Bedeutung der biologischen Heil- und Nährmittelindustrie für die
Volksgesundheit. In: Pharmazeutische Industrie 1 (1934), 633-634.
Kunze, Ernst: Zum Jahreswechsel! – An alle Mitglieder der Fachabteilungen I und IV. In:
Pharmazeutische Industrie 3 (1936), 3-4.
N. N.: Zur Einführung. In: Pharmazeutische Industrie 0 (1933), 1-2.
N. N.: Ausstellung »Deutsches Volk – Deutsche Arbeit« 1934. In: Pharmazeutische Indu-
strie 1 (1934), 299-300.
N. N.: Die konstituierende Mitgliederversammlung der Fachabteilung I. In: Pharmazeuti-
sche Industrie 2 (1935), 500.
N. N.: Arzneipflanzen-Anbau und -Sammlung. In: Pharmazeutische Industrie 2 (1935), 53-
54.
Open Access Download von der Verlag Österreich eLibrary am 20.06.2022 um 16:03 Uhr
N. N.: Das Prüfungsinstitut für biologische Heilmittel. In: Pharmazeutische Industrie 6
(1939), 74-76.
N. N.: Knoll 1886-1949. Ludwigshafen/Rhein 1949.
Potonie, R.; Benade, W.: Forschungsergebnisse zur Geologie des Heilschlamms von Schol-
lene. In: Hausmitteilungen der Schering A. G. Berlin 8 (1936), 111-114.
Prospekt »Schollene und sein Wundersee« (1935).
Schenck, Ernst-Günther: Rationalisierung in der Heilpflanzenkunde. In: Pharmazeutische
Industrie 10 (1943), 3-5.
Stephan, Martin: Versuche über die sedative Wirkung des Baldrians. In: Hausmitteilungen
der Schering A. G. Berlin 9 (1937), 122-128.
Vademecum für das ärztliche Laboratorium Schering-Kahlbaum A. G. Berlin 1936.
Vademecum für das ärztliche Laboratorium Schering-Kahlbaum A. G. Berlin 1938.
Wagner, H.: Erfahrungen mit einem neuen deutschen Heilschlamm. In: Hausmitteilungen
der Schering A. G. Berlin 9 (1937), 129-131.
Wolff, Albert: Der Weg zum »biologischen« Heilmittel. In: Pharmazeutische Industrie 2
(1935), 3-6.
Literatur
Aue, Uta von der: Die deutsche Hortus-Gesellschaft (1917-1943) – Natürlicher Heilpflan-
zenanbau und Förderung der Phytotherapie in Deutschland. Diss. rer. nat. Berlin 1983.
Beyer, Karl-Heinz: Prof. Dr. Gerhard Schenck, Berlin, 65 Jahre. In: DAZ 109 (1969), 307.
Beyer, Karl-Heinz: Professor Dr. Gerhard Schenck in memoriam. In: DAZ 133 (1993),
1023-1024.
Bothe, Detlef: Neue Deutsche Heilkunde 1933-1945. Husum 1991.
Conrad, Claus: Wollen, Wägen, Wagen – 75 Jahre Schaper & Brümmer. Salzgitter 1998.
Eberhardt, Gunter: G. F. Walz (1813-1862). Stuttgart 1990.
Funke, Ines; Melzig, Matthias F.; Siems, Wolf-Eberhard; Schenk, Regina: Lactuca virosa
L. und Lactucarium – Molekularpharmakologische Untersuchungen zur Erklärung der
analgetischen Potenz. In: Zeitschrift für Phytotherapie 23 (2002), 40-45.
Haug, Alfred: Die Reichsarbeitsgemeinschaft für eine Neue Deutsche Heilkunde (1935/36).
Husum 1985.
Franz Steiner Verlag180 Ulrich Meyer
Helmstädter, Axel: Zur Geschichte der deutschen Impfgegnerbewegung. In: Geschichte der
Pharmazie 42 (1990), 19-23.
Herrmann, Wilfrid: Unternehmensprofil Schwabe. In: Pharmazeutische Industrie 60
(1998), 401-404.
Jäger, Volker: Im Dienste der Gesundheit – Zur Geschichte der Firma Willmar Schwabe.
In: Medizin, Gesellschaft und Geschichte 10 (1991), 171-188.
Jütte, Robert: Geschichte der Alternativen Medizin. München 1996.
Karrasch, Bertram: Volksheilkundliche Laienverbände im Dritten Reich. Stuttgart 1998.
Krafft, Fritz: Albert Einstein und die Folgen aus wissenschaftshistorischer Sicht. In: Phar-
mazeutische Zeitung 141 (1996), 435-446.
Open Access Download von der Verlag Österreich eLibrary am 20.06.2022 um 16:03 Uhr
Krafft, Fritz: Pharmacia, quo vadis? In: Pharmazeutische Zeitung 144 (1999), 851-858.
Langecker, Hedwig: In memoriam Professor h. c., Dr. med., Dr. rer. nat. h. c. Karl Junk-
mann. In: Arzneimittelforschung 26 (1976), 1400-1401.
Maehle, Andreas-Holger: Präventivmedizin als wissenschaftliches und gesellschaftliches
Problem: Der Streit über das Reichsimpfgesetz von 1874. In: Medizin, Gesellschaft und
Geschichte 9 (1991), 127-148.
Meyer, Ulrich: Steckt eine Allergie dahinter? Stuttgart 2002.
Meyer, Ulrich: Pharmazeutische Industrie und NS-Staat. In: Akten des 35. Internationalen
Kongresses für Geschichte der Pharmazie Luzern, 19.-22.9.2001. (=Veröffentlichungen der
Schweizerischen Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie, 25) Liebefeld 2004. (CD)
Michalak, Michael: Das homöopathische Arzneimittel – Von den Anfängen zur industriel-
len Fertigung. Stuttgart 1991.
N. N.: 25 Jahre Blücher-Schering & Co., Lübeck. In: Pharmazeutische Industrie 34 (1972),
86-87.
Schröder, Gerald: Die »Wiedergeburt« der Pharmazie – 1933-1934. In: Mehrtens, Herbert;
Richter, Steffen (Hg.): Naturwissenschaft, Technik und NS-Ideologie. Frankfurt/Main
1980, 166-188.
Schröder, Gerald: Die Wiederbelebung der Phytotherapie im Zusammenhang mit den Re-
formbestrebungen der NS-Pharmazie. In: Hickel, Erika; Schröder, Gerald (Hg.): Neue Bei-
träge zur Arzneimittelgeschichte. Stuttgart 1982, 111-128.
Schröder, Gerald: NS-Pharmazie. Stuttgart 1988.
Schuhmann, Andreas: Die Geschichte des Arzneimittelwerkes Dresden. Dresden 2002.
Schwarz, Berit: Zur Durchsetzung der NS-Ideologie im Apothekenwesen im Spiegel einer
pharmazeutischen Fachzeitschrift. Dipl. Arbeit Pharmazeutisches Institut der Universität
Greifswald 1996.
Siebert, Gerhard: Die Pharmazie innerhalb des Gesundheitswesens während der Jahre
1933-1937 im Spiegel der pharmazeutischen Presse. Mag. Arbeit Bergische Universität-
Gesamthochschule Wuppertal 1992.
Thomas, Ulrike: 100 Jahre im Dienste der Gesundheit. Ludwigshafen/Rhein 1986.
Franz Steiner VerlagPharmazeutische Industrie und »Neue Deutsche Heilkunde« 181
Open Access Download von der Verlag Österreich eLibrary am 20.06.2022 um 16:03 Uhr
Abb. 1
Abb. 2 Abb. 3
Franz Steiner VerlagOpen Access Download von der Verlag Österreich eLibrary am 20.06.2022 um 16:03 Uhr
182
Abb. 4
Abb. 5
Franz Steiner Verlag
Ulrich MeyerSie können auch lesen