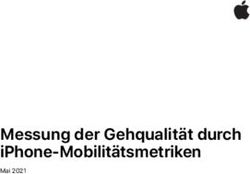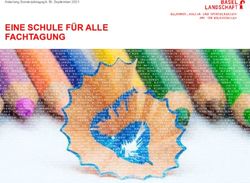(PP) Professionalisierungspraktikum - Begleitinformationen und Handreichungen für Studierende, Praktikumseinrichtung und Dozierende
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Professionalisierungspraktikum
(PP)
Begleitinformationen und Handreichungen für
Studierende, Praktikumseinrichtung und Dozierende
-------------Zentrum für schulpraktische Studien: Stand November 2014------------Handreichung Professionalisierungspraktikum (PP)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inhaltsverzeichnis
Vorbemerkung Seite
1. Ziele & Rahmenbedingungen 4
2. Ablauf & Vorgehen 6
3. Aufgaben & Zuständigkeiten…
a. der/des Studierenden 7
b. der/des Hochschuldozenten/in 7
c. der aufnehmenden Bildungseinrichtung 8
4. Bestehen und Nichtbestehen des Praktikums 9
5. Datenschutz und ethische Richtlinien 9
6. Das Portfolio im Professionalisierungspraktikum 10
7. Abschließende Hinweise 11
8. Anhang 12
8.1 Das Exposé
a. Offenlegung des Erkenntnisinteresses
b. Fachlich/theoretische Begründung der Fragestellung
c. Fragestellung
d. Methodisches Vorgehen
e. Ihre konkrete Umsetzungsplanung
f. Ergebniskommunikation und Reflexion
g. Literaturangaben
2Handreichung Professionalisierungspraktikum (PP)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vorbemerkung
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende,
die zum 1. Oktober 2011 in Kraft getretene neue Prüfungsordnung für das Studium der Lehrämter an
den Pädagogischen Hochschulen des Landes Baden-Württemberg enthält auch eine neue
Praktikumsordnung. Demnach bestehen die schulpraktischen Studien aus drei Praktikumsblöcken:
1. Das Orientierungs- und Einführungspraktikum (OEP) nach dem 1. Semester.
2. Das Integrierte Semesterpraktikum (ISP) im 4., 5. oder 6. Semester.
3. Das Professionalisierungspraktikum (PP) im 7. oder 8. Semester oder dazwischen.
In diesem Begleitheft erhalten Sie Informationen über die Zielsetzung, Organisation, Durchführung und
Aufgaben im Professionalisierungspraktikum (PP) sowie weitere Anregungen im Anhang der
Handreichung.
Das Professionalisierungspraktikum können die Studierenden nach erfolgreichem Abschluss des ISP als
vierwöchiges Blockpraktikum oder tageweise (20 Praktikumstage) durchführen. Es findet bundesweit
oder im Ausland in Schulen oder anderen Bildungseinrichtungen statt.
Besonderheit des Professionalisierungspraktikums ist eine stark forschende Ausrichtung, wahlweise
verknüpft mit der anschließenden Wissenschaftlichen Hausarbeit.
Diese Handreichung richtet sich an drei Personengruppen, die nachfolgend angesprochen werden. Sie
erhalten alle diese Handreichung um den gleichen Informationsstand bei allen Beteiligten zu sichern.
Sehr geehrte Damen und Herren der Einrichtungsleitung, die Kultusbehörden vertrauen Ihnen in enger
Zusammenarbeit mit der PH Freiburg die Begleitung und Betreuung der Studierenden im
Professionalisierungspraktikum an. Hauptziele sind dabei eine fokussierende Herangehensweise der
Studierenden zur Entwicklung einer professionellen Haltung. Wir, die Studierenden und Lehrenden der
Pädagogischen Hochschule Freiburg, wissen und schätzen dies und bitten um Ihre Unterstützung in dieser
abschließenden Phase der schulpraktischen Ausbildung am Ende des Studiums.
Liebe Dozierende, wir danken Ihnen für Ihr Engagement, die Studierenden als Ansprechperson und
insbesondere bei der inhaltlichen Vorbereitung zu unterstützen und damit einen unentbehrlichen Beitrag
zur Professionalisierung durch Schulpraktika zu leisten.
Liebe Studierende, Sie stehen vor einer sehr arbeitsintensiven, aber auch sehr spannenden Phase Ihres
Studiums. Nehmen Sie die Herausforderung des Forschenden Lernens an und nutzen Sie die Zeit, um von
den erfahrenen Fachkräften an Ihrer Seite zu profitieren. Wir hoffen, dass Sie mit Freude an die
Schulpraxis herantreten und zu vielen wertvollen Erkenntnissen gelangen. Wir wünschen Ihnen eine
lernintensive und erfahrungsreiche Zeit.
Für weitere Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen des Schulpraxisbüros gerne jeweils zur
Sprechstundenzeit (KGII 218/219) sowie per E-Mail oder Telefon zur Verfügung.
Annerose Schneider: annerose.schneider@ph-freiburg.de Tel.: +49 761 682-283
Eva Wystrach: wystrach@ph-freiburg.de Tel.: +49 761 682-284
Link: https://www.ph-freiburg.de/de/hochschule/zentrale-einrichtungen/zfs
Mit freundlichen Grüßen,
Prof. Dr. Lars Holzäpfel, Dr. Jutta Nikel,
Zentrum für Schulpraktische Studien der Pädagogischen Hochschule Freiburg
Freiburg, 1.11.2014
3Handreichung Professionalisierungspraktikum (PP)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Ziele & Rahmenbedingungen
Ziele
Im Zentrum des Professionalisierungspraktikums steht die intensive Auseinandersetzung der/des
Studierenden mit einem - selbstgewählten - Aspekt pädagogischer Praxis. Dieser wird auf eine
spezifische Fragestellung eingegrenzt. Das Praktikum soll es ermöglichen, diese Fragestellung
systematisch und methodengeleitet dem zeitlichen Umfang entsprechend zu beantworten. Damit legt
das Professionalisierungspraktikum einen Schwerpunkt auf die Entwicklung des forschenden Lernens
(siehe auch GPO I 2011 §12 (9) bzw. WHRPO I 2011 § 9 (9)). So können beispielsweise Projekte zur
Unterrichtsforschung, zur individuellen Förderung von Schülerinnen und Schülern, zu inklusiven
Bildungsangeboten oder zur Kooperation mit Eltern durchgeführt werden. Auch die Entwicklung der
eigenen Kompetenz bezogen auf das Lehren und Lernen kann zum Projekt im
Professionalisierungspraktikum werden.
Es gibt keine einheitlich verwendete Definition des Forschenden Lernens. In Bezug auf Forschendes
Lernen in den schulpraktischen Studien orientieren wir uns an der von der Bundesarbeitsgemeinschaft
Schulpraktischer Studien vorgeschlagenen Unterscheidung von Forschendem Lernen „als ein didaktisches
Prinzip bzw. eine Aktionsform“ und als „hochschuldidaktisches Setting“, in dem Studierende bestimmte
Kompetenzen entwickeln (BASS, 2013:1-2) 1.
Bei ersterem kann Forschendes Lernen als ein didaktisches Prinzip bzw. eine Aktionsform
beschrieben werden, in deren Verlauf die Studierenden einen vollständigen Forschungsprozess
durchlaufen, „in dem/in der
- die Studierenden selbstständig eine aus dem Kontext Schule relevante Fragestellung oder
Hypothese entwickeln oder eine relevante Fragestellung aus Schulen übernehmen,
- mithilfe einer der Fragestellung angemessenen Methode (oder mehrerer der Fragestellung
angemessenen Methoden) nach potenziellen Antworten suchen,
- den Forschungsprozess angeleitet selbst gestalten und reflektieren,
- ihre Ergebnisse theoriegestützt diskutieren, aufbereiten und präsentieren“ (BASS, 2013:1-2)
Bei zweitem, Forschendes Lernen als hochschuldidaktisches Setting, steht die Entwicklung bestimmter
Kompetenzen bei Studierenden im Vordergrund. Es kann dabei im Kontext Forschenden Lernens
zwischen „wissenschaftlich-erkenntnisbezogene Kompetenzen, systembezogen-evaluative Kompetenzen
oder akteursbezogen-handlungsorientierte Kompetenzen“ unterschieden werden (ibid.). Ziele können in
der Erkenntnis-, Organisations- oder Personalentwicklung liegen“ (ibid.)
Rahmenbedingungen des Professionalisierungspraktikums im Überblick
Voraussetzungen
Das Professionalisierungspraktikum können Studierende absolvieren, wenn sie das Modul M2 ISP
(Integriertes Semesterpraktikum), erfolgreich absolviert haben.
Form und Dauer
Der gesamte Workload beträgt 120 Stunden, die neben der eigentlichen Praktikumstätigkeit auch
vor- und nachbereitende Tätigkeiten beinhalten. In der Regel wird das Praktikum als vierwöchiges
durchgehendes Blockpraktikum durchgeführt. Sollte eine studienbegleitende Praktikumsform
erforderlich sein, ist ein Äquivalent von 20 Praktikumstagen nachzuweisen. Die Präsenzzeit an der
Bildungseinrichtung (am Praktikumsort) während des Professionalisierungspraktikums liegt bei
ungefähr vier Stunden pro Tag. Dabei handelt es sich lediglich um einen Richtwert. Die
Anwesenheit an der Bildungseinrichtung kann im vorgegebenen Zeitrahmen in Absprache mit
der/dem Betreuer/in und in Anpassung an den Zeitrhythmus der Bildungseinrichtung flexibel
gehandhabt werden. Das Kennenlernen der Einrichtung mit allen ihren Abläufen ist dabei ebenso
Bestandteil der Präsenzzeit wie die konkrete forschende Tätigkeit.
1 Bundesarbeitsgemeinschaft Schulpraktischer Studien (BASS) (2013): Glossar der Bundesarbeitsgemeinschaft
Schulpraktische Studien. Begriffe in Kontext Schulpraktischer Studien /Schulpraktika, unveröffentlichtes Dokument,
Dezember 2013
4Handreichung Professionalisierungspraktikum (PP)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fehltage
Es sind nicht mehr als zwei entschuldigte Fehltage möglich. Der/die Studierende hat die
Bildungseinrichtung unmittelbar zu informieren. Darüber hinausgehende Fehlzeiten sind mit dem ZfS
abzuklären, beispielsweise können diese gegebenenfalls nachgearbeitet werden.
Ort
Die Studierenden suchen sich selbst eine Schule bzw. Bildungseinrichtung. Das
Professionalisierungspraktikum kann in Baden-Württemberg, im gesamten Bundesgebiet oder im
Ausland absolviert werden.
Bitte beachten: Schulen, die das Integrierte Semesterpraktikum (ISP) anbieten, stehen in der Regel
aus Kapazitätsgründen für das Professionalisierungspraktikum nicht zur Verfügung.
Anmeldung und Bestätigung
Für die Anmeldung wie für die Bestätigung gibt es Formulare. Bitte verwenden Sie hierfür nur die
Originale, diese werden in der entsprechenden Informationsveranstaltung verteilt oder können im
Schulpraxisbüro (KGII 218/219) abgeholt werden. Beide Formulare sind auch in Englisch und in
Französisch beim ZfS erhältlich.
Seminare zur Vorbereitung des Professionalisierungspraktikums
Einzelne Fächer bieten optional eine Betreuung der Vorbereitung auf das Professionalisierungs-
praktikum in Form eines Seminars an. Studierende finden hierzu Hinweise in den Seminartiteln des
Veranstaltungsangebots im Modul 3 (LSF). Die Schulpraxisbeauftragten der Fächer können hier
ebenfalls Auskunft geben, eine Übersicht der Ansprechpersonen befindet sich auf der Homepage
des ZfS.
Hinweis für Europalehramt-Studierende
Die schulpraktischen Studien umfassen für Studierende im Europalehramt auch die
Kompetenzbereiche des Bilingualen Lehrens und Lernens / kulturelle Diversität. Der Nachweis
des in der Regel mindestens acht Stunden umfassenden bilingualen Unterrichtens kann im
Integrierten Semesterpraktikum oder im Professionalisierungspraktikum erfolgen (vgl.
Studienordnung 2011, §9 (4)). Der Nachweis von bilingualem Unterrichten erfolgt durch die
aufnehmende Einrichtung. Hierfür ist das Formular des Europabüros (KG 4, 2. Stock) zu verwenden.
Grundsätzlich muss der Aspekt des bilingualen Unterrichts gewahrt sein, d.h. der Unterricht muss für
die Schüler/innen dergestalt sein, dass ein Sachfach in der Fremdsprache der Schüler/innen
unterrichtet wird. So wäre z.B. denkbar, dass die Studierenden in England ihr Sachfach auf Deutsch
unterrichten oder aber ihr Sachfach in Englisch unterrichten, an einer Schule, in der Englisch für die
Schüler/innen Fremdsprache ist.
5Handreichung Professionalisierungspraktikum (PP)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Ablauf & Vorgehen
Die Studierenden suchen sich für ihr Praktikumsvorhaben selbst eine betreuende Dozentin/einen
betreuenden Dozenten. Vor Beginn des Professionalisierungspraktikums stellen die Dozierenden der
Pädagogischen Hochschule Freiburg in einer oder mehreren Beratungssitzungen sicher, dass die/der
Studierende mit einer fundierten Fragestellung in das Praktikum geht, welche sie/er methodisch sinnvoll
verfolgt und entsprechend den Rahmenbedingungen realistisch geplant hat. Diese Fragestellungen
können beispielsweise fachbezogene oder didaktische Relevanz haben oder auch auf den eigenen
Kompetenzerwerb bezogen sein.
Übersicht zum Vorgehen
Schritt 1: Die/der Studierende erstellt ein Exposé unter Verwendung der Vorlage des ZfS (siehe
Anhang 9.2). Es enthält die Fragestellung, eine begründete Herleitung der Fragestellung, das
geplante Vorgehen und eine Skizzierung der erhofften Erkenntnisse. Diese Überlegungen sind mit
Bezug auf relevante Literatur zu erstellen.
Schritt 2: Die/der Studierende sucht sich eine Hochschuldozentin/einen Hochschuldozenten,
die/der das Exposé bespricht und das Vorhaben unterschriftlich auf dem Anmeldeformular
bestätigt. Nach der Ausarbeitung des Exposés wird die Unterschrift auf dem Anmeldeformular
erteilt. Empfehlung: Es wird empfohlen, bereits im Vorfeld ein abschließendes Gespräch zur
Vorstellung der Ergebnisse im Anschluss an das Praktikum zu vereinbaren.
Schritt 3: Die/der Studierende sucht sich eine Schule oder andere geeignete Bildungseinrichtung,
in der sie/er ihrer/seiner Fragestellung nachgehen kann. Die Bildungseinrichtung wird vom
Studierenden kontaktiert und über die geplante Fragestellung bzw. über das Vorgehen gemäß
Exposé informiert. Durch die Unterschrift auf dem Anmeldeformular bestätigt die
Bildungseinrichtung ihre Bereitschaft, der/dem Studierende/n das Professionalisierungspraktikum
zu ermöglichen.
Schritt 4: Die/der Studierende reicht das (von Schule und Bildungseinrichtung) unterzeichnete
Anmeldeformular spätestens 3 Wochen vor Praktikumsbeginn im ZfS (KG II Raum 218 oder
219) ein.
Schritt 5: Nach Abschluss des Praktikums bestätigt die/der Betreuer/in sowie die
Einrichtungsleitung der/dem Studierenden auf dem Praktikumsbestätigungs-Formblatt, ob das
Praktikum bestanden wurde. Dabei kann sich die Einrichtung an den auf dem Formblatt zu
findenden Kriterien orientieren. Soweit vereinbart, findet eine Nachbesprechung zwischen
der/dem Studierenden mit der/dem Dozierenden zu den Ergebnissen und zu den gewonnen
Einsichten statt. (Die/der Dozent/in hat ausschließlich beratende und keine bewertende Funktion)
Schritt 6: Die/der Studierende reicht die unterzeichnete Praktikumsbestätigung im ZfS ein.
6Handreichung Professionalisierungspraktikum (PP)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Aufgaben & Zuständigkeiten
Für ein gelingendes Praktikum ist es wichtig, dass alle Beteiligten ihre Aufgaben und Zuständigkeiten
kennen sowie die der anderen Beteiligten. Die Selbständigkeit der Studierenden steht in dieser
Praktikumsform im Vordergrund. Sie übernehmen die gesamte Planung und Koordination des
Vorhabens, so dass ihnen auch eine besondere kommunikativ-vermittelnde Rolle zukommt. Die
Studierenden holen aktiv alle notwendigen Informationen ein und versorgen eigenständig alle
Beteiligten mit den erforderlichen Informationen.
a) Aufgaben der/des Studierenden
Die/der Studierende …
- überlegt sich vorher eine oder mehrere mögliche Fragestellungen. Ideen hierzu können aus
Seminaren, Vorlesungen oder aus den vorherigen Praktika kommen. Auch der eigene
Kompetenzaufbau bezogen auf Aspekte des Lehrens und Lernens kann zum Projekt im
Professionalisierungspraktikum werden. Erste Überlegungen zu einer möglichen Form der
Datenerhebung und einer geeigneten Bildungseinrichtung werden schriftlich festgehalten und in
Entwurfsform für die/den Dozent/in vorbereitet.
- bereitet sich (schriftlich) auf das Erstgespräch mit der/dem Dozent/in unter besonderer
Berücksichtigung der Umsetzung des Exposés vor.
- entwickelt auf der Basis des Erstgesprächs das Exposé weiter.
- kontaktiert mögliche geeignete Bildungseinrichtungen.
- klärt mit den relevanten Personen in der aufnehmenden Bildungseinrichtung gegenseitige
Erwartungen an die Zusammenarbeit, den Ablauf und die Ergebnisse des
Professionalisierungspraktikums.
- besorgt sich erforderliche Informationen, Materialien und Literatur zur eigenen Fragestellung
eigenständig und bearbeitet diese.
- führt alle mit dem Exposé in Verbindung stehenden und mit der Bildungseinrichtung
abgesprochenen Praktikumstätigkeiten aktiv durch.
- ist zum regelmäßigen Erscheinen verpflichtet.
- plant eigenverantwortlich Zeiten zum Selbststudium ein (Beantwortung der Fragestellung
gemäß Exposé und Führen des Portfolios).
- dokumentiert das Professionalisierungspraktikum und die dadurch gewonnen Erfahrungen und
Erkenntnisse in dem Portfolio, das u.a. das Exposé und ihre/seine Praktikumsvereinbarungen,
insbesondere zur Ergebnisaufbereitung sowie ihre/seine Reflexionen hierüber beinhaltet.
Nähere Informationen zum Portfolio unter Punkt 6.
- meldet sich bei Krankheit unverzüglich in der Bildungseinrichtung und bei Krankheit über zwei
Tage hinaus im ZfS.
b) Aufgaben der/des Hochschuldozenten/in
Die Hochschuldozentin/der Hochschuldozent …
- bespricht mit der/dem Studierenden das Exposé.
7Handreichung Professionalisierungspraktikum (PP)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- achtet darauf, dass ethische Richtlinien bei dem Vorhaben eingehalten werden und weist
gegebenenfalls darauf hin, wenn besondere Datenschutzregelungen von Bedeutung sein
können.
- bestätigt die sinnvolle Planung des Vorhabens unterschriftlich auf dem Anmeldeformular
nachdem das Exposé vollständig ausgearbeitet wurde.
- vereinbart mit der/dem Studierenden die Anforderungen an die Dokumentations- und
Reflexionsleistungen im Portfolio.
- vereinbart gegebenenfalls mit der/dem Studierenden im Anschluss an das Praktikum einen
abschließenden Gesprächstermin zur kurzen Vorstellung der Ergebnisse.
Es wird außerdem empfohlen, auch dahingehend zu beraten, dass
- die Möglichkeit besteht, die Thematik in der Wissenschaftlichen Arbeit weiterzuführen.
Beispielsweise können Erkenntnisse als Vorüberlegungen für die wissenschaftliche Arbeit dienen
oder Ergebnisse im Sinne einer Vorstudie einbezogen werden;
- für eine effiziente Gestaltung des Professionalisierungspraktikums die Auswahl einer
geeigneten Praktikumseinrichtung eine wichtige Rolle spielt. Es ist sinnvoll, die Passung des
Vorhabens mit der konkret vom Studierenden ausgewählten Bildungseinrichtung zu
thematisieren.
c) Aufgaben der aufnehmenden Schule oder Bildungseinrichtung
Die Begleitung, Betreuung und Stellungnahme der betreuenden Person erstreckt sich vor allem auf
folgende Bereiche:
Die/der Betreuer/in…
- klärt gegenseitige Erwartungen in einem Erstgespräch.
- stellt die Einrichtung (z.B. Kollegium, Räumlichkeiten, Profil der Einrichtung) vor.
- klärt über rechtliche Grundlagen, wie die Verschwiegenheitspflicht und die Weisungsbefugnis
der Bildungseinrichtung, die sich aus dem Praktikanten/innen-Status ergeben, auf.
- legt ergänzend zum Exposé die Zielsetzungen für das Praktikum fest.
- plant und trifft Vereinbarungen zum Praktikumsablauf und den Praktikumstätigkeiten,
1. die sich aus der Fragestellung der/des Studierenden bzw. den Ausführungen im Exposé
ergeben,
2. die darüber hinaus das Praktikum in der Bildungseinrichtung betreffen.
- unterstützt die/den Studierenden bei ihrem/seinem (empirischen) Vorhaben bzw. bei
ihrer/seiner Kompetenzentwicklung.
- gibt Rückmeldung zur Durchführung der vereinbarten Praktikumstätigkeiten.
- füllt die Bestätigung der erfolgreichen („mit Erfolg“) bzw. nicht erfolgreichen („ohne Erfolg“)
Absolvierung des Praktikums in Absprache mit der Leitung der Einrichtung aus (Empfehlung
eines Abschlussgesprächs). Im Falle eines Nichtbestehens ist eine Ausführung der Gründe in Form
eines Gutachtens notwendig.
Allgemeiner Hinweis:
Sollten im Verlauf des Praktikums Unklarheiten oder Schwierigkeiten auftreten, können sich alle
Beteiligten selbstverständlich an das Zentrum für Schulpraktische Studien (ZfS) wenden. Gerne nehmen
wir auch positive Rückmeldungen, Anregungen und Vorschläge zum Praktikum entgegen.
8Handreichung Professionalisierungspraktikum (PP)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Bestehen und Nichtbestehen des Praktikums
Voraussetzungen für die erfolgreiche Teilnahme am Professionalisierungspraktikum sind gemäß der
Akad. Prüfungsordnung 2012 (§12, Abs. 5) „die vollständige Wahrnehmung der mit der Schule
vereinbarten Praktikumstätigkeiten, ein professionellen Standards entsprechendes Agieren im
pädagogischen Berufsfeld sowie die Fähigkeit und Bereitschaft zum forschenden Lernen. Ein Nachweis
hierzu wird von der Leitung jener Bildungseinrichtung ausgestellt, an der das Professionalisierungs-
praktikum absolviert wurde (…)“
Die drei Aspekte für eine erfolgreiche Teilnahme am Professionalisierungspraktikum werden im
Folgenden kurz erläutert:
1. Eine vollständige Wahrnehmung der mit der Bildungseinrichtung vereinbarten Praktikumstätigkeiten
zeigt sich beispielsweise in Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Sorgfalt bezüglich der vereinbarten
Aufgaben.
2. Die Standards zum professionellen Agieren im pädagogischen Berufsfeld werden von der
Bildungseinrichtung festgelegt und der/dem Studierenden im Zweifel frühzeitig transparent gemacht.
3. Die Fähigkeit und Bereitschaft zum forschenden Lernen wird durch die/den Dozent/in mit der
unterschriftlichen Bestätigung des Exposés bestätigt.
Ein Formblatt (Praktikumsbestätigung) wird von der/dem Studierenden im ZfS abgeholt und der
Bildungseinrichtung mitgebracht. Die Bildungseinrichtung gibt Auskunft über den geleisteten zeitlichen
Umfang des Praktikums, ob es mit oder ohne Erfolg durchgeführt wurde und bestätigt dies
unterschriftlich (Betreuer/in und Leitung der Bildungseinrichtung). Im Falle eines Nichtbestehens ist eine
Ausführung der Gründe in Form eines Gutachtens notwendig. Dieses Gutachten bitte direkt und im
Original an:
Zentrum für Schulpraktischen Studien (ZfS)
Pädagogische Hochschule Freiburg
Kunzenweg 21
79117 Freiburg
5. Datenschutz und ethische Richtlinien
Für jegliche forschende Tätigkeit bedürfen die Erhebung und der Umgang mit den systematisch
gewonnenen Daten einer sorgfältigen und verantwortungsbewussten Haltung. Hierzu sind insbesondere
ethische Richtlinien und Maßnahmen zum Datenschutz einzuhalten.
Bei der Datenerhebung im Rahmen des Professionalisierungspraktikums ist besonders darauf zu achten,
dass gegebenenfalls das Regierungspräsidium, die Bildungseinrichtung und die Erziehungsberechtigten
der Befragten sowie diese selbst mit der Erhebung einverstanden sind.
Die/der forschende Person hat die Standards wissenschaftlichen Arbeitens bestmöglich einzuhalten und
für inhaltliche und methodische Transparenz zu sorgen. Es gelten die Richtlinien der Pädagogischen
Hochschule Freiburg zur Selbstkontrolle in der Wissenschaft (https://www.ph-freiburg.de/forschung-
nachwuchs/forschungsfoerderung/sicherung-guter-wissenschaftlicher-praxis.html).
Weitere Richtlinien werden von der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE)
(http://www.dgfe.de/fileadmin/OrdnerRedakteure/Service/Satzung/Ethikkodex_2010.pdf) und der
Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGPs) (http://www.dgps.de/index.php?id=96422) zur
Verfügung gestellt. Ergänzend liegt ein Entwurf einer Stellungnahme zur Anonymisierung von Daten in
der qualitativen Forschung von der DGfE vor
(http://www.dgfe.de/fileadmin/OrdnerRedakteure/Stellungnahmen/2005_Anonymisierung_von_Date
n.pdf).
Besprechen Sie die für Sie relevanten Maßnahmen und Überlegungen mit der/dem begleitenden
Dozent/in bzw. mit der Bildungseinrichtung.
9Handreichung Professionalisierungspraktikum (PP)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Das Portfolio im Professionalisierungspraktikum
Das Portfolio wird von der/dem Studierenden geführt. Ziel ist es, dass die/der Studierende die
Entwicklung ihrer/seiner Fähigkeiten im Verlauf des Praktikums zunehmend realistischer einschätzen und
(Weiter-) Entwicklungsbedarf benennen und planen kann. Der Weg dorthin führt über die gezielte und
konkrete Reflexion.
Im dritten und letzten Praktikumsblock der Schulpraktischen Studien verfügen die Studierenden über
zahlreiche Kompetenzen unterschiedlicher Bereiche, sowohl der Fachdidaktik, als auch der planerischen
und gestalterischen Kompetenzbereiche. Sie haben sich umfangreiches Fachwissen angeeignet und ihre
Sozial- und Selbstkompetenzen ausgebaut. Sie sind geübter darin, gezielt und strukturiert sich selbst zu
reflektieren oder auch andere zu beobachten und Feedback zu geben. Schließlich haben sie einige
Fähigkeiten zum Forschenden Lernen erworben, denen im Professionalisierungspraktikum besondere
Aufmerksamkeit zukommt. Das wichtigste Dokument für das Portfolio im Professionalisierungspraktikum
ist daher das Exposé. Darüber hinaus sollten die Ergebnisse und auch relevante Dokumentationen des
Forschungs- bzw. Entwicklungsprozesses Bestandteil des Portfolios sein, welche rückblickend einer
kritischen Reflexion nach inhaltlich-theoretischen sowie methodischen Gesichtspunkten unterzogen
werden sollten.
Folgende Reflexionsfragen lenken die Aufmerksamkeit bei der Reflexion auf den Kompetenzbereich
des Forschenden Lernens. Die Studierenden wählen fünf oder mehr Fragen als Grundlage ihrer
schriftlichen Reflexion aus.
1. Habe ich meine Fragestellung so gewählt, dass ich Sie beantworten konnte? Wenn nein, worin
sehe ich den Grund/die Gründe dafür?
2. Konnte ich mein geplantes methodisches Vorgehen umsetzen, so wie ich es geplant habe? Wenn
nein, worin sehe ich hierfür den Grund/die Gründe?
3. In welchem Bezug stehen die vorgefundenen Rahmenbedingungen der Bildungseinrichtung zur
Durchführung meines Vorhabens? Sehe ich darin Stolpersteine oder förderliche Ressourcen?
4. Welche Personen haben in welcher Weise mein Forschungsvorhaben beeinflusst?
5. Was würde ich beim nächsten Mal anders machen?
6. Habe ich diese Ergebnisse erwartet?
7. Mit welchen weiteren Forschungsfragen sehe ich mich konfrontiert?
8. Hat sich meine Haltung zum Forschenden Lernen verändert? Hat mich etwas überrascht?
9. Gibt es etwas Bestimmtes, das ich durch diesen Prozess neu gelernt habe?
Selbstverständlich kann ergänzend jeder andere Kompetenzbereich auch zum Gegenstand der
Reflexion des Professionalisierungspraktikums gemacht werden.
Das Portfolio umfasst daher folgende Dokumente und Reflexionstexte:
- Das Exposé
- Die aufbereiteten Ergebnisse
- Die schriftliche Reflexion zu fünf oder mehr Reflexionsfragen
- Zusätzlich/freiwillig: Alle relevanten Aufzeichnungen, die im Verlauf des Praktikums entstanden
sind
- Ggfs. Rückmeldungen der/des Betreuenden bzw. des Dozenten /der Dozentin
In Absprache mit der/dem Dozierenden werden die Inhalte spezifisch für das Vorhaben vereinbart.
Das Portfolio muss nicht formal eingereicht werden. Die Dokumentations- und Reflexionsleistung ist
jedoch der Bildungseinrichtung und der/dem Dozierenden darzulegen. Die Form der Darlegung kann
individuell festgelegt werden, beispielsweise kann das gesamte Portfolio vorgelegt oder die
Erkenntnisse bzw. Reflexionsergebnisse in anderer Weise (zum Beispiel als Poster mit Vortrag)
präsentiert werden.
10Handreichung Professionalisierungspraktikum (PP)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Abschließende Hinweise
Diese "Begleitinformation und Handreichung" für das Professionalisierungspraktikum ist als Arbeits- und
Planungshilfe zu verstehen - und zwar in dem Sinne, dass es eine tragfähige Verständnis- und
Arbeitsbasis für die beteiligten Personen bereitstellt. Es ist selbstverständlich, dass die an der Planung
und am Praktikum Beteiligten durchaus mit unterschiedlichen Erfahrungen und Erwartungen an die Praxis
herangehen. Wenn diese angesprochen und aufeinander abgestimmt werden, ist die Grundlage für
einen sinnvollen Verlauf des Praktikums für alle Mitwirkenden gegeben.
11Handreichung Professionalisierungspraktikum (PP)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANHANG
12Handreichung Professionalisierungspraktikum (PP)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anhang 8.1 Das Exposé
Im Rahmen des Professionalisierungspraktikums werden in der Regel Vorhaben aus der Praxisforschung
realisiert. Das bedeutet, dass eine bestimmte Praxis beforscht wird, Daten werden in der Praxis
generiert bzw. erhoben. Hierfür gibt es zahlreiche Variationen, die Bandbreite kann hier nicht
abgebildet werden, es werden exemplarisch Erläuterungen im Exposé vorgenommen. Im Einzelfall
erfolgt die Planung in Absprache mit der/dem Dozierenden.
Es soll nochmals explizit darauf hingewiesen werden, dass nicht nur die Erhebung empirischer Daten,
sondern auch der eigene Kompetenzerwerb Thema Ihres Vorhabens sein kann. Wichtig ist, dass Sie
gleichwohl eine konkrete und beantwortbare Frage formulieren, die Sie methodengeleitet/systematisch
beantworten. Im Sinne der Erhebung werden dann beispielweise Beobachtungen oder Protokolle von
Feedbackgesprächen oder ähnliches herangezogen, die beispielsweise kriteriengeleitet ausgewertet
werden, mit dem Ziel, eine Entwicklung differenziert darlegen zu können. Die Darlegung der
Entwicklung kann für die Portfolioarbeit verwendet werden.
Das Exposé wird angefertigt, um Ihr Forschungsvorhaben herzuleiten, zu begründen und zu planen.
Für die Erstellung Ihres Exposés verwenden Sie die vom Zentrum für Schulpraktische Studien (ZfS)
bereitgestellte Vorlage. Diese kann auf der Webseite des ZfS heruntergeladen werden.
Das Exposé beinhaltet in dieser Vorlage sieben Punkte:
1. Offenlegung des Erkenntnisinteresses
Beschreiben Sie, welchen Aspekt Sie näher untersuchen möchten und welche nachvollziehbaren
Gründe dafür sprechen, sich diesem Aspekt zu nähern.
In der Regel beginnt die Suche nach einer Forschungsfrage, indem ein Themengebiet herausgesucht
und davon ein bestimmter Aspekt ausgewählt wird (z.B. Thema Lesekompetenz, Aspekt
Legasthenie). Bereits jetzt kann es sinnvoll sein, sich zunächst weiter zu informieren
(Literaturrecherche) bevor der Aspekt weiter eingegrenzt wird. Eine weitere Eingrenzung erfolgt
dann anhand der Bestimmung des Forschungsgegenstands (z.B. Häufigkeit von Legasthenie oder
Besonderheiten von Legasthenie in Bezug auf die Entwicklung von Lesekompetenz), der Zielgruppe
(z.B. Jungen im Alter von 6 bis 9 Jahren), des Orts (z.B. eine Grundschule, Baden-Württemberg)
und der Zeit (z.B. Gegenwart oder in der Entwicklung von 1960 bis 2010). Bezüglich dem eigenem
Kompetenzerwerb kann beispielsweise das Thema Methodenkompetenz lauten, ein eingrenzender
Aspekt kann wertschätzende Kommunikation sein. Weitere Eingrenzungsmerkmale könnten
spezifische (zum Beispiel belastende Situationen) sein oder wertschätzende Kommunikation mit
einer spezifischen Zielgruppe (z.B. mit Kindern mit besonderen Auffälligkeiten)
Wichtig: Auch wenn Ihre eigenen, subjektiven Eindrücke zum Interesse an dem
Forschungsgegenstand führen, objektivieren Sie dies, indem Sie die Wichtigkeit bzw. Relevanz der
Thematik unabhängig von Ihrer Person beschreiben (z.B. „Nach der Studie XY ist jede x-te Person
im Alter von 6 bis 9 Jahren von Legasthenie betroffen“ oder auch weniger empirisch zum Beispiel
„immer häufiger wird in den Medien von Legasthenie berichtet, wie beispielsweise im Artikel vom
10.10.2014 in der Zeitschrift ABC und dem Artikel… “) Bezüglich eigener Kompetenz könnten die
Relevanz wertschätzender Kommunikation oder zum Beispiel Folgen beim Ausbleiben dieser
thematisiert werden.
2. Fachlich / theoretische Begründung der Fragestellung
Erläutern Sie die fachliche /-theoretische Begründung der Fragestellung unter Einbezug
wissenschaftlich /-künstlerisch aussagekräftiger Quellen bzw. Theorien. Falls Sie Hypothesen testen
oder generieren wollen, erläutern Sie den Entstehungshintergrund Ihrer Überlegungen.
Eine Fragestellung dient dazu, eine Wissenslücke zu schließen. Sie ist nicht trivial. Es ist deshalb
erforderlich, die aktuelle Literatur sowie Standardwerke zum Thema zu kennen um begründen zu
können, welche Wissenslücke noch zu schließen wäre. Diese Wissenslücke kann zum Beispiel darin
zu finden sein,
13Handreichung Professionalisierungspraktikum (PP)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- eine allgemeine Theorie oder eine allgemeine Methode auf ein spezifisches Problemfeld
anzuwenden,
- oder verschiedene Methoden hinsichtlich Ihrer Praktikabilität zu vergleichen.
- Auch können ein Problemfeld oder Handlungsbedarf aufgedeckt werden.
- Eine bestimmte Praxis(-methode) kann vor dem Hintergrund einer Theorie bzw. anhand
definierter Kriterien in der Praxis überprüft werden. Usw.
Wenn Sie Hypothesen testen, ist es erforderlich, zu erklären, welche Annahmen zu dieser
Hypothese führen. Wenn Sie Hypothesen generieren möchten, ist der Entstehungshintergrund der
Überlegungen zu erklären: Nur durch die Transparenz der Annahmen können zum Beispiel
ungewollte Stigmatisierungen vermieden werden. Die Verwendung von Quellen ist empfehlenswert.
Die fachlich/theoretische Begründung der Fragestellung kann in fließendem Übergang zur Offenlegung
mit dem Erkenntnisinteresse stehen oder mit dieser gegebenenfalls zusammengefasst werden,
insbesondere bei weniger empirischen Fragestellungen.
3. Fragestellung
Nennen Sie Ihre Fragestellung(en) (und ggf. Ihre Hypothese/n).
Eine geeignete Fragestellung ist eindeutig und nicht trivial – sie erfüllt die sogenannten SMART-
Kriterien. Eine ‘smarte’ Fragestellung erfüllt folgende Anforderungen. Sie ist:
S spezifisch (seien Sie so genau wie möglich)
M messbar (bzw. sichtbar/erkennbar/beobachtbar: bezieht sich auf die Überprüfbarkeit)
A angemessen (bezogen auf den Forschungsgegenstand sowie auf Zeit und Raum)
R realistisch (vor dem Hintergrund aller Rahmenbedingungen)
T terminierbar (bedeutet auch: ein geplantes, methodisches Vorgehen innerhalb eines definierten
Zeitplans ist möglich)
4. Methodisches Vorgehen
Beschreiben Sie, in welchen Schritten Sie bei Ihrer Untersuchung systematisch vorgehen wollen bzw.
auf welche Forschungsmethode(n) Sie sich zur Beantwortung ihrer Fragestellung stützen. Geben Sie
an, welche Daten/Quellen Sie erheben und wie Sie bei der Auswertung vorgehen wollen. Dies
umfasst Angaben zur systematischen Erhebung und zur Auswertung von Daten (ggf. auch Angaben
zur Stichprobe/Sample, zum Feldzugang etc.).
Ihre Fragestellung prägt unmittelbar die Wahl der geeigneten Methode(n)!
Forschungsmethoden können quantitative oder qualitative Verfahren sein. Beispiele sind
experimentelle Methoden wie z.B. ein Laborexperiment (Manipulation von Variablen), nicht-
experimentelle Methoden wie z.B. Zusammenhangsstudien (Vergleich von Variablen), systematische
Beobachtung (mit oder ohne Videoaufzeichnung), Interviews (z.B. Experteninterviews,
problemzentrierte Interviews, Fokusgruppeninterviews) und viele mehr.
Oftmals gehen Erhebungsmethode und Auswertungsmethode miteinander einher. Beispielsweise
lässt eine Fragebogenerhebung (Zusammenhangsstudie, mit dem Ziel der Hypothesentestung)
wenig Spielraum für die Auswertungsmethode: diese erfolgt in der Regel computergestützt mit
einer Software (z.B. Excel, SPSS) und verwendet einen Test, der auf einer definierten Formel
basiert (z.B. zur Berechnung einer Korrelation oder eines Unterschieds). Qualitative Verfahren
legen teilweise eine bestimmte Auswertungsmethode nahe (z.B. werden Experteninterviews in der
Regel inhaltsanalytisch ausgewertet), während bei anderen Interviewformen in Abhängigkeit von
der Fragestellung eine Vielzahl an Auswertungsmöglichkeiten geeignet sein können (z.B. objektiv
hermeneutisch).
Wichtigstes Merkmal bei der Beschreibung des methodischen Vorgehens ist die Veranschaulichung
der Systematik (versus Willkür). Gerade dann, wenn Sie keine rein empirische Fragestellung
verfolgen, bei der Sie die Methode klar benennen können, ist es umso wichtiger, das systematische
Vorgehen explizit darzulegen. Dies dient der Wissenschaftlichkeit, da nur so Ihr Vorgehen und
damit auch Ihre Ergebnisse personenunabhängig nachvollziehbar sein können.
Beim eigenen Kompetenzerwerb bedeutet dies, Schlüsselsituationen zu benennen und zu planen,
durch welche Verhaltensweisen die Kompetenz als „umgesetzt“ gesehen werden kann und woran
14Handreichung Professionalisierungspraktikum (PP)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
dies erkennbar wird. Merkmale einer „gelungenen Umsetzung der Kompetenz“ werden
nachvollziehbar operationalisiert. Hierzu ist in der Regel der Rückgriff auf Literatur zur jeweiligen
Kompetenz unerlässlich. (z.B. worin/durch welches Verhalten wird eine wertschätzende
Kommunikation erkennbar/messbar/sichtbar?)
5. Ihre konkrete Umsetzungsplanung (inklusive Zeitplan)
Erläutern Sie Ihre konkreten Schritte insbesondere unter Angabe der erforderlichen Mittel (zum
Beispiel Zugang zu bestimmten Materialien oder Zielgruppen) und zur zeitlichen Abfolge.
Während das methodische Vorgehen die Systematik logisch-abstrakt darlegt, geht es nun um die
konkrete, schrittweise Umsetzung unter Einbezug der Gegebenheiten. Hier werden die einzelnen
Handlungen geplant und dabei bedacht, welche vorbereitenden Maßnahmen notwendig sind. Ein
besonderer Verweis gilt hier der Beachtung von Datenschutz und ethischen Richtlinien (siehe auch
Seite 9).
6. Ergebniskommunikation und Reflexion
Geben Sie an, wie Sie Ihre Ergebnisse aufbereiten und ggf. der Bildungseinrichtung bzw. der/dem
Dozent/in vorstellen. Beschreiben Sie abschließend kurz, wie Sie Ihr forschendes Vorgehen und
Ihren Lernzuwachs in dieser Hinsicht reflektieren werden.
Je nach Fragestellung und Zielsetzung sehen die Ergebnisse Ihrer Arbeit unterschiedlich aus. Es
können statistische Aussagen in Abbildungen und Grafiken dargestellt werden, Ergebnisse können
auch als Poster dokumentiert oder als Fließtext festgehalten werden usw. Besprechen Sie mit
der/dem Dozent/in und wahlweise mit Ihrer Ansprechperson in der Bildungseinrichtung, welche
Möglichkeiten zur Ergebnisdarstellung es gibt.
Unabhängig von dem Medium der Darstellung der Ergebnisse ist ein wissenschaftlich wichtiger
Schritt, die Ergebnisse vor dem Hintergrund des gesamten Vorgehens, also des methodischen
Vorgehens, zu reflektieren. Diese Reflexion sollte Bestandteil Ihres Portfolios (siehe auch Seite 10)
sein.
7. Literaturangaben
Bibliografieren Sie hier Ihre verwendeten Quellen.
Wissenschaftliches Arbeiten zeichnet sich durch Nachvollziehbarkeit aus. Damit die Quellen Ihrer
Überlegungen, Prämissen und/oder Schlussfolgerungen transparent sind, bibliografieren Sie diese
lückenlos. Entsprechende Verweise gemäß Zitierregeln sind an den jeweiligen Textpassagen im
Exposé vorzunehmen
15Sie können auch lesen