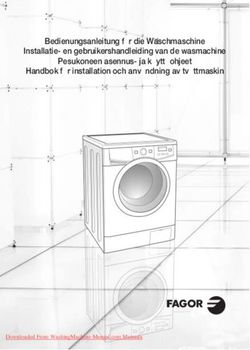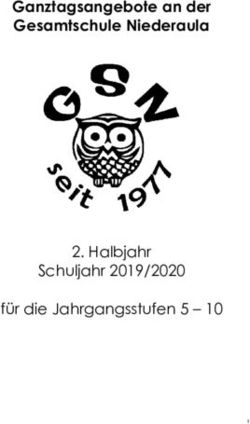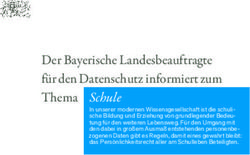Schulinterner Lehrplan - Sekundarstufe I CHEMIE (KLASSE 7) - am Gymnasium Antonianum
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
LEHRPLAN Sekundarstufe I Schulinterner Lehrplan für das Fach CHEMIE (KLASSE 7) Gymnasium Antonianum Wichburgastraße 1 59590 Geseke Stand: 06.08.2020
Schulinternes Curriculum Sek I Chemie Stand 06.08.2020 Inhalt 1. Chemie am Gymnasium Antonianum ________________________________________________ 3 1.1 Personalia _______________________________________________________________________ 3 1.2 Fachangebot _____________________________________________________________________ 3 2. Entscheidungen zum Unterricht _____________________________________________________ 3 2.1 Der Beitrag des Faches Chemie zur naturwissenschaftlichen Grundbildung ________________ 3 2.2 Lernorganisation _________________________________________________________________ 3 2.3 Lehr- und Lernmittel ______________________________________________________________ 4 2.4 Übersicht über die Unterrichtsvorhaben ______________________________________________ 5 3. Grundsätze der Leistungsmessung und -bewertung ___________________________________ 19 Seite 2 von 19
Schulinternes Curriculum Sek I Chemie Stand 06.08.2020 1. Chemie am Gymnasium Antonianum 1.1 Personalia Im Schuljahr 2020/21 unterrichten folgende Kolleginnen und Kollegen das Fach Chemie: Herr Picht, Frau Dr. Rikus, Frau Schäfers, Frau Schulte, Frau Wieners und Frau Bajric (Referendarin). 1.2 Fachangebot Der Chemieunterricht im neunjährigen Bildungsgang (G9) findet laut Stundentafel in folgenden Jahrgangsstufen statt: Jahrgangsstufe 7 2 Wochenstunden Jahrgangsstufe 8 2 Wochenstunden epochal Jahrgangsstufe 9 3 Wochenstunden Jahrgangsstufe 10 2 Wochenstunden epochal In Zusammenarbeit und Absprache mit der Fachschaft Biologie besteht im WPII (Klasse 9 und 10) ein dreistündiger Kurs „Biologie-Chemie“, dessen Organisation und Inhalte in Jahrgang 9 von der Fachschaft Biologie und in Jahrgang 10 von der Fachschaft Chemie verantwortet wird. 2. Entscheidungen zum Unterricht 2.1 Der Beitrag des Faches Chemie zur naturwissenschaftlichen Grundbildung Als Fach des MINT-Bereiches unterstützt die Fachkonferenz Chemie aktiv das MINT-Konzept des Antonianums. Das betrifft z.B. die Einbindung des MINT-Labors und die ausdrückliche Ermunterung und Unterstützung der Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme an Wettbewerben wie z.B. Dechemax oder Jugend forscht. 2.2 Lernorganisation – fachmethodische und fachdidaktische Grundsätze Auch in der SI gelten die In Absprache mit der Lehrerkonferenz sowie unter Berücksichtigung des Schulprogramms die folgenden, von der Fachkonferenz Chemie für die SII beschlossenen, fachmethodischen und fachdidaktischen Grundsätze. In diesem Zusammenhang beziehen sich die Grundsätze 1 bis 14 auf fächerübergreifende Aspekte, die auch Gegenstand der Qualitätsanalyse sind, die Grundsätze 15 bis 27 sind fachspezifisch angelegt. Überfachliche Grundsätze: 1.) Geeignete Problemstellungen zeichnen die Ziele des Unterrichts vor und bestimmen die Struktur der Lernprozesse. 2.) Inhalt und Anforderungsniveau des Unterrichts entsprechen dem Leistungsvermögen der Schülerinnen und Schüler. 3.) Die Unterrichtsgestaltung ist auf die Ziele und Inhalte abgestimmt. 4.) Medien und Arbeitsmittel sind lernernah gewählt. 5.) Die Schülerinnen und Schüler erreichen einen Lernzuwachs. 6.) Der Unterricht fördert und fordert eine aktive Teilnahme der Lernenden. Seite 3 von 19
Schulinternes Curriculum Sek I Chemie Stand 06.08.2020 7.) Der Unterricht fördert die Zusammenarbeit zwischen den Lernenden und bietet ihnen Möglichkeiten zu eigenen Lösungen. 8.) Der Unterricht berücksichtigt die individuellen Lernwege der einzelnen Schülerinnen und Schüler. 9.) Die Lernenden erhalten Gelegenheit zu selbstständiger Arbeit und werden dabei unterstützt. 10.) Der Unterricht fördert strukturierte und funktionale Einzel-, Partner- bzw. Gruppenarbeit sowie Arbeit in kooperativen Lernformen. 11.) Der Unterricht fördert strukturierte und funktionale Arbeit im Plenum. 12.) Die Lernumgebung ist vorbereitet; der Ordnungsrahmen wird eingehalten. 13.) Die Lehr- und Lernzeit wird intensiv für Unterrichtszwecke genutzt. 14.) Es herrscht ein positives pädagogisches Klima im Unterricht. Fachliche Grundsätze: 15.) Der Chemieunterricht ist problemorientiert und an Unterrichtsvorhaben und Kontexten ausgerichtet. 16.) Der Chemieunterricht ist kognitiv aktivierend und verständnisfördernd. 17.) Der Chemieunterricht unterstützt durch seine experimentelle Ausrichtung Lernprozesse bei Schülerinnen und Schülern. 18.) Im Chemieunterricht wird durch Einsatz von Schülerexperimenten Umwelt- und Verantwortungsbewusstsein gefördert und eine aktive Sicherheits- und Umwelterziehung erreicht. 19.) Der Chemieunterricht ist kumulativ, d.h., er knüpft an die Vorerfahrungen und das Vorwissen der Lernenden an und ermöglicht den Erwerb von Kompetenzen. 20.) Der Chemieunterricht fördert vernetzendes Denken und zeigt dazu eine über die verschiedenen Organisationsebenen bestehende Vernetzung von chemischen Konzepten und Prinzipien mithilfe von Basiskonzepten auf. 21.) Der Chemieunterricht folgt dem Prinzip der Exemplarizität und gibt den Lernenden die Gelegenheit, Strukturen und Gesetzmäßigkeiten möglichst anschaulich in den ausgewählten Problemen zu erkennen. 22.) Der Chemieunterricht bietet nach Erarbeitungsphasen immer auch Phasen der Metakognition, in denen zentrale Aspekte von zu erlernenden Kompetenzen reflektiert werden. 23.) Im Chemieunterricht wird auf eine angemessene Fachsprache geachtet. Schülerinnen und Schüler werden zu regelmäßiger, sorgfältiger und selbstständiger Dokumentation der erarbeiteten Unterrichtsinhalte angehalten. 24.) Der Chemieunterricht ist in seinen Anforderungen und im Hinblick auf die zu erreichenden Kompetenzen und deren Teilziele für die Schülerinnen und Schüler transparent. 25.) Im Chemieunterricht werden Diagnoseinstrumente zur Feststellung des jeweiligen Kompetenzstandes der Schülerinnen und Schüler durch die Lehrkraft, aber auch durch den Lernenden selbst eingesetzt. 26.) Der Chemieunterricht bietet immer wieder auch Phasen der Übung und des Transfers auf neue Aufgaben und Problemstellungen. Der Chemieunterricht bietet die Gelegenheit zum regelmäßigen wiederholenden Üben sowie zu selbstständigem Aufarbeiten von Unterrichtsinhalten. Hausaufgaben werden im vom Hausaufgabenkonzept festgelegten Rahmen erteilt. Unter Beachtung der Sicherheitsbestimmungen sind dabei grundsätzlich auch zu Hause durchzuführende Schülerexperimente möglich. Möglichkeiten zur individuellen Förderung/ Forderung werden berücksichtigt. 2.3 Lehr- und Lernmittel Mit Beschluss der Fachkonferenz vom 26.04.2020 wird das unten angegebene Lehrwerk “Chemie Heute” für den G9- Jahrgang beginnend mit Band 1 für Klasse 7 neu eingeführt. Chemie Heute – Aktuelle Ausgabe für das G9 in Nordrhein-Westfalen. Verlag Westermann (ISBN: 978-3-14- 151310-3). Band 1 Seite 4 von 19
Schulinternes Curriculum Sek I Chemie Stand 06.08.2020 2.4 Übersicht über die Unterrichtsvorhaben Klasse 7 Unterrichtsvorhaben 0 Unterrichtsvorhaben 1 Sicheres Experimentieren im Chemieunterricht Stoffe und Stoffeigenschaften (ca. 4 Stunden) (ca. 18 Stunden) (entweder als einzelnes Unterrichtsvorhaben oder in Zusammenhang mit Unterrichtsvorhaben 1 Unterrichtsvorhaben 2 Unterrichtsvorhaben 3 Chemische Reaktion Verbrennung - Brände und Brennbarkeit (ca. 14 Stunden) (ca. 20 Stunden) Unterrichtsvorhaben 4 Metalle und Metallgewinnung (ca. 14 Stunden) Klasse 8 Unterrichtsvorhaben 5 Elementfamilien schaffen Ordnung (ca. 30 Stunden) Seite 5 von 19
Schulinternes Curriculum Sek I Chemie Stand 01.06.2020 Jahrgangsstufe 7 Unterrichtsvorhaben 0 – Sicheres Experimentieren im Chemieunterricht (ca. 4 Stunden) Inhaltliche Schwerpunkte Mögliche Kontexte und und Schlüsselbegriffe Kompetenzbezug Methoden und Standardexperimente Anregungen für die Arbeit Optional: Was versteht man (auch historisch) unter der Naturwissenschaft Chemie? Laborführerschein Die Schülerinnen und Schüler können... Stationenlernen „Laborführerschein“ in (sicheres Experimentieren, Schülerversuchen mit integrierter Einstieg ins Thema durch naturwissenschaftliches ● Verhaltensweisen und Sicherheitsbestimmungen im Sicherheitsbelehrung Comic: „Heute haben wir den Arbeiten, Kennenlernen von Chemieraum erläutern. Unterschied zwischen Wasser Laborgeräten, Umgang mit dem ● Gefahrensymbole benennen und erklären. ● AB1 – Verhaltensweisen und Wasserstoff ● eine Auswahl wichtiger Laborgeräte (u.a. ● AB2 – Gefahrensymbole Gasbrenner) kennengelernt!“ Messzylinder, Waage, Pipette, Thermometer) ● AB3 – Laborgeräte erkennen benennen und (einige davon) korrekt anwenden. ● AB4 – Der Umgang mit dem Gasbrenner ● einen Gasbrenner den Sicherheitsrichtlinien Alternativ: Abb. in Chemie ● AB5 – Benutzung eines Peleusballs entsprechend verwenden (An- und Ausstellen, ● AB6 – Die Messung der Einheit Volumen heute SI, Westermann, S. 10 Flammenarten, Erhitzen von Feststoffen und Flüssigkeiten). Sensibilisierung für ein sicheres Nach Durchlaufen aller Stationen: Schriftliche Prüfung zum Arbeiten im Chemieunterricht (diese Kompetenzen sind frei erfunden und nicht im Laborführerschein KLP zu finden!) Aushändigung der Urkunde „Laborführerschein“ Seite 6 von 19
Schulinternes Curriculum Sek I Chemie Stand 01.06.2020 Unterrichtsvorhaben 1 – Stoffe und Stoffeigenschaften (ca. 18 Stunden) Mögliche Kontexte und Inhaltliche Schwerpunkte Kompetenzbezug Methoden und Standardexperimente Anregungen für die Arbeit Messbare und nicht-messbare Die Schülerinnen und Schüler können... Erarbeitung verschiedener Stoffeigenschaften Kontext: Detektive im Labor Stoffeigenschaften (Experimente und Informationsrecherche) ● Reinstoffe aufgrund charakteristischer mithilfe eines Lernzirkels Problemorientierter Einstieg: Eigenschaften (Schmelztemperatur / 1. Löslichkeit in Wasser Laborglas ohne Etikett mit einer Siedetemperatur, Dichte, Löslichkeit) 2. Elektrische Leitfähigkeit farblosen Flüssigkeit (z. B. Wasser, identifizieren (UF1, UF2). 3. Siedetemperatur Zucker-Lsg., Alkohol) – ● eine geeignete messbare Stoffeigenschaft experimentell ermitteln 4. Dichte Ideensammlung von Verfahren, um (E4, E5, K1). 5. (...ggf. weitere sinnvolle Stoffeigenschaften) herauszufinden, welcher Stoff in Im Zusammenhang mit der Untersuchung der dem Laborglas ist. Stoffeigenschaften bestehen vielfältige Möglich- keiten der individuellen Förderung/Forderung Hinweise zum Lernzirkel: ● Regeln zum sicheren Umgang Lernaufgabe: Selbstständiges Identifizieren eines mit Chemikalien und Geräten, Stoffes (z. B. Wasser, Zucker (Glycerin, Glycol), die für die jeweiligen Stationen Alkohol (Ethanol, Propanol)) mithilfe eines relevant sind, sind in Inhaltsfeld Lernzirkels (alternativ: Lerninteraktionsbox) 0 erfolgt oder erfolgen an den ● Einführung des Protokollschemas als entsprechenden Stationen. Lückentext an den verschiedenen Stationen. ● Brennerführerschein hier Hilfekarten zur Benennung der verwendeten möglich Laborgeräte. ● Die Experimente sollten alle Schulinternes Methodencurriculum: angeleitet sein. ● Identifikation der Stoffe mithilfe 4.5 Protokollieren von Experimenten von Stoffsteckbriefen (Informationsentnahme) Seite 7 von 19
Schulinternes Curriculum Sek I Chemie Stand 01.06.2020 Einfache Teilchenvorstellung Die Schülerinnen und Schüler können... Erklärung von Aggregatzustandsänderungen auf Teilchenebene ● Aggregatzustände und deren Frage: „Was passiert mit dem Salz, Änderungen auf der Grundlage eines L-Demo: Lösen von z.B. NaCl und anschließend wenn man es ins Wasser gibt?“ einfachen Teilchenmodells erklären (E6, KMnO4 in Wasser im hohen Standzylinder K3). Alternativ: Praktikum in Chemie heute SI, Westermann, S. 46 Erweiterung des Erklärungsmodells Einführung eines Teilchenmodells der kleinen Teilchen und eigene Vorstellung der kleinen Teilchen Anwendung auf die 3 bekannten visualisieren und mit denen der Mitschüler Aggregatzustände vergleichen AB – Wasser und Salz als kleinste Teilchen SuS-Versuch – Erhitzen von Eis im RG mit Info: Abb. in Chemie heute SI, übergezogenem Luftballon Westermann, S. 45 AB – Wie stellen wir uns Wasserteilchen beim Frage: „Aus 50 mL Wasser und 50 Erwärmen vor? mL Alkohol entsteht eine Mischung mit 95 ml! Ein Zaubertrick?“ SuS-Versuch – Mischung gleicher Volumina von Ethanol und Wasser Analyse von Möglichkeiten und Grenzen des Modells der kleinsten Teilchen AB – Modell und Wirklichkeit Gemische und Reinstoffe ● Stoffe aufgrund ihrer Eigenschaften SuS-Versuch – Einteilung bekannter Definition von Gemisch und klassifizieren (UF2, UF3). Haushaltsmittel in die Kategorien Gemisch oder Reinstoff ● die Verwendung ausgewählter Stoffe im Reinstoff Alltag mithilfe ihrer Eigenschaften Info: Abb. in Chemie heute SI, begründen (B1, K2). Erweiterung auf “chemische” Stoffe möglich Westermann, S. 53 Seite 8 von 19
Schulinternes Curriculum Sek I Chemie Stand 01.06.2020 Stofftrennverfahren ● Experimente zur Trennung eines Trennung der Inhaltsstoffe eines heterogenen „Ist Tütensuppe gesund?“ Stoffgemisches in Reinstoffe (Filtration, Stoffgemisches Destillation) unter Nutzung relevanter Beantwortung der Frage durch Stoffeigenschaften planen und Lernaufgabe: Selbstständiges Trennen der Trennung der Inhaltsstoffe sachgerecht durchführen (E1, E2, E3, E4, K1). Inhaltsstoffe einer Tütensuppe anhand einer zuvor aufgestellten Reihenfolge: Recherche zu den Inhaltsstoffen einer Tütensuppe ● Aussortieren/Sieben ● Extrahieren Optional: Entwicklung eines ● Sedimentieren Übersichtsposters (DinA3/A2) zu ● Filtrieren den angewendeten Trennverfahren ● Eindampfen und den Inhaltsstoffen AB – Watercone „Eine einfache Methode der Trinkwassergewinnung? – Wie funktioniert ein watercone?“ AB – Adsorption von Stoffen (auch Farb- und „Warum ist Kohle in Geruchsstoffe) an Aktivkohle Schuheinlagen?“ – Die Wirkungsweise von Aktivkohle AB – Destillation von Rotwein Info: Destillieren in Chemie heute SI, Westermann, S. 61 Seite 9 von 19
Schulinternes Curriculum Sek I Chemie Stand 01.06.2020 Unterrichtsvorhaben 2 – Chemische Reaktion (14 Stunden) Inhaltliche Schwerpunkte Kompetenzbezug Methoden und Mögliche Kontexte und Anregungen für die und Schlüsselbegriffe Standardexperimente Arbeit Stoffumwandlung Die Schülerinnen und Schüler können… Kontext: Chemische Reaktionen im Labor und im Alltag Mögliche Experimente a) Chemische Reaktion als Stoffumwandlung − Definition der chemischen ● chemische Reaktionen an der Bildung problemorientierter Einstieg: Gewinnung von Salz und von neuen Stoffen mit anderen Brausetablette in Wasser Reaktion als Stoffumwandlung Zucker aus Salzwasser bzw. Zuckerwasser durch Eigenschaften und in Abgrenzung zu Eindampfen physikalischen Vorgängen identifizieren Salz in Wasser Beobachtung: (UF2, UF3), ● beim Salzwasser verdampft das Wasser und zurück evtl. Verbrennung von bleibt Kochsalz Zucker (SV); Gefährdung ● beim Zuckerwasser verdampft zunächst Wasser, durch Aktivkohlestopfen dann entsteht ein zähflüssiger Zuckersirup und minimieren anschließend karamellisiert der Zucker Untersuchung der Vorgänge beim Erhitzen von Zucker: − Beobachtung der Verfärbung der Schmelze von weiß über gelb zu braun bis schwarz (neuer Stoff mit neuen Eigenschaften) − Beobachtung einer farblosen Flüssigkeit (Nachweis von Wasser als zweites Reaktionsprodukt) Informationen zum Versuch: https://www.seilnacht.com/versuche/cus.html Ergänzung: das Reagenzglas wird mit einem Luftballon verschlossen. https://lp.uni-goettingen.de/get/text/1886 https://degintu.dguv.de/experiments/84 Seite 10 von 19
Schulinternes Curriculum Sek I Chemie Stand 01.06.2020 − Beschreibung der Edukte/ ● einfache chemische Reaktionen b) Chemische Reaktion und Energieumwandlung Ausgangsstoffe und Produkte/ sachgerecht durchführen und Kupfersulfat-Hydrat Endstoffe auswerten (E4, E5, K1), reagiert zu Kupfersulfat https://www.fachreferent-chemie.de/wp- ● chemische Reaktionen in Form von und Wasser content/uploads/Zink_Schwefel.pdf − Deutung der Reaktionsschemata in Worten https://degintu.dguv.de/experiments/151 Versuchsbeobachtungen darstellen (UF1, K1), Reaktion von Schwefel mit hinsichtlich der Veränderung ● bei ausgewählten chemischen Infos für die Lehrperson zum Metabolismus: Kupferblech (SV) der Stoffeigenschaften und der Reaktionen die Energieumwandlung der http://www.chemieunterricht.de/dc2/wsu- energetischen Beobachtungen in den Stoffen gespeicherten Energie bclm/kap_03.htm Reaktion von Schwefel mit − Reaktionsschema für die (chemische Energie) in andere Eisen (LD/SD) - Energieumwandlungen von chemischer Energie in Reaktion aufstellen Energieformen begründet angeben (UF1), andere Energieformen anhand von Beispielen ● bei ausgewählten chemischen Reaktion von Schwefel mit beschreiben Reaktionen die Bedeutung der Zinkpulver (LV) Vertiefungsmöglichkeiten: Aktivierungsenergie zum Auslösen einer − Einführung der Fachbegriffe Reaktion beschreiben (UF1). Streichholz (SV) Energiegehalt von Lebensmitteln (Schokolade) z. B. „chemische Energie“ (in Stoffen ● chemische Reaktionen anhand von Backen eines Spiegeleis mit einem Stück brennender gespeicherte Energie) und Stoff- und Energieumwandlungen auch Evt.: Metabolismus: Schokolade „Aktivierungsenergie“ im Alltag identifizieren (E2, UF4). Energieumwandlung in http://www.uni-koeln.de/math-nat- − Erweiterung der Definition für unserem Körper: fak/didaktiken/chemie/schokomaterialien/v2.pdf chemische Reaktionen um Energiegehalt in Alternativ: Verbrennung von Zucker: energetische Aspekte Nahrungsmitteln https://degintu.dguv.de/experiments/19385 Recherche nach weiteren Alternativ: Verbrennung eines Marshmallows in einem chemischen Reaktionen im Kalorimeter und Messen des Temperaturanstiegs Alltag https://www.youtube.com/watch?v=cw7q433ynYg ● die Bedeutung chemischer Reaktionen in der Lebenswelt begründen (B1, K4). Mögliche Vertiefungen: https://www.uni- regensburg.de/chemie-pharmazie/anorganische- chemie-pfitzner/medien/data-demo/2011- 2012/ws2011-2012/backmittel_pmnw.pdf Seite 11 von 19
Schulinternes Curriculum Sek I Chemie Stand 01.06.2020 Unterrichtsvorhaben 3 – Verbrennung - Brände und Brennbarkeit (ca. 20 Std) Inhaltliche Schwerpunkte Kompetenzbezug Methoden und Mögliche Kontexte und und Schlüsselbegriffe Standardexperimente Anregungen für die Arbeit Die Schülerinnen und Schüler können... Ohne Luft keine Verbrennung? Verbrennung als Reaktion mit Sau- ● die Verbrennung als eine chemische Reaktion mit SuS-Exp: Die Kerzenflamme: erstoff: Oxidbildung I Sauerstoff identifizieren und als Oxidbildung klas- Was brennt bei der Kerze? Luft und Verbrennung sifizieren (UF3), Was entsteht bei der ● Formulieren von Wortgleichung als Vorstufe der Kerze? => Kerze ersticken Was ist Luft? - Luft mehr als Nichts Reaktionsgleichung - Vernetzung zu IF6 (UF3, E2) bzw. Fernzündung über den Rauch Nachweisreaktionen ● Nachweisreaktionen von Gasen (Sauerstoff, Demo-Exp: Analyse des Das Lagerfeuer – die Kunst des Kohlenstoffdioxid) und Wasser durchführen (E4) Verbrennungsgases, Feuermachens: ● anhand von Beispielen Reinstoffe in chemische Sauerstoffnachweis, CO2- Systematische Betrachtung der Elemente und Verbindungen einteilen (UF2, UF3), ● die wichtigsten Bestandteile des Gasgemisches Nachweis als Gegenprobe Brandentstehung: Brennbarkeit, Luft, ihre Eigenschaften und Anteile nennen (UF1, Zündtemperatur und Zerteilungsgrad UF4), Demo-Exp: Entzünden von und Ableiten von Methoden zum festem Paraffin durch Erhitzen Feuerlöschen ● in vorgegebenen Situationen Handlungs- und anschließendes “Löschen” Zündtemperatur, Zerteilungsgrad möglichkeiten zum Umgang mit brenn- baren mit verschiedenen Methoden Die Kunst des Feuerlöschens Stoffen zur Brandvorsorge sowie mit offenem Branddreieck Feuer zur Brandbekämpfung bewerten und sich SuS-Exp: Sicherheitserziehung (Sicherer Umgang begründet für eine Handlung entscheiden (B2, B3, K4), mit Feuer und Flamme) Bau eines Feuerlöschers Exkursion zur heimischen Feuerwehr Seite 12 von 19
Schulinternes Curriculum Sek I Chemie Stand 01.06.2020 Die Chemie der Verbrennung: Die Schülerinnen und Schüler können... Die Chemie der Verbrennung ● die Verbrennung als eine chemische Demo-Exp: Verbrennung als Reaktion mit Reaktion mit Sauerstoff identifizieren und Vernetzung der Erkenntnisse: Was Sauerstoff: Oxidbildung II als Oxidbildung klassifizieren (UF3), Verbrennen von Eisenwolle und verbrennt bei der Kerze? mit ● Formulieren von Wortgleichung als Vorstufe anderen Metallen der Reaktionsgleichung - Vernetzung zu IF6 Verbrennungsreaktionen von Metallen (UF3, E2) im Vergleich Wasser - auch ein ● die Analyse und Synthese von Wasser als Beispiel Wasser - auch ein Oxid? Verbrennungsprodukt? für die Umkehrbarkeit chemischer Reaktionen SuS-Exp: Analyse von Wasser beschreiben (UF1). mittels Spritzentechnik Anknüpfung hier an einfache chemische Elemente und ● Nachweisreaktionen von Gasen (Wasserstoff) und Brennstoffzellenexperimente möglich Verbindungen: Analyse, Synthese Wasser durchführen (E4) => Schwerpunkt dann mehr beim ● mit einem einfachen Atommodell Vor- und Basiskonzept Energie Nachteile einer ressourcenschonenden Umkehrbarkeit chemischer Energieversorgung auf Grundlage der Reaktionen: Wasser als Oxid Andere chemische Verbindungen: Umkehrbarkeit chemischer Reaktionen am Chemische Reaktionen im Beispiel von Wasser beschreiben (B1). Labor: Verbinden und Zerlegen Erhitzen von Silberoxid (vgl. Buch S. 92) – das Lego-Prinzip - einfaches Atommodell Handlungsorientiertes Arbeiten Synthese und Analyse von Kupferiodid/ Kupfersulfid (Buch S. 94) Die Geschichte von den Kupis und den Sulfis Wer oder Was ist Plumbum? Elemente und ihre Namen Das Periodensystem der Elemente als Übersicht über alle Elemente Seite 13 von 19
Schulinternes Curriculum Sek I Chemie Stand 01.06.2020 Verbrannt aber nicht vernichtet: ● Massenänderungen bei chemischen Reaktionen SuS-Exp: Massenvergleich bei Müllverbrennung - die Lösung des mit Sauerstoff erklären (E5, E6), der Oxidation von Metallen / Problems? Ist der Müll dann weg? Gesetz von der Erhaltung der Masse ● den Verbleib von Verbrennungsprodukten Streichhölzern in offenen und (Kohlenstoffdioxid, Wasser) mit dem Gesetz von => Energie als Gewinn => geschlossenen Systemen der Erhaltung der Masse begründen (E3, E6, E7, Energienutzung im Kraftwerk K3). Visualisierung der Erklärung auf der Teilchenebene und Rollenspiel (Zinkis und Sulfis vgl. Atommodell nach Dalton ● mit einem einfachen Atommodell Vor- und Präsentation der Ergebnisse Schrödel-CD) Nachteile einer ressourcenschonenden Energieversorgung auf Grundlage der Arbeit mit Modellen (z.B. Legomodelle, Umkehrbarkeit chemischer Reaktionen am Beispiel von Wasser beschreiben (B1). Playmais...) Seite 14 von 19
Schulinternes Curriculum Sek I Chemie Stand 01.06.2020 Unterrichtsvorhaben 4 – Metalle und Metallgewinnung (14 Stunden) Inhaltliche Schwerpunkte Kompetenzbezug Methoden und Mögliche Kontexte und Anregungen für und Schlüsselbegriffe Die Schülerinnen und Schüler können... Standardexperimente die Arbeit ● chemische Reaktionen, bei denen SuS-Exp: Eigenschaften der Möglicher Kontext: Töpfe aus Metall Stoffgruppe der Metalle Sauerstoff abgegeben wird, als Zerlegung Metalle Gewinnung von Metallen von Oxiden klassifizieren (UF3), ● Experimente zur Zerlegung von Problem: Die wenigsten Metalle kommen Zerlegung von Metalloxiden Erhitzen von Metalloxiden, z.B. ausgewählten Metalloxiden gediegen vor Sauerstoffübertragungsreaktionen hypothesengeleitet planen und geeignete Silberoxid (Exp) (Donator-Akzeptor-Prinzip) Reaktionspartner auswählen (E3, E4), Betrachtung auf ● Sauerstoffübertragungsreaktionen im Sinne Teilchenebene Möglicher Kontext: Wie kam Ötzi an sein des Donator-Akzeptor-Konzeptes Kupferbeil? modellhaft erklären (E6), Gewinnung von Kupfer: ● ausgewählte Verfahren zur Herstellung von Kupferdolch in Bielsteinhöhle Warstein selbstständige Planung Metallen erläutern und ihre Bedeutung für und experimentelle Kupferbergbau in Marsberg die gesellschaftliche Entwicklung beschreiben (E7). Durchführung (je nach Planung mit Kohlenstoff oder Eisen) im SV oder LV ● ausgewählte Metalle aufgrund ihrer Reak- SV/LV: Reaktion von Metallen Oxidbildung bei Metallen: Unterscheidung von Metalle reagieren mit Sauerstoff tionsfähigkeit mit Sauerstoff als edle und oder Metallpulvern mit edlen und unedlen Metallen - Erarbeitung der edle und unedle Metalle unedle Metalle ordnen (UF2, UF3). Sauerstoff Oxidationsreihe der Metalle aufgrund ihrer Reaktionsfähigkeit mit Sauerstoff ● Maßnahmen zum Löschen von Möglicher Kontext: Großbrand in einer Metallbränden auf der Grundlage der Recyclingfirma Sauerstoffüber-tragungsreaktion begründet https://www.waz.de/staedte/duisburg/experten auswählen (B3). -suchen-ursache-fuer-grossbrand-im-duisburger- hafen-id9383772.html Seite 15 von 19
Schulinternes Curriculum Sek I Chemie Stand 01.06.2020 ● ausgewählte Verfahren zur Herstellung von Aufbau und Betrieb des Hochofens Metalle im Stoffkreislauf Metallen erläutern und ihre Bedeutung für Vom Roheisen zum Stahl Eisen und Stahl die gesellschaftliche Entwicklung Film „Vom Erz zum Stahl“ beschreiben (E7) Metallrecycling Recycling von Metallen, am https://www.planet- ● die Bedeutung des Metallrecyclings im Zusammenhang mit Ressourcenschonung Beispiel von Aluminium, schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=6903 und Energieeinsparung beschreiben und auf Kupfer oder Metallen im Möglicher Kontext: dieser Basis das eigene Konsum- und Smartphone – Recherche Entsorgungsverhalten bewerten (B1, B4, K4), und (digitale) Metalle im Smartphone Präsentation Untersuchung von Getränkedosen (MKR 2.1, MKR 4.1) Film: Wie Aluminium recycelt wird (W wie wissen (ARD) https://www.youtube.com/watch?v=bT2093g7D qw Seite 16 von 19
Schulinternes Curriculum Sek I Chemie Stand 01.06.2020 Jahrgangsstufe 8 Vorentwurf Unterrichtsvorhaben 5 – Elementfamilien schaffen Ordnung (30 Stunden) Inhaltliche Schwerpunkte Kompetenzbezug Methoden und Mögliche Kontexte und Anregungen für und Schlüsselbegriffe Die Schülerinnen und Schüler können... Standardexperimente die Arbeit Eigenschaften von Elementen der ● Vorkommen und Nutzen ausgewählter Elementfamilien: Alkalimetalle, chemischer Elemente und ihrer Halogene, Edelgase Verbindungen in Alltag und Umwelt beschreiben (UF1) Periodensystem der Elemente ● chemische Elemente anhand ihrer charakteristischen physikalischen und differenzierte Atommodelle chemischen Eigenschaften den Elementfamilien zuordnen (UF3), Atombau: ● aus dem Periodensystem der Elemente wesentliche Informationen Elektronen, Neutronen, Protonen, zum Atombau der Elektronenkonfiguration Hauptgruppenelemente (Elektronenkonfiguration, Atommasse) herleiten (UF3, UF4, K3). ● physikalische und chemische Eigenschaften von Alkalimetallen, Halogenen und Edelgasen mithilfe ihrer Stellung im Periodensystem begründet vorhersagen (E3), ● die Entwicklung eines differenzierten Kern-Hülle-Modells auf der Grundlage von Experimenten, Beobachtungen und Schlussfolgerungen beschreiben (E2, E6, E7), Seite 17 von 19
Schulinternes Curriculum Sek I Chemie Stand 01.06.2020 ● die Aussagekraft verschiedener Kern- Hülle-Modelle beschreiben (E6, E7). ● vor dem Hintergrund der begrenzten Verfügbarkeit eines chemischen Elements bzw. seiner Verbindungen Handlungsoptionen für ein ressourcenschonendes Konsumverhalten entwickeln (B3). Seite 18 von 19
Schulinternes Curriculum Sek I Chemie Stand 01.06.2020 3. Grundsätze der Leistungsmessung und -bewertung Grundsätzlich gilt auch im Fach Chemie das im Schulprogramm verankerte allgemeine Leistungskonzept des Gymnasiums Antonianum. Darüber hinaus hat die Fachschaft Chemie folgende Vereinbarungen getroffen: mündliche Leistungen Bewertet bei der mündlichen Mitarbeit der Schülerinnen und Schüler im Unterricht werden: ▪ Beiträge zu Unterrichtsgesprächen wie Antworten auf Fragen, Sachdarstellungen, Problematisierungen, Erläuterungen, Denkanstöße und Zusammenfassungen ▪ vorgetragene Referate ▪ Einbringen von Materialien ▪ mündliche Überprüfungen Neben der Quantität ist die Qualität der Beiträge angemessen zu berücksichtigen. methodische und ▪ Unterrichtsdokumentationen (z. B. Protokoll, Mappe, Heft). Die fachspezifische Bewertung von Mappen soll im Jahrgang 7 stärker gewichtet Leistungen werden als in den älteren Jahrgängen. ▪ Schriftliche Leistungsmessung (s.u.) ▪ Anwenden fachspezifischer Methoden und Arbeitsweisen (z. B. Planen, Durchführen Auswerten und Protokollieren von Experimenten, Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen) ▪ Ergebnisse von Partner- oder Gruppenarbeiten und deren Darstellung ▪ Präsentationen, auch mediengestützt (z. B. Referat, Plakat, Modell) ▪ Umgang mit Medien und anderen fachspezifischen Hilfsmitteln ▪ Hausaufgaben sollen laut Hausaufgabenerlass vom 16.12.2004 angemessen gewürdigt, dürfen jedoch nicht mit Noten bewertet werden. ▪ freie Leistungsvergleiche (z. B. Schülerwettbewerbe) schriftliche ▪ Pro Halbjahr können bis zu drei schriftliche Lernkontrollen im Überprüfungen Umfang von maximal 20 Minuten geschrieben werden. ▪ Termin und Inhalt bleibt dem bzw. der Unterrichtenden überlassen. Beides muss sich aus dem laufenden Unterricht ergeben. Erlasse sind zu beachten. Die Notenermittlung für die Mitarbeit im Unterricht erfolgt auf der Grundlage von Beobachtungen der mündlichen Leistungen und der anderen fachspezifischen Leistungen im Unterricht. Einzelne Beiträge dürfen kein unangemessenes Gewicht bei der Erteilung der Gesamtnote für die mündliche Mitarbeit erhalten. Zu Beginn des Schuljahrs werden den Schülerinnen und Schülern diese Grundsätze mitgeteilt. Zudem sind diese Grundsätze für Schülerinnen, Schüler und Eltern auf der Schulhomepage einsehbar.
Sie können auch lesen