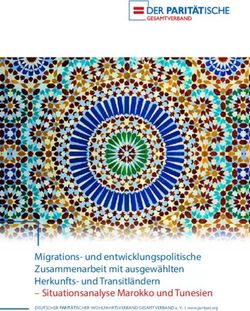SIND HANNOVER Zusammenleben in der Stadt - Strategien für Migration und Teilhabe
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
SIND HANNOVER Zusammenleben in der Stadt Verwaltungsentwurf Strategien für Migration und Teilhabe
Verwaltungsentwurf
Inhalt
Haltung der Landeshauptstadt Hannover zu Migration und Teilhabe...................................... 4
Grund der Überarbeitung und Ausgangssituation.................................................................... 6
Ziele und Funktionen des LIP 2.0............................................................................................. 8
Geltungsbereich und zeitliche Gültigkeit...................................................................................................8
Akteur*innen, Zielgruppen und strukturelle Ansätze................................................................................8
Rahmenbedingungen für die Umsetzung................................................................................10
Kennzahlen.............................................................................................................................................. 10
Qualitätssicherung und kontinuierliche Weiterentwicklung.................................................................... 10
Zentrale Koordination und LIP 2.0 Begleitgremium................................................................................. 10
Wirksamkeitsanalysen............................................................................................................................. 11
Finanzen.................................................................................................................................................. 11
Übergreifende Priorisierungen.............................................................................................. 12
Handlungsfelder und Querschnittsthemen............................................................................ 14
Handlungsfeld Bildung............................................................................................................................. 16
Handlungsfeld Soziales............................................................................................................................18
Handlungsfeld Demokratie......................................................................................................................20
Handlungsfeld Stadtleben und Kultur...................................................................................................... 22
Handlungsfeld Wirtschaft........................................................................................................................ 24
Handlungsfeld Stadtverwaltung und interkulturelle Öffnung.................................................................. 26
Unsere Vision: Wir halten zusammen.................................................................................... 28
Anhang................................................................................................................................... 30
3Haltung der Landeshaupt- 5. Wir fördern Sprachkompetenz in Deutsch und
stadt Hannover zu generell Mehrsprachigkeit sowie weitere Kom-
petenzen, die gesellschaftliche Teilhabe ermög-
Migration und Teilhabe lichen.
Die Landeshauptstadt Hannover ist eine Einwan- 6. Wir bekämpfen Rassismus, und jede andere
derungsstadt. Das Zusammenkommen von Men- Form von Diskriminierung in Hannover entschie-
schen von überall her, sei es aus dem unmittelba- den.
ren Umland oder von anderen Kontinenten, prägt
unsere Stadt.
7. Diese Leitlinien, die der Humanität und der
Dieses Selbstverständnis als Einwanderungsstadt allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ver-
hat praktische Konsequenzen, die sich in folgen- pflichtet sind, sind ein Maßstab für die gesamte
den Leitlinien ausdrücken: Stadtgesellschaft.
1. Hannover ist eine offene Stadt der Vielfalt und In anderen Worten: Ziel der Migrations- und Teil-
versteht Migration als selbstverständlichen Teil habepolitik der Landeshauptstadt Hannover ist
unserer gesellschaftlichen Realität. die Förderung sozialen Zusammenhalts und die
Verwirklichung gleichberechtigter Teilhabe aller
Hannoveraner*innen an den verschiedenen Le-
2. Alle Menschen in Hannover sollen gleichbe- bensbereichen unabhängig davon, wo sie oder
rechtigt und respektvoll zusammenleben können. ihre Vorfahren geboren wurden. Eine bewusste
Deshalb streben wir gleichberechtigte Teilhabe Gestaltung des Umgangs mit Einwanderung in
und Chancengerechtigkeit für alle im wirtschaft- diesem Sinne erfordert von einer Stadtgesell-
lichen, politischen, kulturellen und sozialen Leben schaft, die sich bis zur Jahrtausendwende noch
an. nicht bewusst als Einwanderungsstadt begrif-
fen hat, Veränderungen gerade auf struktureller
Ebene. Das heißt, nicht nur auf der individuellen,
3. Das Zusammenleben in Vielfalt hängt von allen zwischenmenschlichen Ebene, sondern auch auf
ab und ist deshalb eine Aufgabe für die gesamte der Ebene der Organisationen und der formalen
Stadtgesellschaft. Das Zusammenleben in Vielfalt Verfahren müssen Zugänge geöffnet werden.
braucht zudem für alle verbindliche Werte und Deshalb sind es vor allem die Menschen, die
Gesetze. Dieses gemeinsame Fundament bilden schon länger Teil der Stadtgesellschaft sind –
unsere Verfassung und die Rechtsstaatlichkeit. einschließlich der langansässigen Migrant*innen
und ihrer Nachkommen –, die durch ihr Wirken
in Vereinen, Organisationen, Behörden etc. die
4. Wir wollen lebendige Nachbarschaften, in Bedingungen dafür schaffen, dass Eingewanderte
denen alle Einwohner*innen gemeinsam ohne und ihre Nachkommen insgesamt eine Position
Angst in ihrer Unterschiedlichkeit leben können. der gleichberechtigten Teilhabe einnehmen kön-
nen.
4Damit ist auch gesagt, dass Begriffe wie „Mehr- unmittelbar mit all den Herausforderungen kon-
heitsgesellschaft“ oder „Aufnahmegesellschaft“ frontiert sind, die die Niederlassung in einem an-
wenig Aussagekraft haben, weil schon längst deren Land mit sich bringt, sind die Begriffe „Mig-
Eingewanderte und ihre Nachkommen das Ge- rant*innen“ oder „Eingewanderte“ angemessen.
schehen in der Stadt als Teil der „Mehrheitsge- Meint man den erweiterten Kreis aller Menschen,
sellschaft“ mitprägen und gestalten. Die Rede die vielleicht nicht selbst eingewandert sind, aber
von der „Aufnahmegesellschaft“ macht insofern über das Eingewandert-Sein der Eltern oder eines
eine irreführende Trennung zwischen „uns“ und Elternteils eine deutliche biografische Prägung
den „anderen“ auf. Ein nicht von Einwanderung erlebt haben, bietet es sich an, von „Eingewan-
geprägtes, einheitliches „Wir, die schon immer derten und ihren Kindern“ zu sprechen oder von
hier waren“ gibt es im Jahr 2020 nicht und hat es „Menschen aus Einwanderungsfamilien“. Meint
auch früher nie gegeben. man Menschen, die aufgrund ihrer Hautfarbe oder
anderer Merkmale rassistisch diskriminiert wer-
Das Beispiel zeigt: Sprache schafft Wirklichkeit den, kann man von Black, Indigenous and People
und Begriffe sind nicht belanglos. Sie prägen viel- of Color (BIPoC) sprechen, beziehungsweise von
mehr mit, was überhaupt gedacht werden kann. Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Die
Begriffe können Denkhorizonte öffnen oder auch vielfach als Ausgrenzung erlebte Kategorie „mit
schließen. In diesem Sinne ist die Zeit des Über- Migrationshintergrund“ braucht es hier nicht.
begriffs „Integration“ für alles, was mit Einwan-
derung zu tun hat, vorbei. Als wissenschaftliche Zu rechtfertigen ist der Gebrauch des Begriffs
Kategorie ist Integration unverändert von Bedeu- „mit Migrationshintergrund“ oder alternativ „mit
tung und keineswegs obsolet. Doch als politischer Migrationsbiografie“ tatsächlich allein als statisti-
Begriff der praktischen Gestaltung des Umgangs sches Werkzeug für die Messung systematischer
mit Migration und migrationsbedingter Vielfalt Barrieren bei Zugang zu Gütern und Entwick-
in unserer Stadt ist er so umstritten, dass er nur lungschancen. Auch hier gilt aber, dass überprüft
noch begrenzten Nutzen hat. Statt jedoch einen werden muss, ob dieses Werkzeug präzise genug
neuen Masterbegriff an seine Stelle zu setzen, ist. Das grundlegende Dilemma jeder Antidiskri-
wird in diesem Konzept versucht, möglichst ge- minierungsmaßnahme, dass sie das vermeintli-
nau zu beschreiben, was jeweils konkret gemeint che Merkmal, das zum Vorwand genommen wird,
ist. So wird der Begriff „Teilhabe“ überall dort be- Menschen zu diskriminieren, benennen muss und
nutzt, wo es um Zugänge zu Ressourcen sowie die durch gerade diese Benennung dazu beiträgt,
Möglichkeit der aktiven Gestaltung und Prägung dass es zum Stigma und immer weitergetragen,
der Stadtgesellschaft geht. An Stellen, wo sich reproduziert und damit verewigt wird, lässt sich
der Fokus auf die Veränderung der Bevölkerungs- an dieser Stelle nicht lösen.
zusammensetzung richtet, wird eher der Begriff
„Zusammenleben in Vielfalt“ stehen. Für das respektvolle Zusammenleben in der Stadt
ist es unabhängig davon notwendig darauf hinzu-
Durch einen entsprechend flexiblen und präzi- wirken, dass Kategorien wie „mit Migrationshin-
sen Umgang wird auch der Gebrauch des eben- tergrund“, die Menschen in „wir“ und „andere“
falls sehr umstrittenen Begriffs „mit Migrations- aufteilen, an Bedeutung verlieren und verblassen.
hintergrund“ auf ein Minimum reduziert. Will
man beispielsweise Menschen bezeichnen, die
5Grund der Überarbeitung In den zwölf Jahren seit der Veröffentlichung des
und Ausgangssituation LIP sind viele Projekte und Maßnahmen zu sei-
ner Umsetzung realisiert worden. Es haben sich
in dieser Zeit aber auch die Rahmenbedingungen
auf kommunaler, gesamtgesellschaftlicher und
Im Jahr 2008 wurde erstmalig ein umfassendes internationaler Ebene stark verändert. Heute ist
Konzept zur Gestaltung des Zusammenlebens in Hannover – anders als noch 2008 – eine stark
Vielfalt für die Landeshauptstadt Hannover be- wachsende Stadt und es findet wieder eine er-
schlossen. In Anlehnung an den kurz zuvor ent- hebliche Einwanderung statt. Das Gesamtwachs-
standenen Nationalen Integrationsplan wurde er tum Hannovers von 524.000 Einwohner*innen in
„Lokaler Integrationsplan“, kurz LIP, getauft. Vo- 2014 auf heute über 556.000 ist in erheblichem
rangegangen waren zwei Jahre intensiver Arbeit Umfang auf neue Migrationsprozesse – darunter
vieler Akteur*innen innerhalb und außerhalb der EU-Binnenwanderung und fluchtbedingte Einwan-
Stadtverwaltung. Tatsächlich lassen sich die An- derung – zurückzuführen.
fänge der Bemühungen sogar zurückverfolgen bis
zu einem Ratsbeschluss von 2004, in welchem die Eine Überarbeitung des LIP steht aber nicht nur
Verwaltung beauftragt wurde, ein interkulturelles deshalb dringend an, es hat sich auch der ge-
Handlungsprogramm für Hannover vorzulegen. samtgesellschaftliche Diskurs zum Thema Ein-
wanderung stark weiterentwickelt. Es gab daher
Was den LIP-Entstehungsprozess besonders aus- schon länger konkrete Forderungen aus der han-
zeichnete war, dass sich zahlreiche Migrant*in- noverschen Zivilgesellschaft und insbesondere
nenorganisationen aktiv daran beteiligt haben. von Migrant*innenorganisationen, den LIP konst-
Der LIP kann in dieser Hinsicht durchaus als eine ruktiv weiterzuentwickeln, die nunmehr in einem
Art Wendepunkt im Verhältnis zwischen Mig- gesamtstädtischen Partizipationsprozess aufge-
rant*innen-Communities und „etablierter“ Stadt- griffen und umgesetzt werden können.
gesellschaft gesehen werden. Denn es wurden in
dieser Zeit Partizipations- und Kommunikations- Um sich zunächst über den erreichten Stand zu
verbindungen etabliert, die sich in der Folge er- vergewissern, wurden in 2019 zwei unterschied-
folgreich verstetigt haben. liche Maßnahmen zur Evaluation des Lokalen
Integrationsplan von 2008 durchgeführt. Zum
Es verdient ebenso hervorgehoben zu werden, einen schrieb der Gesellschaftsfonds Zusammen-
dass die endgültige Verabschiedung durch die leben (GFZ) seinen XI. Ideenwettbewerb unter
Ratsversammlung am 12. Juni 2008 fraktions- dem Titel „Erfahrung für die Zukunft! Zehn Jahre
übergreifend und einstimmig zustande kam. Es Lokaler Integrationsplan – Wie soll es weiterge-
ist auf diese Weise tatsächlich gelungen, einen hen?“ aus. Elf einzelne Projekte diskutierten und
weitgehenden Konsens in der Stadtgesellschaft bewerteten den LIP aus höchst unterschiedlichen
zum Thema Migration und Teilhabe herzustellen. Perspektiven.
6Zum anderen fand durch ein extern beauftragtes Zusammenfassend betonen beide Evaluationen,
Institut eine Evaluation des LIP aus Sicht der Ver- dass der LIP seit 2008 das Stadtleben nachhaltig
waltung statt. Der verwaltungsinterne Rückblick positiv geprägt hat und ein hoher Identifikations-
sollte Rückschlüsse auf die Qualität der Umset- grad erreicht wurde. Eine Vielzahl von Einzel-
zung und Wirkungseffekte des LIP ermöglichen. projekten wurde im Rahmen des LIP erfolgreich
Schwerpunkte lagen dabei zum einen auf der umgesetzt oder Teil des laufenden Geschäfts
Darstellung eines Sachstands „Einwanderung und der Stadtverwaltung. Daneben ist sicherlich die
Interkulturelle Öffnung“ zum anderen wurden Bewusstmachung und Sensibilisierung für das
durch die retrospektive Betrachtung des Lokalen Thema „Einwanderung“ innerhalb der Stadtver-
Integrationsplans von 2008 neben Stärken auch waltung sowie die Begegnung auf Augenhöhe al-
Schwächen identifiziert und Erkenntnisse aus ler am Prozess beteiligten Akteur*innen als eine
dem Erstellungs- und Umsetzungsprozess sowie zentrale Folge des alten LIP anzusehen. Die Kri-
aus der Nachhaltigkeit des Lokalen Integrations- tikpunkte der Evaluationen bezogen sich primär
plans gezogen. auf die nachhaltige Umsetzung, die Jugendbe-
teiligung, das Controlling sowie insgesamt auf
die Beteiligung der Stadtgesellschaft. Auf dieser
Grundlage wurde deshalb für den LIP 2.0 ein Ent-
stehungs- und Umsetzungsprozess entwickelt,
der von Beginn an auf eine breite Mitwirkung
der Stadtgesellschaft gesetzt hat. Die sechs Ex-
pert*innengruppen sowie die in allen Gruppen
vertretene Expert*innengruppe Jugend, sind
durchweg divers und vor allem paritätisch mit
verwaltungsinternen und -externen Expert*innen
besetzt und arbeiten mit den Erkenntnissen der
Evaluationen. Die von den Expert*innengruppen
entwickelten Maßnahmen profitieren von dieser
Öffnung und sind noch präziser und zielgerichte-
ter als im LIP von 2008.
7Ziel und Funktion sellschaft ist. Der LIP 2.0 wendet sich daher an
des LIP 2.0 die Stadtgesellschaft als Ganzes. Die Aufgabe, ein
gedeihliches Zusammenleben in einer Einwande-
rungsstadt zu gestalten, kann nur im Zusammen-
wirken der Vielen bewältigt werden.
Der LIP 2.0 schreibt die Richtung der Migrati-
ons- und Teilhabepolitik für Hannover fort. Dabei Der LIP 2.0 soll mit einer Perspektive von fünf
geht es um die Gestaltung und Organisation des Jahren den Rahmen der Migrations- und Teilha-
Umgangs mit Migration und migrationsbedingter bepolitik in Hannover setzen. Er wird zwar konti-
Vielfalt in unserer Stadt. Migrations- und Teil- nuierlich weiterentwickelt, es sollte aber spätes-
habepolitik auf städtischer Ebene umfasst dabei tens nach fünf Jahren eine Bilanz gezogen und
Fragen von Zu- und Abwanderung, vor allem aber eine Neubewertung vorgenommen werden.
der Förderung gesellschaftlichen Zusammenhalts
und der individuellen Teilhabe der Eingewander- Akteur*innen, Zielgruppen und
ten und ihrer Nachkommen. strukturelle Ansätze
Die Stadtverwaltung ist eine wichtige Akteurin
Das Ziel der Migrations- und Teilhabepolitik der der städtischen Migrationspolitik. Ihre Rolle ist
Landeshauptstadt Hannover ist die gleichbe- darüber hinaus die einer Koordinatorin, die das
rechtigte Teilhabe aller Hannoveraner*innen am Zusammenwirken aller nach Kräften unterstützt.
(stadt-) gesellschaftlichen Leben. Teilhabe ist Das bedeutet auch, bestehende Angebote und
hier immer auch explizit aktiv gemeint, also als Akteur*innen in allen Bereichen, die das Thema
Möglichkeit, die Stadtgesellschaft zu gestalten, Migration und Teilhabe in Hannover berühren, zu
sichtbar zu prägen und zu bereichern. Um dieses vernetzen. Die Landeshauptstadt Hannover ver-
Ziel zu erreichen, entwickelt der LIP 2.0 in sechs pflichtet sich eine gestärkte Organisationsstruk-
Handlungsfeldern konkrete Maßnahmen. Diese tur für das Thema „Migration und Teilhabe“ im
sind so formuliert, dass sie in den Zuständig- Dezernat III „Soziales und Integration“ zu ent-
keitsbereich der Kommune fallen, können aber in wickeln. Hierbei wird ein eigener Fachbereich an-
Einzelfällen auch darüber hinaus weisen. Damit gestrebt, der dazu beitragen wird, dass Hannover
steckt er außerdem den Rahmen für den Umgang sich zu einer diskriminierungsfreien und diversi-
mit Migration und migrationsbedingter Vielfalt in tätsorientierten weltoffenen Einwanderungsstadt
Hannover ab. entwickelt.
Geltungsbereich und zeitliche Gültigkeit Migrations- und Teilhabepolitik ist eine Angele-
Der LIP 2.0 gilt innerhalb der Stadtverwaltung genheit der gesamten Stadtgesellschaft sowie
übergreifend für alle Dezernate und alle Fach- ihrer Institutionen, vielfältigen zivilgesellschaft-
bereiche. Alle Bereiche der Stadtverwaltung sind lichen Organisationen und politischen Vertre-
ausdrücklich für die Umsetzung des LIP 2.0 zu- tungen. Eine besondere Schnittstelle zwischen
ständig und an seiner Umsetzung beteiligt. Zivilgesellschaft und Politik stellen die Stadtbe-
zirksräte und in ihnen vor allem die Integrations-
Außerhalb der Stadtverwaltung beansprucht der beiräte dar. Alle Hannoveraner*innen, egal ob sie
LIP 2.0 einen Konsens zu formulieren, der rich- Migration aktiv oder passiv erfahren haben, sind
tungsweisend für alle Akteur*innen der Stadtge- sowohl Akteur*innen, als auch Zielgruppe des LIP
82.0. Wenn im Folgenden von „wir“ gesprochen deren eröffnet eine überindividuelle Perspektive
wird, sind also alle Menschen, die in Hannover den Blick auf strukturelle und institutionelle Hin-
leben, gemeint. dernisse und Diskriminierungen, die einer gleich-
berechtigten Teilhabe insbesondere von Ein-
Dabei ist auch klar, dass nicht jede*r Hannove- gewanderten und ihren Nachkommen im Wege
raner*in die gleichen Bedürfnisse und Möglich- stehen. Die Landeshauptstadt Hannover stellt
keiten bei der Verwirklichung einer offenen und sicher, dass sie in ihren Strukturen und ihren
gleichberechtigten Stadtgesellschaft hat. In Leistungen für alle Menschen in Hannover in glei-
Hannover leben Menschen, die lange Wege hin- cher Weise zugänglich ist.
ter sich haben und hier auf ein besseres Leben
hoffen. In Hannover leben Menschen, denen Teil- Das gilt insbesondere im Hinblick auf Geflüchte-
habe und Anerkennung seit Jahren, Jahrzehnten te, Eingewanderte und ihre Kinder, die dritte und
oder Generationen schwergemacht oder verwei- vierte Generation in Einwanderungsfamilien, BI-
gert werden. In Hannover leben Menschen, die PoC sowie Eingewanderte in bestimmten Lebens-
Rassismus erfahren und zu „Anderen“ gemacht phasen, Alterssegmenten und sozialen Milieus
werden. Auch andere Diskriminierungsdimen- und unterschiedlicher Religionszugehörigkeit. Be-
sionen können Ausgrenzung bewirken und dazu sondere Aufmerksamkeit gilt vulnerablen Grup-
führen, dass Fähigkeiten und Potenziale nicht pen wie beispielsweise Kindern und Menschen
erkannt und damit nicht anerkannt werden. So mit physischen oder psychischen Einschränkun-
ergeben sich Teilhabebarrieren und Hürden, die gen. Selbstverständlich sind auch diese definier-
andere nicht zu überwinden haben. ten Zielgruppen in sich nicht homogen, innerhalb
der Gruppe der BIPoC können beispielsweise
Die Stadtgesellschaft – und mit ihr die Verwal- gerade Frauen zusätzlichen Benachteiligungen
tung – steht vor der Aufgabe, entschieden dafür aufgrund ihres Geschlechts ausgesetzt sein. Die
einzutreten, dass alle Hannoveraner*innen ihre Selbstwahrnehmung der Angesprochenen wird
Stadtgesellschaft gleichberechtigt mitprägen bei den Maßnahmen des LIP 2.0 mitgedacht.
können sowie entschieden dagegen vorzugehen,
dass Hannoveraner*innen diskriminiert und aus-
gegrenzt werden.
Die grundsätzliche Frage, wie schaffen und pfle-
gen wir den Zusammenhalt unserer Stadtgesell-
schaft, reicht allerdings über das individuelle
Wohlergehen hinaus. Deshalb erschöpft sich das
Thema nicht in der individuellen Teilhabe der Ein-
gewanderten und ihrer Nachkommen auf gleich-
berechtigter Basis, sondern es verlangt auch eine
gesellschaftliche, überindividuelle Perspektive.
Und hier sprechen wir zum einen über Solidarität.
Es geht darum, sichtbar zu machen, dass wir als
Stadt eine Solidargemeinschaft bilden, die soziale
Schieflagen nicht auf Dauer dulden kann. Zum an-
9Rahmenbedingungen Kennzahlen
für die Umsetzung Für den LIP 2.0 werden im Rahmen des Ziel- und
Maßnahmenkataloges eine überschaubare Anzahl
an Kennzahlen in ausgewählten Bereichen festge-
schrieben. Die Auswahl der Bereiche orientiert
Die Zuständigkeiten für die Migrations- und Teil- sich an den Schwerpunktsetzungen der einzelnen
habepolitik sind in Deutschland auf die beiden fö- Handlungsfelder. Kennzahlen werden nicht für
deralen Ebenen (Bund/Länder) verteilt. Die Kom- einzelne Projektideen festgelegt, sondern Aus-
munen sind Teil der Bundesländer, haben aber wahlkriterium ist die Frage ihrer grundsätzlichen
verfassungsrechtlich garantiert ein Recht der und übergeordneten Wirkung. Es werden nur
Selbstverwaltung und damit eine gewisse Eigen- Kennzahlen für Bereiche festgeschrieben, in de-
ständigkeit. Das Grundgesetz bestimmt, dass ih- nen die Kommune eine eigene Zuständigkeit hat.
nen die Möglichkeit gegeben werden muss, „alle
Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Qualitätssicherung und kontinuierliche
Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu Weiterentwicklung
regeln“. Darüber hinaus hat die Kommune zahl- Die gesellschaftliche Arbeit, der sich der LIP 2.0
reiche gesetzlich zugewiesene staatliche Aufga- verpflichtet sieht, endet nicht mit der Festschrei-
ben, die sie als örtlicher Verwaltungsträger für bung von Zielen und Maßnahmen, sondern be-
die Länder wahrnimmt. Dies sind im Wesentli- ginnt damit. Die Umsetzung des Ziel und Maßnah-
chen die Aufgaben der Daseinsvorsorge. So fällt menkataloges ist deshalb prozesshaft zu denken.
beispielsweise der Betrieb von Kindergärten in Für die Umsetzungsphase ist eine fortlaufende
die Zuständigkeit der Kommune. Sie kann die Analyse und transparente Reflexion angedacht,
frühkindliche Bildung in ihren Kitas fördern und um nachsteuern und neu justieren zu können.
Unterstützungsprogramm wie „Rucksack“ in den Hierfür wird folgende Struktur aufgebaut:
Grundschulbereich übertragen.
Zentrale Koordination und LIP 2.0 Begleit-
Wichtige Bereiche der Migrationspolitik, wie die gremium
Handhabung des Einbürgerungs-, Aufenthalts- Die Aufgabe der internen Steuerung ist im Dezer-
und Asylrechts oder das Wahlrecht für Nicht-EU- nat III „Soziales und Integration“ der Stadtver-
Bürger*innen liegt nicht im Handlungsspielraum waltung der Landeshauptstadt Hannover angesie-
der Kommunen. Die Landeshauptstadt Hannover delt. Von hier aus findet, in Abstimmung mit dem
bewegt sich somit als Kommune im Bereich der LIP 2.0 Begleitgremium (vorläufige Benennung),
Migrations- und Teilhabepolitik in einem engen eine ständige Begleitung des Umsetzungsprozes-
Rahmen, hat aber dennoch eine gestaltende ses und die überprüfende Auseinandersetzung
Kraft, die sie nutzen will. mit den angestrebten Zielen und Wirkungen statt.
Die abschließende Benennung dieses begleiten-
den Gremiums erfolgt in der zweiten Phase des
LIP 2.0 Prozesses.
10Darüber hinaus wirkt das Dezernat III in Koope- Finanzen
ration mit dem LIP 2.0 Begleitgremium im Rah- Die Ziele und Maßnahmen des LIP 2.0 müssen
men einer Kommunikationsstrategie darauf hin, finanziell hinterlegt werden. Hierfür ist es unab-
den LIP 2.0 und seine Maßnahmen der breiteren dingbar die bestehenden Maßnahmen der Stadt-
Stadtbevölkerung noch weiter bekannt zu ma- verwaltung und die damit verbundenen Aufwen-
chen und weist über Öffentlichkeitsarbeit in den dungen aufzubereiten und im Jahr 2022 mit dem
Stadtteilen auf kontinuierliche Beteiligungsmög- entwickelten Ziel- und Maßnahmenkatalog abzu-
lichkeiten hin. gleichen.
Für das Begleitgremium werden verwaltungs- Für das Jahr 2022 stehen zusätzlich 200.000 Euro
interne sowie stadtgesellschaftliche Akteur*in- für die entwickelten Maßnahmen und deren Um-
nen, darunter auch Jugendvertretungen und setzung zur Verfügung. Folgende drei Schwer-
Migrant*innenorganisationen, berufen, die den punkte sollen innerhalb des neuen Innovations-
Umsetzungsprozess begleiten und bewerten. Es fonds entsprechend der entwickelten Ziele- und
handelt sich um ein beratendes Gremium, das Maßnahmen finanziert werden:
gleichzeitig auch eine Steuerungsfunktion ausübt.
Die Einbeziehung der Stadtbezirksräte und Integ- 1. Kleinstprojekte bis zu einer Höhe von 5.000 €
rationsbeiräte ist in diesem Kontext über die Ab- 2. Projekte mit einem Volumen zwischen 5.000 €
frage von Einschätzungen zum Umsetzungspro- und 50.000 €
zess und für das Aufgreifen neuer Entwicklungen 3. Innovative Projekte der Stadtverwaltung
vorgesehen. Das Begleitgremium tagt regelmä-
ßig (wenigstens halbjährlich) und diskutiert den Über die zu fördernden Kleinstprojekte ent-
Stand der Umsetzung. Zwischen den zuständigen scheidet das Projektteam. Über die Projekte mit
Fachabteilungen und dem Begleitgremium finden größerem Volumen und die Projekte der Stadt-
regelmäßige offene Reflexionsgespräche statt, verwaltung hat das LIP 2.0 Begleitgremium ein
über die auch die Öffentlichkeit informiert wird. Vorschlagsrecht. Die letztendliche Entscheidung
obliegt den Ausschüssen der Landeshauptstadt
Wirksamkeitsanalysen Hannover.
Für ausgewählte Maßnahmen aus dem Feld der
übergreifenden Priorisierungen werden darüber
hinaus wissenschaftlich begleitete Wirksamkeits-
analysen angesetzt. In die Auswahl kommen die
Empfehlungen des Begleitgremiums, über die der
Internationale Ausschuss entscheidet.
11Übergreifende 1
Priorisierungen
Wir fördern konsequent Maßnahmen,
die der Etablierung einer Kultur der Wert-
schätzung und Sichtbarkeit von Vielfalt
Die gleichberechtigte Teilhabe aller Hannovera- dienen und gegen Diskriminierung in der
ner*innen am (stadt-) gesellschaftlichen Leben Einwanderungsstadt wirken
erfordert sowohl breit aufgestellte Akteur*innen
und Maßnahmen als auch eine Fokussierung auf
die drängendsten Themen. Entsprechend werden Alle Menschen in Hannover sollen in der Lage
auch gezielt Maßnahmen für einzelne Diskrimi- sein, ihre Individualität ohne Angst vor Diskri-
nierungsdimensionen entwickelt. Wir wollen die minierung zu leben. Die Maßnahmen des LIP 2.0
Zukunft der vielfältigen Stadtgesellschaft konst- sind entsprechend den Ansätzen des Allgemeinen
ruktiv gestalten und die Weichen stellen für mehr Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) darauf aus-
gesellschaftlichen Zusammenhalt und gegen so- gerichtet, dass Diskriminierungen aufgrund des
ziale Polarisierung. Geschlechts, der vermeintlichen ethnischen Her-
kunft oder der Hautfarbe, des Alters, der Behin-
Gesellschaftlicher Zusammenhalt lässt sich an- derung, der Religion oder Weltanschauung und
hand von mehreren Dimensionen beschreiben, der sexuellen Orientierung verhindert oder wo
die sich aufeinander beziehen. Werte wie soziale möglich aktiv beseitigt werden. Ein besonderes
Gerechtigkeit, Wertschätzung von Diversität so- Augenmerk liegt dabei auch auf den Verschrän-
wie Zufriedenheit mit der sozioökonomischen Si- kungen dieser Dimensionen zu Mehrfachdiskrimi-
tuation sind dabei Bedingungen, die die Möglich- nierungen und auf strukturellen Diskriminierun-
keit schaffen, sich mit einer größeren Community, gen.
sei es die Nachbarschaft oder die gesamte Stadt,
solidarisch zu identifizieren. Aus der Verbindung
der Bedingungen entsteht die Möglichkeit, am
gesellschaftlichen und politischen Leben teilzu-
haben sowie Debatten und Gesellschaft aktiv und
sichtbar zu gestalten. Eine solche Beteiligungs-
möglichkeit ist in der Realität für Eingewanderte
und ihre Nachkommen, aber auch für viele ande-
re Gruppen in der Stadtgesellschaft, nicht immer
selbstverständlich.
Deshalb wollen wir zur gleichberechtigten Teil-
habe und zum gesellschaftlichen Zusammenhalt
beitragen, indem wir im LIP 2.0 zwei übergeord-
nete Prioritäten setzen.
122
Wir fördern die Öffnung und Durchlässig-
keit gesellschaftlicher Institutionen für alle
Menschen in der Einwanderungsstadt
In den zentralen gesellschaftlichen Lebensberei-
chen wie Bildung, Arbeit, Kultur, Politik, Gesund-
heit, Sport, Wohnen oder Digitalisierung muss für
alle Menschen in Hannover die selbstverständli-
che Möglichkeit zur freien Entfaltung, Beteiligung
und gestaltenden Einflussnahme gegeben sein.
Deshalb muss nicht nur allen der gleiche Zugang
zu gesellschaftlichen Ressourcen, Dienstleistun-
gen, Positionen und Aufstiegschancen ermöglicht
werden, sondern es müssen auch alle Angebote
von gesellschaftlichen Institutionen der Vielfalt
der Stadtgesellschaft Rechnung tragen, damit sie
allen in gleicher Qualität zur Verfügung stehen.
13Handlungsfelder und Anerkennung und Förderung von Diversität
Querschnittsthemen Wir begreifen Diversität als gesellschaftliches Po-
tenzial. In einer pluralen Stadtgesellschaft ist die
sichtbare Vielfalt von Lebensstilen die Normali-
tät – und sie ist ausdrücklich erwünscht. Deshalb
Das Werkzeug des LIP 2.0 sind konkrete Maßnah- muss die Arbeit an dem Thema aufgewertet und
men, mit denen wir das Ziel der gleichberechtig- in der Öffentlichkeit präsenter werden. Struktu-
ten Teilhabe aller am gesellschaftlichen Leben er- ren und Prozesse innerhalb und außerhalb der
reichen wollen. Die Maßnahmen verteilen sich auf Verwaltung müssen unter Aspekten der Diversität
die sechs Handlungsfelder Bildung, Soziales, De- überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.
mokratie, Stadtleben und Kultur, Wirtschaft so-
wie Stadtverwaltung und interkulturelle Öffnung. Zielgruppenorientierte Kommunikation und
Für die Entwicklung und Umsetzung der Maßnah- Konzeption
men setzen wir drei Querschnittsthemen. Diese Damit Angebote und Maßnahmen möglichst viele
werden bei jeder Maßnahme bedacht und sollen Menschen erreichen, sollten die dazu benutz-
sicherstellen, dass die Maßnahmen dem Ziel des ten Medien und Sprachen neben Deutsch auch
LIP 2.0 dienlich sind. auf die jeweilige Zielgruppe zugeschnitten sein.
Durch einen zielgruppenorientierten Einsatz di-
Gleichbehandlung gitaler Medien können Sprachbarrieren abgebaut
Die Landeshauptstadt Hannover ist der Umset- und Informationen und Angebote passgenau
zung des in der Verfassung verankerten Gleichbe- gestaltet werden, um Zugänge zu erleichtern.
handlungsgrundsatzes verpflichtet. Chancenge- So muss bei der Entwicklung von Informationen
rechtigkeit und Diskriminierungsschutz gehören und Angeboten auch stets geprüft werden, ob
zu den wesentlichen Grundlagen einer demokra- neu Eingewanderte einbezogen sind.
tischen Gesellschaft. Diskriminierungen finden
auf individueller, struktureller und institutioneller
Ebene statt und haben zur Folge, dass den Be-
troffenen die gleichberechtigte Teilhabe in allen
Bereichen des Stadtlebens erschwert oder gar
verweigert wird. Über die sechs Dimensionen des
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes und ihre
Verschränkungen zu Mehrfachdiskriminierungen
hinaus sollen mit dem LIP 2.0 Benachteiligungen
zum Beispiel aufgrund des sozioökonomischen
Status verhindert werden.
14Soziales
Bildung
Demokratie
Stadtverwaltung
und interkulturelle
Öffnung
Stadtleben
und Kultur
Wirtschaft
15Handlungsfeld Bildung
Bildung ist ein lebenslanger Prozess, der formal, Hierfür werden vier Unterthemen entlang der
institutionell und sehr strukturiert ablaufen kann idealtypischen Bildungsbiografie identifiziert und
– gerade, wenn die aufeinander aufbauenden und mit inhaltlich und formal übergreifenden Schwer-
die Biografie prägende schulische abschlussbe- punkten kombiniert. (siehe Grafik)
zogene Bildung betrachtet wird. Gleichzeitig ist
Bildung auch immer ein informelles, nichtinsti- Unabhängig davon entwickelt die LIP AG Jugend
tutionelles, zum Teil unbewusstes Lernen – hier- ebenfalls Maßnahmen zu den Bereichen informel-
bei kommt außerschulischen Lernorten eine be- le Bildung und Antidiskriminierung.
sondere Rolle zu. Bildung ist eine der wichtigsten
Voraussetzungen für die individuelle Entfaltung,
die ökonomische Wettbewerbsfähigkeit, den so-
zialen Zusammenhalt und die aktive Teilhabe in
einer Gesellschaft. Die Herausforderungen liegen
in den Übergängen von einer Institution zur an-
dern, da oftmals bescheinigte Zugangsvorausset-
zungen erfüllt sein müssen. Gleichzeitig sind viele
Bildungsmöglichkeiten an ein bestimmtes Alter
gekoppelt. Es gibt keine gleichen Bildungschan-
cen für alle, solange beispielsweise Herkunft und
der Bildungsstand der Eltern prägend sind.
Das Handlungsfeld Bildung setzt sich zum Ziel
– im Rahmen der kommunalen Möglichkeiten –
Hindernisse zu beseitigen und Angebote im Sinne
der vielfältigen Gesellschaft von heute zu erarbei-
ten.
16Soziales
Bildung
Unterthemen
entlang der Bildungsbiografie Schwerpunkte
Demokrat
1. Frühkindliche Bildung/ 1. Sprachbildung und Alphabetisierung/
Elementarbildung Mehrsprachigkeit
Stadtverwaltung
2. Kinder und Jugendbildung
2. Zugänge zu Bildungsangeboten
und interkulturelle
3. Übergänge im Bildungssystem und
Öffnung
3. Ausbildung und Studium
aus dem Bildungssystem heraus
4. Übergreifende Bildungsangebote/
• Duale Ausbildung Informelle Bildung
• Internationalisierung an Hochschulen
• Konkrete Bildungsinhalte wie bspw.
Umweltbildung, politische Bildung,
4. Erwachsenenbildung
Gesundheitsbildung, offene Kinder-
und Jugendarbeit
• Inklusive berufliche und
ehrenamtliche Qualifikationen 5. Digitalisierung und kritische Stadtleben
•
•
Angebote für Senior*innen
Familienbildung
Medienkompetenz
und Kultur
6. Antidiskriminierungsarbeit und
Gewaltprävention im Bildungskontext
• Rassismuskritische und antisemitismus-
Wirtschaft kritische Bildungsarbeit
17Handlungsfeld Soziales 2. Besondere soziale Lagen und Armut
Wir setzen uns dafür ein, dass Menschenwürde
und Menschenrechte als Grundlage aller Anstren-
Gleichberechtigte Teilhabe und Zugänge zu Res- gungen zur Überwindung sozialer Schwierigkei-
sourcen sind wichtige Voraussetzungen für eine ten, Armut und Wohnungslosigkeit sind. Durch
aktive Gestaltung des eigenen Lebens und die Abbau von Barrieren und Präventionsmaßnahmen
Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. sollen gleichberechtigte Zugänge geschaffen
Wer in Hannover lebt, muss an dieser Stadtge- (Chancengleichheit) und Armutsrisiken vermin-
sellschaft teilhaben können: muss Zugang zu dert werden.
Informationen und soziale Kontakte haben, von
ihren Bildungseinrichtungen profitieren, von ih- 3. Gesundheit
ren kulturellen Angeboten angesprochen werden, Als zentraler Bereich des täglichen Lebens müs-
in ihren Arbeitsmarkt integriert sein, von ihren sen Gesundheit und die Chancenwahrnehmung
Behörden unterstützt werden sowie selbstbe- zur Gesunderhaltung allen zugänglich sein.
stimmt die eigenen Interessen vertreten können. Dazu bedarf es der Orientierung an Ziel- und
Informationsdefiziten, sozialer Ausgrenzung, Un- Altersgruppen und die Berücksichtigung (sozio-
gleichheiten und Zugangsbarrieren werden Ak- ökonomischer) Lebenslagen, individueller Le-
tivierung / Empowerment, Beteiligung und der benserfahrungen (Kriegs-, Flucht-, Gewalt- und
gleichberechtigte Zugang zu gesellschaftlichen Diskriminierungserfahrungen) und Bedürfnisse
Ressourcen entgegengestellt. oder aufenthaltsrechtlicher Bestimmungen, um
eine bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung für
Das Handlungsfeld gliedert sich in sechs Unter- alle zu gewährleisten.
themen.
4. Pflege
1. Zusammenleben im Quartier Stationäre Pflegeeinrichtungen und ambulante
Hannovers Quartiere sind wichtige Dreh- und An- Dienstleister*innen müssen sich auf die schon
gelpunkte des städtischen Zusammenlebens. Hier bestehenden und weiter zunehmenden Heraus-
treffen Menschen mit verschiedenen Hintergrün- forderungen einer vielfältigeren Klientel aus-
den und in verschiedenen Lebenslagen aufeinan- reichend vorbereiten und konkrete Maßnahmen
der. Diese Diversität erkennt das Handlungsfeld ergreifen, um den Pflegebereich weiter interkul-
Soziales als Herausforderung und Chance und turell zu öffnen und einen kultursensiblen sowie
setzt sich für eine positive Quartiersentwicklung diskriminierungsfreien Umgang mit Pflegebe-
ein. Das bedeutet zum einen, eine gute Lebens- dürftigen zu etablieren.
qualität für alle Bewohner*innen zu sichern und
zum anderen, die individuelle Entfaltung ihrer 5. Wohnen
Potentiale durch die Ermöglichung einer aktiven Das Recht auf Wohnen ist ein Menschenrecht, das
Mitgestaltung ihres unmittelbaren Umfeldes zu wir als Basis des sozialen Lebens sehen.
fördern.
186. Gesellschaftliches Engagement
Gesellschaftliches Engagement und die damit
verknüpfte Partizipation aller in Hannover le-
benden Menschen sind ein wichtiger Bestandteil
unserer Demokratie. Als wesentliche Ausdrucks-
form aktiver, selbstbestimmter Teilhabe muss
der Zugang zu gesellschaftlichem Engagement
allen Stadtbewohner*innen offenstehen. Dazu
sind eine nach Zielgruppen differenzierte Enga-
gementförderung, Anreize und Zugangswege nö-
tig, die diverse sozioökonomische Lebenslagen,
individuelle Lebenserfahrungen und Bedürfnisse
berücksichtigen.
Gesellschaftliches
Engagement
Soziales
Wohnen
g Pflege
Zusammenleben
im Quartier
Gesundheit
Besondere soziale
Lagen und Armut
Demokratie
rwaltung
rkulturelle
19Handlungsfeld Demokratie 3. Förderung der Demokratie- und
Menschenrechtsbildung
Es soll durch die Stärkung der demokratischen
Dem Themenfeld Demokratie geht es um die und menschenrechtlichen Grundwerte das solida-
Möglichkeit der aktiven Teilhabe an politischen rische, friedliche Miteinander in der Gesellschaft
Prozessen und die konsequente Anwendung hu- befördert und eine „Kultur der demokratischen
manistischer und menschenrechtlicher Prinzipi- Rechte und Menschenrechte“ gepflegt und prakti-
en. ziert werden. Das geschieht über die Vermittlung
von Wissen, den Zugang zu Räumen, in denen
Das Handlungsfeld Demokratie teilt sich in vier diese Kultur erprobt und ausgehandelt werden
Unterthemen auf. kann und über spezifische Weiterbildungsange-
bote für Multiplikator*innen im Sinne einer „Edu-
1. Antirassismus und Antidiskriminierung cation for Citizenship / Civic Education“. Damit
Der LIP 2.0 entwickelt Maßnahmen und Präven- demokratische Grundwerte möglichst von der
tionsangebote, um ein stärkeres Bewusstsein für gesamten Stadtgesellschaft mitgetragen werden,
Rassismus als gesamtgesellschaftliches Phäno- müssen auch Maßnahmen entwickelt werden, die
men zu schaffen und institutionellen sowie struk- dem ideologischen Einfluss nicht-demokratisch
turellen Rassismus abzubauen. Desgleichen wer- handelnder Staaten und Organisationen auf han-
den Maßnahmen entwickelt, die Betroffene von noversche Einwohner*innen entgegenwirken.
rassistischer und rechter Gewalt schützen und
stärken. Die Landeshauptstadt Hannover setzt ihr 4. Sicherheit und Sicherheitsgefühl
Engagement gegen jede Form von Diskriminie- Die Landeshauptstadt Hannover bekennt sich zu
rung fort. Sie beteiligt sich aktiv an der Bekämp- ihrer Verantwortung gegenüber allen Menschen,
fung von Rechtsextremismus jeglicher Art. die Angst um ihre körperliche und psychische Un-
versehrtheit haben müssen, oder durch repres-
2. Politische Beteiligung und freiwilliges sive Staaten und Organisationen politisch ver-
politisches Engagement folgt werden und bietet diesen Menschen einen
Ohne freiwilliges Engagement würde unserer Schutzraum. Auch die zunehmenden Ausgrenzun-
Stadtgesellschaft ein zentrales Bindeglied im kul- gen und Anfeindungen im Internet stellen eine
turellen, politischen und sozialen Leben fehlen. Bedrohung für das friedliche Zusammenleben
Hier bleibt im Blick, dass es einen Wandel hin zu und das Sicherheitsgefühl der Betroffenen dar.
eher bewegungsförmigen Initiativen gibt, die vor Auch solchen Vorfällen muss entgegengewirkt
allem über soziale Medien geteilt werden. Beson- werden. Das grundsätzliche Vertrauen in die Si-
dere Beachtung erfahren Jugendliche und junge cherheitsbehörden soll erhöht und stabilisiert
Erwachsene sowie generationsübergreifende Pro- werden – dazu gehört auch die Bekämpfung von
jekte und die Interessenvertretungen verschie- institutionellem Rassismus innerhalb der Sicher-
dener migrantischer Gruppen. Es wird auf eine heitsbehörden. Ausnahmslos alle Menschen in
Stärkung aktiver und passiver politischer Teilha- Hannover sollen sicher und frei von Befürchtun-
be gesetzt, auch im Kontext des Wahlrechts. Die gen bezüglich ihrer körperlichen und psychischen
Arbeit und die Möglichkeiten der Integrationsbei- Unversehrtheit in unserer Stadt leben und sich
räte sind hierbei ein Schwerpunktthema. frei entfalten können.
20Soziales
Sicherheit und
Antirassismus und
ng Antidiskriminierung
Sicherheitsgefühl
Demokratie
rwaltung
erkulturelle Förderung der Demokratie-
und Menschenrechtsbildung
g Politische Beteiligung
und freiwilliges politisches
Engagement
Stadtleben
und Kultur
schaft
21Handlungsfeld Stadtleben Das Handlungsfeld gliedert sich in sieben Unter-
und Kultur themen mit eigenen Schwerpunkten:
1. Capacity Building und Förderstrukturen
• Zielgruppen des LIP 2.0 motivieren, die
Das Handlungsfeld Stadtleben und Kultur will Zu- Stadtgesellschaft mitzuprägen und ihre
gänge zu Kunst und Kultur, Sport, Bildung und Be- Talente fördern
gegnung öffnen und hier den Dialog fördern. Da- • Kulturelle (Kinder- und Jugend-) Bildung mit
für setzt es dort an, wo Menschen sich begegnen: migrantischen Vorbildern vernetzen
In der Nachbarschaft, im Stadtteil, in Kultur und • Qualifizierung von Multiplikator*innen
Sport sowie an Orten religiöser Gemeinschaften. • Barrierefreie finanzielle Förderung
Diese Orte sind dabei nicht getrennt zu betrach-
ten. Es gilt Schnittstellen zwischen ihnen zu defi- 2. Mitwirkung an der Ausgestaltung des
nieren und Synergien zu nutzen – auch zwischen Kulturentwicklungsplans (KEP) aus der
den Handlungsfeldern und Unterthemen des LIP Perspektive von Eingewanderten und
2.0. ihren Kindern
• Mitgestaltung der Umsetzung von Zielen,
Um gleichberechtigte Teilhabe zu fördern, muss Maßnahmen und Modellprojekten des KEP
die (sozio-) kulturelle, sportliche und religiöse
Vielfalt der Menschen in Hannover sichtbar ge- 3. Inter- und transkultureller Dialog der
macht werden – in Medien, Politik und Verwaltung Weltanschauungen und Religionen
sowie in Gremien, in Familien- und Jugendzent- • Transkulturelle Dialoge anstoßen, führen und
ren, Vereinen, Verbänden und Bildungseinrichtun- vernetzen
gen. Gerade junge Menschen und Nachkommen • Interreligiöse Dialoge fördern und inter-
von Eingewanderten sowie die Transkulturen, die religiöse Kompetenz vermitteln
sie entwickeln, – also die Vermischung verschie-
dener subkultureller Einflüsse zu neuen Lebens- 4. Medienrepräsentation und Kommunika-
stilen und Ausdrucksformen – müssen stärker in tionsstrategie
den Blick rücken. Wichtig ist auch die Ansprache • Medienkompetenz fördern
und Förderung von Menschen, die nicht in Ver- • Möglichkeiten der Beteiligung transparent
einen oder anderen Interessenvertretungen or- machen
ganisiert sind. Die Maßnahmen des Handlungsfel- • (Mediale) Öffentlichkeit ermöglichen
des schaffen in den unterschiedlichen Bereichen
Identifikationsmöglichkeiten für Eingewanderte 5. Produktive Orte der Vielfalt
und ihre Nachkommen. • Zugänge zu und Gestaltung von formalen
sowie informellen alten und neuen Begeg-
nungsorten
22Bildung
6. Sport machen – Bewegung ermöglichen
• Bedarfe der Zielgruppen des LIP 2.0 ermitteln,
um die Sportaktivität zu steigern
Demokratie
• Neue Formate für die Nutzung von Sport-
anlagen unter besonderer Berücksichtigung
der Belang von Eingewanderten und ihren
Kindern
• Informeller Sport
• Bildung und Qualifizierung im und durch Sport
Stadtverwaltung
und interkulturelle
Öffnung
Capacity Building und
Förderstrukturen
Mitwirkung an der
Ausgestaltung des
Kulturentwicklungs-
plans (KEP) aus der Stadtleben
Perspektive von
Eingewanderten und Kultur
und ihren Kindern
Wirtschaft
Inter- und transkultureller Sport machen –
Dialog der Weltanschauungen Bewegung ermöglichen
und Religionen
Produktive Orte
der Vielfalt
Medienrepräsentation und
Kommunikationsstrategie
23Handlungsfeld Wirtschaft
Die hannoversche Wirtschaft ist ein wichtiger Das Handlungsfeld Wirtschaft gliedert sich in fol-
Faktor, wenn es um Migration und Teilhabe geht. gende vier Unterthemen, die teils eigene
Nur wer existenziell abgesichert ist, hat Kapazi- Schwerpunkte setzen:
täten, sich in das gesellschaftliche Leben der
Stadt einzubringen und dieses mit zu gestalten 1. Lokale Ökonomie
und zu prägen. Das integrative Potenzial des breit • Unternehmerische Vielfalt und neue Koopera-
aufgestellten Feldes „Wirtschaft“ endet aber tionen im Stadtteil
nicht bei der Arbeitsmarktintegration. Vielmehr
bietet sich die Chance, gerade über das eigene 2. Existenzgründung und Unternehmer*
Unternehmen oder den eigenen Arbeitsplatz, die innentum
Stadtgesellschaft inter- und transkulturell zu be- • Unterstützende Angebote bekannter machen,
reichern. Wirtschaftliche und unternehmerische Ansprachen zielgruppenspezifisch gestalten
Erfolgsgeschichten aus den Zielgruppen des LIP • Sichtbarkeit der Vielfalt des Unternehmer*
2.0 zeigen außerdem explizit, wie sehr die Vielfalt innentums
der Stadtgesellschaft auch die Wirtschaft berei- • Bereicherung des Wirtschaftsstandortes
chert und umgekehrt. Das Herausstellen solcher Hannover durch spezifische Stärken der Ziel-
Geschichten und ihrer Protagonisten macht den gruppen des LIP 2.0
gesellschaftlichen Fortschritt durch Vielfalt sicht-
bar und schafft Vorbilder. Dies zeigt auch, dass 3. Arbeitsmarktintegration
Arbeitgeber*innen, die Vielfalt in ihren Betrieben (Ausbildungsförderung, Qualifizierung,
zulassen und leben von Bedeutung sind. Beschäftigungsförderung)
• Kompetenzförderung in allen Bereichen
Eine wichtige Rolle dabei spielen digitale wie • Frauenförderung
analoge Netzwerke, die Zugänge in die Gesell-
schaft bereitstellen und Gestaltungsräume öff- 4. Internationalisierung
nen. Will der wirtschaftliche Sektor seinen Teil • Weiterentwicklung der internationalen Koope-
zur gleichberechtigten Teilhabe beitragen, muss rationen der Stadt unter Beteiligung lokaler
er außerdem eine eigene Willkommenskultur mit Akteur*innen
entsprechenden Förderstrukturen in Hannover
etablieren. Sei es, um einzelnen Arbeitnehmer*
innen das Ankommen in einer neuen Stadt zu
erleichtern, oder um transnationale Unterneh-
mer*innen an den Standort zu binden.
24Demokratie
Stadtverwaltung
und interkulturelle
Öffnung
Existenzgründung und
Unternehmer*innentum
Arbeitsmarktintegration
(Ausbildungsförderung,
Lokale Ökonomie
Qualifizierung,
Beschäftigungsförderung)
Stadtleben
und Kultur
Wirtschaft Internationalisierung
25Handlungsfeld sonalwirtschaft“ spielt daher auch der Bereich
Stadtverwaltung und „Fort- und Weiterbildung“ bei der Bearbeitung
der ersten Aufgabe eine Rolle.
interkulturelle Öffnung
Ziel der zweiten Aufgabenstellung ist die konse-
quente Umsetzung des Verfassungsgrundsatzes
der Gleichbehandlung. Diese Aufgabe soll mit
Für die Fortführung der Umsetzung der Interkul- dem LIP 2.0 verstärkt angegangen werden, um
turellen Öffnung der Stadtverwaltung stellen sich dem Ziel einer diskriminierungsfrei arbeitenden
nach wie vor zwei Hauptaufgaben: Verwaltung näher zu kommen. Deshalb wird im
Arbeitsbereich „interkulturelle Organisationsent-
Die Zusammensetzung der Stadtgesell- wicklung“ ein besonderer Schwerpunkt gesetzt,
schaft in der Belegschaft der Stadtverwal- denn Ziel der interkulturellen Organisationsent-
tung zu spiegeln. (Schwerpunkt 1) wicklung ist es gerade, Verwaltungsstrukturen
und -abläufe sowie den Einsatz von Ressourcen
Die städtischen Dienstleistungen für alle so zu verändern und zu optimieren, dass die Ver-
Menschen in Hannover in gleicher Qualität waltung ihre Dienstleistungen für alle Menschen
zu erbringen. (Schwerpunkt 2) in der Stadt in gleicher Qualität erbringen kann.
Fortbildungen für die Beschäftigten sind ein wei-
Bei der ersten Aufgabe geht es zentral um die teres Instrument auf diesem Weg, wie auch die
Realisierung eines Aspektes von Chancengerech- Beschäftigung mit dem neuen Arbeitsbereich
tigkeit für alle Menschen, die in Hannover leben „Mehrsprachigkeit, Sprachmittlung, Übersetzun-
und arbeiten. Sie alle müssen gleichen Zugang gen“, das der Verwaltung einen noch proaktive-
zu den Arbeitsplätzen und Karrierechancen in der ren Umgang mit der einwanderungsbedingten
Stadtverwaltung erhalten. Hierfür wurde in der Sprachenvielfalt ermöglichen soll.
ersten Umsetzungsperiode des LIP bereits eine
gute Basis gelegt, hierauf aufbauend stehen nun Das gesamte Handlungsfeld Stadtverwaltung und
die nächsten Schritte an. interkulturelle Öffnung gliedert sich somit in die
folgenden fünf Unterthemen:
Mittel- und langfristig entscheidet sich die Zu-
sammensetzung der städtischen Beschäftigten- 1. Ausbildung
struktur mit dem Zugang zu den städtischen
Ausbildungsplätzen und mit den Strategien der 2. Fort- und Weiterbildung
Personalgewinnung und -bindung, die die Stadt-
verwaltung einsetzt. Aber auch die bereits vor- 3. Personalwirtschaft
handene Belegschaft kann sich durch die Instru-
mente interner Qualifizierung weiterentwickeln, 4. Interkulturelle Organisationsentwicklung
um Beschäftigte mit Migrationsbiografie in Ge-
haltsgruppen zu bringen, in denen sie bislang 5. Mehrsprachigkeit/Sprachmittlung/
noch unterrepräsentiert sind. Neben den vorran- Übersetzungen
gigen Arbeitsbereichen „Ausbildung“ und „Per-
26Demok
Stadtverwaltung
und interkulturelle
Öffnung
Ausbildung
Stadtl
Fort- und Weiterbildung und Ku
Interkulturelle
Organisationsentwicklung
Wirtschaft
Personalwirtschaft Mehrsprachigkeit/
Sprachmittlung/
Übersetzungen
27Unsere Vision:
Wir halten zusammen
Die Leitlinien und Ziele, die Voraussetzungen
und Rahmenbedingungen für die Umsetzung, die
Priorisierungen und vor allem die konkreten Maß-
nahmen und Schwerpunktsetzungen sind die Ins-
trumente, mit denen wir eine gemeinsame Vision
verwirklichen wollen:
Unsere Vision ist eine Stadtgesellschaft, in
der ein respekt- und vertrauensvolles Zu-
sammenleben in Verbundenheit und die
Gleichberechtigung aller Menschen selbst-
verständlich sind. Jegliche Form von Diskri-
minierung hat in Hannover keinen Platz. Alle
Hannoveraner*innen können jederzeit und
fraglos Teil des „Wir“ sein. Denn Vielfalt ist
unsere Stärke.
28SIND HANNOVER
HALTEN ZUSAMMEN
Zusammenleben in der Stadt
29Anhang
Liste der Mitglieder der Lenkungsgruppe
Fachbereich/Organisation Name
Büro OB Sven Krüger
FB Personal und Organisation Helga Diers
FB Wirtschaft Kay de Cassan
FB Öffentliche Ordnung Angela Rühmann / Dr. Tim Brockmann
FB Schule Stefan Rauhaus
FB Kultur Dr. Thomas Schwark / Gitta Weymann
FB VHS Jacqueline Knaubert-Lang
FB Soziales Claudia Ruhrort
FB Jugend und Familie Marcus Belitz
FB Sport und Bäder Heike Rudolph
FB Senioren Eike Erdmann
FB Planen und Stadtentwicklung Astrid Malkus-Wittenberg
Arbeitgeberverbände Christian Budde, ab 1.11.2020 N.N.
Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege Gabriele Schuppe
(AGW)
Deutscher Gewerkschaftsbund Hannover Nico Lopopolo
Handwerkskammer Hannover Dr. Carl-Michael Vogt
Rat der Religionen Ali Faridi
Industrie- und Handelskammer Hannover Jörg Mahnke
Integrationsbeiräte Delegiertenkonferenz Christine Jochem
JobCenter Region Hannover Michael Stier
MiSO Netzwerk Hannover e.V. Dr. Peyman Javaher-Haghighi
Region Hannover Resa Deilami
Oduduwa Movement e.V. Abayomi Bankole
Bangladesh Shamiti e.V. Mahjabin Ahmed
30Sie können auch lesen