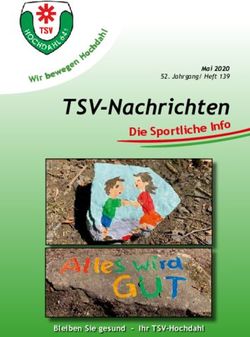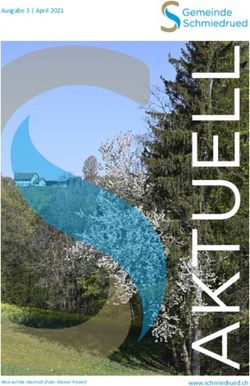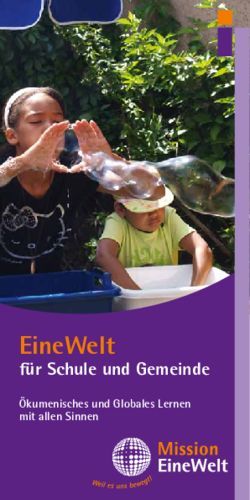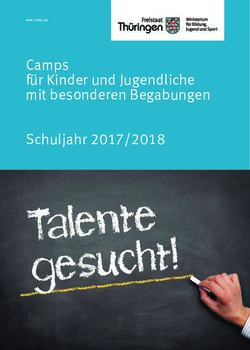"Stromlos ist viel los!" - Ein proaktiver Umgang mit dem Blackout-Risiko - KPH Wien/Krems
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
„Stromlos ist viel los!“ – Ein proaktiver
Umgang mit dem Blackout-Risiko
“Lots of Action without Electricity!” – A Proactive Handling of
the Blackout Risk
Theresia Ines Herbst & Herbert Saurugg
Positive Psychologie und Resilienz
Zusammenfassung 1. Einleitung
Ein europaweiter Strom-, Infrastruktur- sowie Versor- Dieser Beitrag steht im Konjunktiv, d. h. er befasst sich
gungsausfall („Blackout“) ist aufgrund unterschiedlicher mit dem Möglichen. Die menschliche Vorstellungskraft
Entwicklungen ein realistisches Szenario, dessen Eintritts- kann zeitliche und räumliche Grenzen überschreiten und
wahrscheinlichkeit zunimmt. Im Rahmen einer proaktiven daraus Erkenntnisse gewinnen, somit wäre es ein unge-
Blackout-Vorsorge werden die möglichen Folgen gedanklich nütztes Potenzial, rückblickendes und vorausschauen-
vorweggenommen und entsprechende – auch psychologische des Denken nicht zu nützen. Die Geschichte zeigt, dass
– Vorsorgehandlungen angeregt, um die Schadwirkung zu verheerende Katastrophen, wie der Erste und Zweite
minimieren. Dabei werden einerseits die besondere Situation Weltkrieg, in unserer Gesellschaft bis in die Gegenwart
der HelferInnen und Minderjährigen beleuchtet und ande- hinein somatische, seelische und soziale Spuren hin-
rerseits Grundüberlegungen zur Förderung der Resilienz terlassen können, auch Psychotraumata, die transgene-
durch Teamarbeit, Nachbarschaftshilfe, Kommunikation, rational weitergegeben und häufig erst von der dritten
Kinderbücher u. a. in Familien und Bildungseinrichtungen Generation in der notwendigen Distanz bearbeitet und
angestellt. integriert werden. Fragmente einer diffusen Erinnerung
und eines oft sprachlosen Leids müssen dabei in einem
schwierigen Prozess zusammengeführt und in die Per-
sönlichkeitsstruktur und Familienbiographie integriert
Abstract werden (Möller et al., 2012; Appelfeld, 2018). Ein groß-
räumiger Blackout könnte eine vergleichbare Zerstö-
rungskraft für die Zivilisation eines hochentwickelten
Due to various developments, a Europe-wide power, infra- Industrielandes wie z. B. Österreich, Deutschland und
structure, and supply breakdown (“blackout”) is a realistic die Schweiz besitzen, vor allem dann, wenn diese völlig
scenario whose probability of occurrence is increasing. Within unvorbereitet getroffen würde. Die Auseinandersetzung
the framework of proactive blackout preparedness, the possi- mit einem europaweiten Strom-, Infrastruktur- sowie
ble consequences are anticipated mentally and appropriate Versorgungsausfall („Blackout“) erfordert Bedacht und
– also psychological – precautionary actions are suggested in Sensibilität in den sprachlichen Formulierungen und in
order to minimise the damaging effects. On the one hand, the der Planung und Durchführung konkreter Handlungen,
special situation of first responders and minors is highlighted denn sie ist unangenehmen, für manche sehr beängsti-
and, on the other hand, basic considerations for promoting gend und könnte auch – verständliche, aber möglicher-
resilience through teamwork, community support, commu- weise kurzsichtige – Reaktanz- und Vermeidungsphä-
nication, children’s books, etc. in families and educational nomene provozieren. Dieser Beitrag steht für einen
institutions are made. proaktiven Umgangs mit dem Blackout-Risiko. Proaktiv
bedeutet, durch differenzierte Vorausplanung und ziel-
gerichtetes Handeln die Entwicklung eines Geschehens
selbst zu bestimmen und eine Situation herbeizuführen
(https://www.duden.de/rechtschreibung/proaktiv). Er
möchte zur wohlüberlegten (Selbst-)Vorsorge anregen,
54 Psychologie in Österreich 1 | 2022Theresia Ines Herbst & Herbert Saurugg
„Stromlos ist viel los!“ – Ein proaktiver Umgang mit dem Blackout-Risiko
die Selbstwirksamkeit stärken und der Prävention ver- Infrastrukturen und somit zum Zusammenbruch der
meidbarer Schäden dienen. Versorgung mit lebenswichtigen Gütern und Dienstlei-
stungen. Die Anschaffung und die Bereithaltung eines
Notstromaggregates greifen somit zu kurz. Die wirkliche
Krise würde erst beginnen, nachdem der Strom wieder
2. Ein Blackout als großräumiger Strom-, fließt und würde die Versorgung betreffen, die wahr-
Infrastruktur- und Versorgungsausfall scheinlich länger nicht funktioniert. Es sind daher drei
wesentliche Phasen zu beachten (Energiezelle-F, 2019):
In der Öffentlichkeit wird zunehmend häufiger von einem Abb. 1: 3 Phasen eines Blackout, Quelle: Energiezelle-F, 2019
möglichen Blackout gesprochen und berichtet. Dabei
wird meist ein größerer regionaler Stromausfall themati-
siert. Ein überregionales Ereignis führt jedoch nicht nur
zu einem weite Teile Europas betreffenden Stromausfall,
sondern löst einen weitreichenden und deutlich länger
andauernden Infrastruktur- und Versorgungsausfall aus.
Ein Blackout wäre ein Ereignis, das es in Europa in dieser
Dimension noch nicht gab und daher für viele Menschen
und auch EntscheidungsträgerInnen kaum vorstellbar
ist. Daher werden die Eintrittswahrscheinlichkeit und Phase 1: Phase 1 wäre durch einen totalen bis weitge-
die potenziellen Auswirkungen massiv unterschätzt. henden Strom- und Infrastrukturausfall bestimmt, wel-
Gleichzeitig erwarten die Österreichische Gesellschaft cher je nach Region Stunden bis Tage dauern könnte.
für Krisenvorsorge (GfKV) oder das Österreichische Bun- Für Österreich wäre ein Ausfall der Stromversorgung
desheer (BMLV, 2021) ein solches Szenario binnen der für rund 24 Stunden zu erwarten, wenngleich an man-
nächsten fünf Jahre, in diesem zeitlichen Horizont eher chen Orten die regionale Stromversorgung teilweise frü-
früher als später. her wiederhergestellt werden könnte. Durch Infrastruk-
Das Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deut- turschäden könnte diese Phase 1 auch regional länger
schen Bundestag kam dazu bereits vor über 10 Jahren zu dauern, daher sollte immer ein Sicherheitspuffer einge-
verheerenden Erkenntnissen: „Spätestens am Ende der plant werden. Auf europäischer Ebene wäre mit zumin-
ersten Woche wäre eine Katastrophe zu erwarten, d. h. dest einer Woche zu rechnen, bis die Stromversorgung
die gesundheitliche Schädigung bzw. der Tod sehr vieler wieder überall stabil funktionieren würde. Bis dahin
Menschen sowie eine mit lokal bzw. regional verfügbaren könnte es jederzeit zu Rückschlägen kommen. Andere
Mitteln und personellen Kapazitäten nicht mehr zu bewäl- Sektoren und Infrastrukturen sollten erst dann wieder
tigende Problemlage.“ (TAB, 2010) Im letzten Jahrzehnt ha- hochgefahren werden, wenn klar kommuniziert wurde,
ben sich die gesellschaftlichen Abhängigkeiten von funk- dass das europäische Verbundsystem wieder ausrei-
tionierenden Versorgungsinfrastrukturen noch deutlich chend stabil und sicher funktionierte und dass keine
erhöht. Gleichzeitig waren bei der Vorsorge und Bewälti- unmittelbaren weiteren Ausfälle zu erwarten wären, an-
gungsfähigkeit kaum Fortschritte zu beobachten, wurde dernfalls drohten schwerwiegende Infrastrukturschäden.
das Szenario doch weitgehend ignoriert. Die Sicherheits- Phase 2: Völlig unterschätzt wird die Phase 2, bis die
forschungsstudie „Ernährungsvorsorge in Österreich“ Telekommunikationsversorgung mit Festnetz, Handy
(Kleb, 2015) kam wie auch ähnliche Studien in Deutsch- oder Internet nach dem Stromausfall wiederhergestellt
land zu dem Schluss, dass sich ein Großteil der Bevölke- werden kann. Zu erwartende schwerwiegende Hardware-
rung nur wenige Tage selbst versorgen könnte. So ist etwa ausfälle und Störungen sowie massive Überlastungen
zu erwarten, dass sich nach einem solchen Ereignis spä- beim Wiederhochfahren könnten dazu führen, dass mit
testens am vierten Tag rund ein Drittel und nach sieben einer zumindest mehrtägigen Wiederherstellungszeit
Tagen bereits rund zwei Drittel oder sechs Millionen Men- nach dem Stromausfall zu rechnen wäre. In Regionen
schen in Österreich nicht mehr ausreichend selbst versor- mit einem Stromausfall von länger als 72 Stunden
gen könnten. Das beträfe auch jenen Teil der Bevölkerung, müsste in der IT-Infrastruktur mit erheblichen Schäden
der in der Krise eine Notversorgung aufrechterhalten oder und Problemen gerechnet werden. Damit wäre die Wie-
den Wiederanlauf der Produktion und Warenverteilung derherstellung der Versorgung immer schwieriger und
sicherstellen sollte. Damit drohte eine katastrophale Ab- langwieriger.
wärtsspirale, welche es zu verhindern gilt. Ohne Telekommunikationsversorgung gäbe es we-
der eine Produktion noch eine Treibstoffversorgung und
damit auch keine Versorgung mit Lebensmitteln oder
2.1. Ein Blackout hat drei wesentliche Phasen Medikamenten, da so gut wie alle Produktions-, Logis-
tik- und Versorgungsprozesse von funktionierenden Da-
tenverbindungen abhängen. Zum anderen gibt es heute
Ein Blackout ist nicht nur ein Stromausfall, sondern durch die Just-in-Time-Prozesse häufig nur mehr geringe
führte zum kompletten Kollaps unserer lebenswichtigen Lagerkapazitäten als Sicherheitspuffer. Die Gesund-
Psychologie in Österreich 1 | 2022 55Theresia Ines Herbst & Herbert Saurugg
„Stromlos ist viel los!“ – Ein proaktiver Umgang mit dem Blackout-Risiko
heitsversorgung (Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte, ausfallen, was besonders katastrophale Folgen nach
Apotheken, Pflege usw.) könnte aus diesen Gründen, sich ziehen würde. Krankenhäuser haben zwar für die
wenn überhaupt, nur sehr eingeschränkt funktionieren. wichtigsten Einrichtungen eine Notstromversorgung,
Auch hier wären wegen vieler Ver- und Entsorgungspro- sind aber von vielen externen Ver- und Entsorgungs-
bleme schwerwiegende Ausfälle zu erwarten. Für die Kri- leistungen und der Personalverfügbarkeit abhängig.
senbewältigung wäre die Phase 2 bereits eine extreme Die Abhängigkeiten nehmen seit Jahren zu und dürften
Herausforderung. sich in den kommenden Jahren noch weiter verschärfen.
Hierfür gibt es derzeit keine ausreichenden staatli- Ein System, welches zu jedem Augenblick die Balance
chen oder sonstigen Vorkehrungen, da in dieser Phase zwischen Erzeugung und Verbrauch ausgleichen muss,
niemand Millionen Menschen akut helfen könnte. Zu- steht vor immer schwieriger und aufwendiger werdenden
sätzlich wären die HelferInnen und deren Familien eben- technischen Herausforderungen. Insbesondere miss-
falls von den Auswirkungen betroffen. Erst diese Aus- achten viele politische und regulatorische Vorgaben die
gangssituation führte in eine wirkliche Katastrophe. technischen und physikalischen Grenzen des Systems.
Phase 3: Diese Phase könnte je nach betroffenem Be- Der Systemumbau setzt in vielen Bereichen den zweiten
reich Wochen, Monate und zum Teil Jahre dauern. Etwa Schritt vor den ersten und erfolgt mit unterschiedlichen
in der Landwirtschaft, wo erwartet wird, dass binnen Geschwindigkeiten, was die Fragilität weiter erhöht.
Stunden Millionen Nutztiere in Europa sterben würden, Ein Blackout wäre jedoch beherrschbar, wenn die Ge-
wenn Belüftungs- und Futteranlagen ausfallen. Nach sellschaft über entsprechende Rückfallebenen verfügen
einem großflächigen chaotischen Ausfall der Produk- würde, wie Blackouts in anderen Teilen der Welt immer
tions- und Logistikketten sowie der lebenswichtigen In- wieder beweisen. Die europäische Gesellschaft ist durch
frastrukturen wäre nicht davon auszugehen, dass diese die sehr hohe Versorgungssicherheit sehr verwöhnt und
binnen weniger Tage wieder im gewohnten Umfang zur gleichzeitig verwundbar wie keine andere. Vorratskam-
Verfügung stünden und rasch synchronisiert werden mern und Notkaminanschlüsse sind in der modernen
könnten. Länger anhaltende Versorgungsunterbre- Wohnraumplanung kein Sicherheitsstandard mehr. Da
chungen und -engpässe wären daher sehr wahrschein- immer alles verfügbar ist, gibt es kaum Auffangnetze. We-
lich. Man denke nur an die vielschichtigen transnatio- der auf persönlicher noch auf unternehmerischer oder
nalen und transkontinentalen Abhängigkeiten in der organisatorischer Ebene, auch nicht bei den staatlichen
Versorgungslogistik. Strukturen selbst. So sind etwa das Österreichische Bun-
Ausfälle in der Kunststoffindustrie oder Verpackungs- desheer oder die Polizei gerade dabei, die eigenen Infra-
logistik würden sich über die gesamte Versorgungs- strukturen wieder zu stärken. Die ersten Einrichtungen
logistik fortsetzen. Eine Kette ist nur so stark wie ihr sollen bis 2024/25 wieder ausreichend autark sein.
schwächstes Glied. Daher sollte in jeder Gemeinde und
Organisation ein zumindest 14-tägiger Krisenbetrieb
vorbereitet werden, um die absehbaren Folgeprobleme
bestmöglich abfedern zu können.
3. Grundüberlegungen zur Resilienz
„Menschen reagieren individuell höchst unterschiedlich
2.2. Ursachen für das gestiegene Blackout-Risiko auf ausgeprägte Risiken und manifeste Krisen. Während
in Europa einige vergleichsweise leicht problematische Lebens-
umstände überwinden, sind andere unter vergleich-
baren Bedingungen anfällig für psychische Störungen
Die Ursachen für die steigende Blackout-Gefahr sind und Krankheiten, soziale Auffälligkeiten oder sonstige
sehr vielfältig: ein Strommarkt, der auf physikalische individuell und sozial problematische Bewältigungs-
und technische Grenzen keine Rücksicht nehmen muss, formen. […] Grundsätzlich ist Resilienz in unterschied-
eine nicht systemisch gedachte Energiewende, die nur licher Qualität mit jeder menschlichen Entwicklung
einen einseitigen Systemumbau forciert, der technisch verbunden“ (Gabriel, 2005, S. 207). Resilienz steht für
nicht funktionieren kann, fehlende Speicher, um die vo- Beständigkeit, Widerstandsfähigkeit und Toleranz ge-
latile Stromerzeugung aus Windkraft- und PV-Anlagen genüber störenden Ereignissen durch Lern- und Anpas-
ausgleichen zu können, immer weniger konventionelle sungsfähigkeit, um auf veränderte Rahmenbedingungen
Reserven, ein steigender Stromverbrauch, alternde und rechtzeitig reagieren und Krisen meistern zu können.
unzureichende Strominfrastrukturen und zunehmend Der Begriff verbindet nach Hollings systemökologischer
mehr Extremwetterereignisse oder Cyberangriffe, um Perspektive „learning with continuity“ (Holling, 2001,
nur ein paar Aspekte zu nennen. Einzelereignisse sind S. 399). Statt einer Rückkehr zum Alten geht es Holling
beherrschbar und werden tagtäglich abseits der öffent- somit um den dynamischen Aspekt von Ökosystemen in
lichen Wahrnehmung bewältigt. Mit der Zunahme von der Fähigkeit, durch Transformation bestehen zu bleiben
potenziell gefährlichen Ereignissen steigt jedoch die Ge- (Holling, 1973). Jahrezehntelange Resilienzforschung
fahr, dass es gleichzeitig zu Mehrfachereignissen kom- betont zunehmend den prozesshaften Charakter der
men könnte, die dann nicht mehr beherrschbar wären. In Resilienz. „Aktuell wird Resilienz daher als dynamischer
vielen Regionen würde auch noch die Wasserversorgung und lebenslanger Prozess verstanden, der im Wech-
56 Psychologie in Österreich 1 | 2022Theresia Ines Herbst & Herbert Saurugg
„Stromlos ist viel los!“ – Ein proaktiver Umgang mit dem Blackout-Risiko
selspiel zwischen Person und Umwelt erfolgt und über „Diese Vulnerabilität steigert das Risikoparadoxon:
verschiedene Lebensbereiche und -phasen variiert“ (Ga- ‚Je weniger eine Gesellschaft ein Risiko erlebt, desto
briel, 2005, S. 209 ff.; Kunzler et al., 2018, S. 747). schlechter ist sie darauf vorbereitet.‘“ (Voßschmidt &
Das Bewusstsein zur Schaffung und Förderung der Karsten, 2020, S. 12). Es ist fast immer alles verfügbar
Resilienz – zumindest hinsichtlich der Grundversorgung und wenn nicht, gibt es meist einen Ersatz und die Berg-
– hat in unserer Zivilisation eine jahrhundertealte Tra- rettung samt Hubschrauber kommt auch in die entle-
dition und ist erst in der jüngsten Zeit in Vergessenheit genste Bergregion („Vollkaskogesellschaft“). Vielleicht
geraten. Altes Erfahrungswissen hat sich in Spruchweis- erklärt die Gewohnheit an Überversorgung und Regu-
heiten erhalten, wie z. B.: Kein Mensch ist so reich, dass lierung das Nachlassen des Bewusstseins zur Eigenver-
er seinen Nachbarn nicht braucht! Der beste Rat ist antwortlichkeit und Selbstständigkeit – mit gefährlichen
Vorrat! Spare in der Zeit, dann hast du in der Not! Vor- Konsequenzen. Befänden sich Menschen beim Eintreten
beugen ist besser als Heilen! Hilf dir selbst, dann hilft eines Blackouts zu Hause, kämen sie möglicherweise
dir Gott! Bei Sturm ist jeder Hafen gut! Not macht er- nicht mehr in die Arbeit. Wären viele Menschen bereits
finderisch! Darin wird der Stellenwert der NachbarInnen nach wenigen Tagen durch die Kälte, Hunger und Hilflo-
und der Vorsorge hervorgehoben. Erfahrene Krisen und sigkeit in äußerster Not, dann drohte eine unbeherrsch-
Katastrophen spiegeln sich in Gesetzen, Institutionen, bare Lage. Dabei könnten Erwachsene z. B. durchaus ei-
ehrenamtlichen Einrichtungen und Übungen wider, z. B. nige Wochen mit sehr wenig Nahrung auskommen, nur
im (freiwilligen) Rettungs- und Feuerwehrwesen und im dürfte das den meisten Menschen nicht bewusst sein.
Hochwasser-, Lawinen-, Strahlen- und Brandschutz. Er- Aktuell steht die breite Sensibilisierung für einen Black-
fahrungswissen im Umgang mit Katastrophen ist wert- out-Krisenfall und die ernsthafte sowie glaubwürdige Si-
voll. Unsicherheiten durch neue Gefahren, welche u. a. cherheitskommunikation (Giebel, 2012) erst am Anfang.
durch den Gebrauch der Hochtechnologie entstehen, Nehmen die Verantwortlichen aus der Energiewirtschaft,
machen es erforderlich, bisherige Sicherheitskonzepte Sicherheit und Politik die Thematik nicht ernst, könnte
auf ihre Zweckmäßigkeit hin zu prüft und gegebenenfalls dieses Thema von unterschiedlichen Gruppierungen für
zu adaptieren. Dass ein Betrieb durch einen Cyberangriff ihre eigenen Zwecke vereinnahmt und zweckentfrem-
über das Internet zum Stillstand gebracht werden kann, det werden. Verhaltensänderungen können Menschen
war vor einer Generation noch undenkbar. Heute gehört schwerfallen, wie psychologische Untersuchungen zei-
das zum Alltag, da die notwendigen Sicherheitskonzepte gen (Adams, 2021). Mit wie wenig kann ich auskommen?
zu langsam angepasst werden. Aus Schaden wird man Was ist wirklich wichtig? Monatelange Versorgungs-
klug, lautet ein weiteres Sprichwort. Vernetzte Krisen, engpässe erforderten einen Verzicht, der etwa für viele
wie etwa ein Blackout, könnten jedoch einen Totalscha- Menschen in Wohlstandsgesellschaften – anders als in
den verursachen, der einer entstandenen Klugheit nicht Ländern mit geringer Versorgungssicherheit – als sehr
viel übrig ließe. Verschiedene thematisch aufgegriffene irritierend empfunden werden könnte.
und reflektierte Ereignisse in der Wirtschaft, im Alltags-
leben, in der Familie, in der Schule, im Beruf, in der Frei-
zeit, im kulturellen, öffentlichen und politischen Diskurs 3.2. Die Vorsorge beginnt im Kopf
können dazu beitragen, die Bewusstseinsbildung zur
Stärkung der Resilienz zu fördern, Handlungsmöglich-
keiten zu erkennen und umzusetzen. Beim Thema Blackout-Vorsorge erscheint es nach Mo-
naten der gesellschaftlichen Polarisierung sinnvoll, sich
wieder verstärkt mit dem Verbindenden, statt mit dem
3.1. Resilienz aus Perspektive der Blackout- Trennenden zu beschäftigen. Um absehbare und nicht
Krisenvorsorge absehbare Turbulenzen bewältigen zu können, benöti-
gen wir vernetztes und systemisches Denken, das Wi-
dersprüche aushält und sie zu nützen versteht. Denn
„In einer ersten Gruppe von Maßnahmen der Resilienz- nicht alles, was die eine oder andere Seite sagt, ist rich-
steigerung lassen sich Vorbereitungsstrategien gruppie- tig oder falsch. Krisenfitness beginnt somit im Kopf, in-
ren, bei denen schützende Ressourcen für mögliche und dem man akzeptiert, dass gewisse Ereignisse eintreten
nicht gänzlich vermeidbare Notfälle vorgehalten und können und sich mit Hilfe der Antizipationskraft damit
aufgebaut werden“ (Folkers, 2017, S. 186). Die ältere Ge- auseinandersetzt. Wenn man gewisse Dinge bereits ge-
neration kann noch von größeren, selbst erlebten Ver- danklich durchgespielt und Vorsorge getroffen hat, ist
sorgungskrisen nach dem Zweiten Weltkrieg berichten, anzunehmen, dass die Schockreaktion milder ausfallen
der jüngeren Generation sind sie unbekannt. und dadurch die Handlungsfähigkeit eher gegeben blei-
ben könnte.
Moderne Gesellschaften sind jedoch So ist etwa für die Familien-Blackout-Vorsorge auch
die Absprache innerhalb der Familie, wie und wo die Fa-
durch die Globalisierung, Vernetzung milienzusammenführung passiert, ganz besonders wich-
tig – vor allem für jene Familienmitglieder, die einen hel-
und Digitalisierung verwundbarer.
fenden Beruf oder ein Ehrenamt ausüben und in der Krise
Psychologie in Österreich 1 | 2022 57Theresia Ines Herbst & Herbert Saurugg
„Stromlos ist viel los!“ – Ein proaktiver Umgang mit dem Blackout-Risiko
dienstfähig bleiben sollen. Unsicherheit und Sorgen um mitglied Gefühle von Hilflosigkeit, Ausgeliefertsein, Ver-
eigene Angehörige vermindern die Einsatzfähigkeit. Bei unsicherung, Schock und Angst in besonderem Maße.
einem Blackout könnte man nicht mehr nachfragen und […] Ein Kind ist der Angst des Alleingelassenwerdens
nichts mehr vorausschauend organisieren, weil die Tele- ausgesetzt, ohne ihr etwas entgegensetzen zu können.“
kommunikationsmöglichkeiten innert weniger Minuten (Eckardt, 2013, S. 19) An erster Stelle steht im Umgang
ausfallen würden. Ein anderer Aspekt ist, dass bei einem mit Kindern und Jugendlichen das Bemühen, die Sicher-
Blackout zunächst keine offensichtlichen Aufräumarbei- heit wiederherzustellen und sie mit ihren vertrauten
ten zu erledigen wären, wie nach einer Naturkatastro- Bezugspersonen zusammenzuführen, da alleine schon
phe. Es würde auf den ersten Blick alles in Ordnung aus- der Trennungsschock v. a. bei Kindern schwere seelische
sehen, aber trotzdem würde das Gewohnte nicht mehr Folgeschäden verursachen kann (Weinberg, 2005, S. 37).
funktionieren und der strukturgebende Tagesablauf Notfallpsychologische Strategien, die für Erwachsene
verloren sein. So eine Situation könnte viele Menschen entwickelt wurden, sind unangemessen oder reichen für
destabilisieren. Tatsächlich würden freiwillige, helfende Kinder und Jugendliche nicht aus. „Stattdessen sollte
Hände vieler Menschen dringend benötigt. Daher wäre bei Kindern und Jugendlichen sowohl eine altersspezi-
es sinnvoll, die Bevölkerung aktiv in die Krisenvorsorge fisch differenzierte Psychische Erste Hilfe als auch eine
und -bewältigung einzubinden, um als Freiwillige („Un- spezielle Psycho-soziale Notfallhilfe geleistet werden.“
gebundene Helfer“ – Sackmann S., 2018) die organisierte (Karutz, 2011, S. 283). Die psychische und physiolo-
Hilfe unterstützen zu können. Viele Menschen müssten gische Situation in einem Notfall ist bei Kindern und
Führungsaufgaben und Verantwortung übernehmen und Jugendlichen anders. Das Schmerzempfinden kann auf-
Strukturen schaffen bzw. erhalten. Es käme daher auf grund des fehlenden Wissens und der noch wenig diffe-
jede und jeden an, im Rahmen der Möglichkeiten zur renzierten Körperwahrnehmung von ihnen verharmlost
Krisenbewältigung beizutragen und sich vor allem in der oder als extrem bedrohlich erlebt werden. Durch die
Nachbarschaftshilfe zu engagieren. größere Körperoberfläche im Verhältnis zum Körperge-
wicht verlieren Kinder mehr Flüssigkeit als Erwachsene
und entwickeln schneller ein starkes Durstgefühl. Unter
3.3. Besondere Situation der HelferInnen Bewegungseinschränkungen leiden sie enorm, da sie oft
und Minderjährigen über Bewegung ihre Erregung abbauen. Sie sind durch
ihre feineren Sinne und ihre Vorstellungskraft auch hin-
sichtlich des Anblicks von Blut, Verletzten und Toten
Die HelferInnen der Einsatz- und Hilfsorganisationen, und der Wahrnehmung von unangenehmen Gerüchen
auch helfende PsychologInnen würden in allen drei Pha- und Äußerungen viel sensibler. Kinder und Jugendliche
sen eines Blackout-Krisenfall besonders massiv bean- können nicht auf Vorerfahrungen und eigene, bereits
sprucht werden. Einerseits wären sie und ihre Familien entwickelte Bewältigungsstrategien zurückgreifen, Wis-
genauso betroffen und andererseits könnten sie mit der senslücken werden je nach Entwicklungsstand magisch-
Ohnmacht konfrontiert werden, nicht wie gewohnt hel- mystisch und irrational interpretiert und es kommt vor,
fen zu können. Zudem wären im medizinischen Umfeld dass sie die Ursache der Katastrophe sogar sich zuschrei-
viele Todesopfer zu erwarten, ebenfalls in der Pflege und ben. Ein besonderes Problem stellt für jüngere Kinder
Altenbetreuung. Auch in Krankenhäusern drohte zeit- das altersbedingte Fehlen des sprachlichen Ausdrucks
nah ein Chaos, wenn nicht frühzeitig in einen absoluten für innerpsychische Vorgänge dar (Lueger-Schuster &
Notbetrieb heruntergefahren würde. Dem physisch wie Pal-Handl, 2004). Viele Kinder haben auch Angst, über
psychischen Selbstschutz der HelferInnen und ihrem Probleme zu sprechen, weil sie befürchten, sie dadurch
Wissen darüber, was sie sich zumuten können und wie, zu verschlimmern oder geschimpft zu werden. Sind Be-
kommt ein besonders hoher Stellenwert zu (Hausmann, zugspersonen, die sonst Sicherheit vermitteln, als Opfer
2005; Lasogga & Karutz, 2011). Vor allem der Umgang betroffen, werden sie mitgetroffen. Durch das Verhalten
mit notfallbetroffenen Kindern gilt als besonders belas- der Erwachsenen, ihren Gesichtsausdruck und Tonfall
tend für HelferInnen und benötigt eine profunde Vorbe- spüren auch ganz junge Kinder instinktiv, dass eine ge-
reitung, da Kinder Schutzinstinkte auslösen und eine be- fährliche Situation besteht.
sondere Betroffenheit verursachen (May & Mann, 2005,
in Karutz, 2011, S. 296). Kinder und Jugendliche sind
durch ihren jeweiligen Entwicklungsstand und ihre Ab- Die Vorbereitungen der HelferInnen
hängigkeit von Bezugspersonen besonders vulnerabel. notfallbetroffener Kinder berücksichtigen
„Kinder haben natürlich noch wenig Lebenserfahrung
eine ganze Reihe spezifischer Besonder-
und haben noch nicht so oft schwierige Probleme durch
Eigeninitiative lösen können. Daher haben sie wenig Zu- heiten (Karutz, 2011).
trauen in sich als ‚Bewältiger‘ von Problemen. Sie sind
von Natur aus auf die Zuwendung und Unterstützung
von Erwachsenen angewiesen und so sehr viel ‚hilfloser‘ Sie reicht von der Art der Kontaktaufnahme und Begeg-
als Erwachsene. Wenn eine Familie gemeinsam eine nung auf Augenhöhe, dem Sprechen und Zuhören, der
Tragödie erlebt, so erlebt zumeist das jüngste Familien- positiven Bedeutung von Stofftieren, Abschirmen bzw.
58 Psychologie in Österreich 1 | 2022Theresia Ines Herbst & Herbert Saurugg
„Stromlos ist viel los!“ – Ein proaktiver Umgang mit dem Blackout-Risiko
begleitetem Zuschauen bis zur Art und Weise des Infor- 5. Resiliente Familie, Kindergarten,
mierens und Beantwortens von Fragen. Falls möglich, Schule & Co.
sollten Kinder und Jugendliche kleine, ungefährliche
Aufgaben übernehmen können, um ihre Selbstkompe-
tenz zu stärken. Die gute Absicht von HelferInnen kann Zwei Gastvorträge zum Thema „Blackout in der Schule
v. a. für Kinder nicht immer erkannt werden oder auch und Familie/Krisenvorsorge“ von Herbert Saurugg und
altersunangemessen sein. Viele verschiedene Modera- Verena Herleth, gehalten an der KPH Wien/Krems An-
torvariablen und situative Variablen können die Bela- fang 2021, lösten unter der Studierendengruppe der
stung vermindern oder steigern, wobei der Anwesenheit Ausbildung Primarstufe der KPH Wien/Krems eine
und Hilfe durch vertraute Bezugspersonen (Eltern, Pä- starke Resonanz aus. „Nie hätte ich an so etwas ge-
dagogInnen) hierbei die größte protektive Bedeutung dacht. Ich wäre die erste, die flippt, dann flippen die
zukommt. Anders als bei Erwachsenen treten die Sym- Kinder!“, beschreibt eine Studierende die Panikreak-
ptome der Notfallfolgen häufig deutlich verzögert auf. tion, die durch eine Situation abseits des Denkhori-
Während des Notfalls „funktionieren“ Kinder und Ju- zontes ausgelöst werden kann. Die Studierenden waren
gendliche oft erstaunlich gut. Nicht alle entwickeln ne- überzeugt, dass das Thema Blackout-Vorsorge mit den
gative Notfallfolgen, manche können durch das Erleben Eltern im Klassenforum angesprochen werden sollte.
auch an Reife und Tiefe gewinnen (Lackner, 2004). Bei Sie erkannten, dass es für Kinder besonders entschei-
einem weitreichenden Katastrophenszenario, welches dend ist, wie sich Erwachsene, v. a. Eltern und Pädago-
die gesamte Gesellschaft betrifft, ist jedoch anzuneh- gInnen vorbereiten und bei einem Blackout reagieren.
men, dass kurz-, mittel- oder langfristig bei vielen Kin- Erkennen und gefasst sein, dass so ein Fall möglich ist,
dern und Jugendlichen negative emotionale, kognitive die Situation prüfen, benennen und ruhig kommunizie-
und körperliche Auswirkungen und Verhaltensverände- ren, das hilft bereits, um in der Krise handlungskompe-
rungen eintreten und zur akuten Versorgung und Unter- tent zu bleiben und die Ordnung in der Kindergarten-
stützung der Verarbeitung eine psychosoziale Notfall- gruppe bzw. in der Klasse bis zum Unterrichtsschluss zu
bzw. Katastrophenhilfe organisiert werden muss. gewährleisten. Proaktiv können kritische Situationen
entschärft werden, indem einerseits eine Bewusst-
seinsbildung erfolgt und andererseits Sicherheits-
vorkehrungen getroffen werden, die in „guten Zeiten“
4. Kommunikation und Nachbarschaft möglich sind. Zu Beginn steht auch hier die mentale
Vorbereitung durch Erwachsene: Welchen Stellenwert
gebe ich dem Blackout-Risiko und welche innere Hal-
Bei einem Blackout käme es zeitnah zum völligen Aus- tung nehme ich ein? Wie, wann und was kommuniziere
fall aller gewohnten Kommunikationsmittel wie Handy, ich darüber mit den mir anvertrauten bzw. von mir ab-
Festnetz oder Internet. Damit würde die Gesellschaft in hängigen Minderjährigen oder anderen auf mich Ange-
Kleinstrukturen zerfallen. Gegenseitige Hilfe und Unter- wiesenen aus der Familie, dem Freundeskreis und der
stützung wären nur mehr im unmittelbaren Umfeld mög- Nachbarschaft? Hinsichtlich der Kinder geht es um eine
lich. Besonders erschwerend käme hinzu, dass auch ein kindgerechte Thematisierung des Blackout-Risikos in
Absetzen von Notrufen nicht mehr möglich wäre. Das der Familie und Schule, ohne Angst auszulösen. Dabei
erforderte in einer solchen Krise ein völliges Umden- sollen wichtige Fragen zum Treffpunkt, zum Ausfall der
ken: Die gewohnte Auslagerung der Bewältigung an eine Telekommunikation und der öffentlichen Verkehrsmit-
organisierte Hilfe funktioniert plötzlich nicht mehr. Um tel besprochen werden. Ist ein Schlüssel immer ein-
Schäden abzuwenden, müsste eine Selbst- und Nach- gesteckt? Sind zu Hause bereits Vorräte und hilfreiche
barschaftshilfe für jene Menschen organisiert werden, Utensilien vorhanden, die auch für Kinder gefahrlos
die darauf angewiesen sind. Erschwerend käme hinzu, zugänglich sind, damit sie sich auch einige Zeit alleine
dass man in den urbanen Räumen nur mehr selten seine versorgen können, bis Eltern oder andere Erwachsene
NachbarInnen kennt und trotzdem wäre man plötzlich zu ihnen kommen? Welche NachbarInnen können hel-
völlig aufeinander angewiesen. Das könnte für die einen fen oder benötigen Unterstützung? Die Gastvorträge
eine Bereicherung, für die anderen eine enorme Heraus- in den Seminaren zeigten den Studierenden, dass die
forderung darstellen. Entscheidend für die allgemeine Eigenvorsorge der PädagogInnen (zu Hause ist vor-
Stimmung wäre, ob die Medien ab der Phase 3 negative gesorgt, sogar Medikamente und Taschenlampe sind
Ausreißer oder die vielen positiven Beispiele mensch- vorhanden, das Auto ist immer halbvoll getankt und
licher Hilfestellung hervorheben. Hier sind die Medien auch in der Klasse gibt es einen Notvorrat) den besten
gefordert, aus den Fehlern der Berichterstattung der Co- Ausgangspunkt dafür darstellt, im Krisenfall die Auf-
rona-Krise zu lernen und sich in Krisenkommunikation gabe in der Kindergartengruppe bzw. Klasse zu erfüllen.
zu schulen, in der die Generierung von Angst ein Tabu So wichtig wie die körperliche Versorgung ist die see-
darstellt. Hilfreich wäre eine mediale Berichterstattung lische. Besonders Kindergarten- und Grundschulkinder
der ehrlichen und verständlichen Worte, die dabei auch sind bis zur Familienzusammenführung darauf ange-
den Fokus auf das Positive und die Ressourcen richtet wiesen, von ihren vertrauten PädagogInnen beschützt
und nicht dem Prinzip „bad news is good news“ folgt. und durch die Krise begleitet zu werden, die ihrerseits
Psychologie in Österreich 1 | 2022 59Theresia Ines Herbst & Herbert Saurugg
„Stromlos ist viel los!“ – Ein proaktiver Umgang mit dem Blackout-Risiko
auch Rückhalt und Unterstützung für diese verantwor- Abb. 3: Buchcover „Stromlos ist viel los!“, Rückseite, Quelle: Verena Herleth,
tungsvolle Aufgabe benötigen. Psychologisches Fach- 2021, mit bestem Dank für die Abdruckgenehmigung
wissen aus der klinischen Psychologie, Notfall-/Trau-
mapsychologie z. B. über die Schritte der „Emotionalen
Ersten Hilfe“ gibt Handlungssicherheit im Krisenfall
und hilft, Ohnmachtserfahrungen und toxischen Stress
von PädagogInnen und SchülerInnen abzuwenden bzw.
Folgestörungen zu behandeln (Levine & Kline, 2010;
Münker-Kramer, 2006; Münker-Kramer, 2009).
5.1. Kinderbücher zur Krisenvorsorge
und Prävention
Einen kleinen Beitrag zur Krisenvorsorge und Prävention
können Kinderbücher leisten, die einen Blackout-Krisen-
fall kindgerecht thematisieren, ohne Angst auszulösen.
Verena Herleths erstes Aufklärungsbuch „Blackout – sei
vorbereitet!“ (Herleth, 2020) richtet sich an ca. acht- bis
zwölfjährige Kinder und ihre Familien. Technische Zu-
sammenhänge, Überlegungen zur Hygiene und Bevor-
ratung werden darin genauso thematisiert, wie freiwil-
lige Probetage, die in den vier Jahreszeiten durchgeführt Es entstand in intensiver, kreativer Zusammenarbeit
wertvolle Erfahrung in der Bewältigung eines stromlosen im Rahmen vieler Videokonferenzen zwischen der Au-
Tages ermöglichen. torin Verena Herleth, der Illustratorin Nina Wieland
Für jüngere Kinder ist dieses Buch sprachlich und in- und sechs Studierenden der KPH Wien/Krems: Pia Jor-
haltlich zu komplex, aber auch sie müssen berücksich- dan, Martina Ougaard, Sophie Hauser, Anna Holzinger-
tigt und ihrem Entwicklungsstand entsprechend ange- Neulinger, Elisabeth Rabl und Verena Stigleitner. Der
sprochen werden. So fand sich unter den Studierenden Inhalt des Buches im handlichen Format besteht aus
der KPH Wien/Krems eine Gruppe, welche ein Blackout- einer auf den Entwicklungsstand kleinerer Kinder ab-
Themenbuch für Kinder der Altersgruppe vier bis acht gestimmten Geschichte, in welcher ein Kind mit seiner
Jahre entwickeln wollte. Im September 2021 erschien Oma und einem Eichhörnchen als Maskottchen lernt,
schließlich das Büchlein „Stromlos ist viel los!“ (Herleth, dass eine Krise mit ausreichender Vorbereitung gemei-
2021, siehe Abbildung 2 & 3). stert werden kann. Michi – in Text und Bild geschlechts-
neutral gehalten – beobachtet ein Eichhörnchen beim
Abb. 2: Buchcover „Stromlos ist viel los!“, Vorderseite, Quelle: Verena Herleth, Sammeln des Wintervorrats und lernt Omas Vorrats-
2021, mit bestem Dank für die Abdruckgenehmigung keller kennen. Oma erklärt, wozu Strom verwendet wird
und dass er auch einmal ausfallen kann. Sie zeigt an-
hand einiger situativer Beispiele, wie nützlich Rückfal-
lebenen sein können, und sie probieren sie mit Michi
aus: „Oma, fällt der Strom doch einmal aus, haben wir
dann kein Licht im Haus? Wenn es dunkel ist, wie soll
das gehen? Bleiben wir dann alle stehen?“ „Nein, mein
Schatz, dann nehm’ ich eine Taschenlampe her. Sind wir
vorbereitet, ist’s ohne Strom nicht schwer!“ (Herleth,
2021, S. 19) Tags darauf erzählt Michi Papa seine/ihre
Erlebnisse bei Oma und gemeinsam besorgen sie Vor-
räte für sich zu Hause. Der Text in Reimform und die
liebevoll gestalteten Illustrationen laden zum Fragen
und Entdecken ein. Einige Aktivitäten im Handlungs-
teil geben weitere Impulse für eine kindgerechte Aus-
einandersetzung mit Strom und Vorratshaltung. Im An-
schluss an die Geschichte finden Erwachsene nützliche
Hinweise zur Krisenvorsorge, zur pädagogischen und
psychologischen Begleitung der Kinder und Gedanken
zum Smart Home. Am Ende des Buches befindet sich
eine Linksammlung zu nützlichen Webseiten für Öster-
reich, Deutschland und die Schweiz.
60 Psychologie in Österreich 1 | 2022Theresia Ines Herbst & Herbert Saurugg
„Stromlos ist viel los!“ – Ein proaktiver Umgang mit dem Blackout-Risiko
Die „Helfer Wiens“ publizierten im November 2021 Hause), in der Schule bleiben? Wie wird eine Betreu-
das Kinderbuch „Abenteuer mit Nono & Nana“. Anhand ung sichergestellt (LehrerInnen haben auch Familien!)?
verschiedener Situationsvignetten und Rätselaufgaben Gibt es eine Notverpflegung für die Kinder, die nicht am
werden Kindern Gefahrenquellen und richtiges Verhal- selben Tag nach Hause kommen? Wie kann analog zum
ten nähergebracht. Der Themenbogen ist weit gesteckt Strahlenschutz in Einzelfällen eine Übernachtung in der
und umfasst einen Verkehrsunfall, Brände in der Küche, Schule organisiert werden? Wie ist das Lehrerkollegium
im Wohnzimmer bzw. im Stiegenhaus, Umgang mit Ge- zu diesem Thema sensibilisiert (der Plan muss in den
fahrenstoffen, Sicherheit im Schwimmbad, Verhalten Köpfen sein)? Welche Vorgaben und Unterstützung gibt
bei Gewitter, einem Blackout samt Vorratstipps und die es von den Schulbehörden? Welche Absprachen gibt es
Vorbereitung einer Bergtour. Hinsichtlich der Dichte und mit der Gemeinde oder anderen Organisationen? Kann
Komplexität der Gefahrensituationen und Handlungs- es analog zur Feueralarmprobe des Brandschutzes auch
empfehlungen eignet sich dieses Buch eher für größere eine Blackout-Übung geben? In der Schweiz steht in
Kinder. Es können aber Teile daraus ausgewählt und iso- Schulen, die am Klimaschutzprogramm „My blue pla-
liert betrachtet werden, um Kinder thematisch nicht zu net“ (www.klimaschule.ch) teilnehmen, der Aktionstag
überfordern. Dieses Buch ist zum Selberlesen und Vor- „Blackout Days“ auf dem Plan. An diesem Tag wird ohne
lesen auch einzelner Kapitel gedacht und kann kosten- genaue Vorankündigung der Schulstrom abgestellt. Die
frei über die Website der „Helfer Wiens“ bestellt werden SchülerInnen und LehrerInnen werden mit dem simu-
(www.diehelferwiens.at). lierten Stromausfall konfrontiert und dabei auch für
den Umgang mit Ressourcen sensibilisiert. Sie können
in einem geschützten und ins Unterrichtsprogramm
5.2. Vorsorge, „Blackout Day“ und SchülerInnen- integrierten Rahmen am eigenen Körper erfahren, was
information für Bildungseinrichtungen passiert, wenn so etwas Selbstverständliches wie der
Strom nicht vorhanden ist (https://www.fm1today.ch/
ostschweiz/stgallen/blackout-gossauer-schule-stellt-
Für die Bildungseinrichtungen stellt sich die Frage, was einen-tag-den-strom-ab-140434871, https://www.klima-
zu tun wäre, wenn während des Unterrichts bzw. der Be- schule.ch/wp-content/uploads/2020/12/2020-12-11_Zür-
treuungszeit der Blackout-Krisenfall einträte? 1,2 Mil- cher-Oberländer_Gockhausen.pdf, Datum des Zugriffs
lionen Kinder und Jugendliche besuchen wochentags 10.12.2021). Über Bildungseinrichtungen können wert-
eine Bildungseinrichtung, somit fällt den Schulen und volle Informationen zur Krisenvorsorge verteilt werden.
Kindergärten als Institutionen und im Rahmen der Er- Die Österreichische Gesellschaft für Krisenvorsorge
ziehungspartnerschaft eine große Verantwortung zu. Da (GfKV) stellt auf ihrer Webseite ein zweiseitiges Schüle-
es dieses Ereignis noch nie gab, fehlen bei Redaktions- rInneninformationsblatt mit den wichtigsten Hinweisen
schluss (noch) spezifische Gesetze und Verordnungen, und Empfehlungen zur Blackout-Krisenvorsorge kosten-
somit müsste bis auf Weiteres mit Bestehendem im- frei als PDF zur Verfügung (https://gfkv.at/vorsorge/). Er-
provisiert werden – und kraft des vorausschauenden freulicherweise wurde dieses Informationsblatt im Sep-
Denkens auch antizipiert werden. Die Schulverwaltung tember 2021 von Dilara Sağlam, einer Studierenden der
und jeder einzelne Schulstandort benötigen aus Sicht KPH Wien/Krems und ihrer in der Türkei lebenden Tante
des Zivilschutzes neben dem Brandschutz und Strah- Ahu Budak Gül ins Türkische übersetzt. Die türkische
lenschutz auch ein Blackout-Vorsorgekonzept, welches Übersetzung steht ebenfalls als PDF auf selbiger Web-
die Eltern über die Erziehungspartnerschaft einbindet. seite zum Download bereit. Dies ist ein erster Schritt
Neben den Schulgesetzen, in denen die Aufsichtspflicht hinsichtlich der Berücksichtigung der sprachlichen und
geregelt ist, sind es – noch zu formulierende und erlas- kulturellen Vielfalt der Bevölkerung, welchem noch
sende – Verordnungen, welche in Konkordanz mit indi- weitere folgen müssen. Nach einer Analyse des Öster-
viduell festgelegten Handlungsrichtlinien am jeweiligen reichischen Integrationsfonds für das Jahr 2019 haben
Standort die Aufgaben der Bildungseinrichtungen im 45,3 % der Gesamtbevölkerung Wiens einen Migrations-
Krisenfall regeln. Analoges gilt für Kindergärten, Ein- hintergrund und 52,5 % der Wiener SchülerInnen spre-
richtungen der Nachmittagsbetreuung und der Frei- chen eine nichtdeutsche Umgangssprache (Österreichi-
zeitaktivitäten (Sportkurse etc.). Dabei sind der Ent- scher Integrationsfonds, 2020). „2017/18 stammten circa
wicklungsstand der Kinder, die Distanz zum Wohnort, 60 % der Kinder, die eine Kinderbetreuungseinrichtung
räumliche und personelle Ressourcen etc. bei der Klä- in Wien besuchten, aus nichtdeutschsprachigen Fami-
rung einiger Fragen ausschlaggebend, die exemplarisch lien, in Gesamtösterreich lag dieser Wert bei 33 %“ (ebd.,
für den Bereich der Schule gestellt werden: Gibt es in S. 6). Die Statistik weist 20 (!) verschiedene Geburtslän-
der Schule ein batteriebetriebenes Radio, um Informa- der der in Österreich lebenden Personen aus. Somit sind
tionen zu erhalten (sonst Autoradio!)? Wird der Unter- weitere Übersetzungen in die häufigsten gesprochenen
richt fortgesetzt oder eine vorzeitige Entlassung vorge- Umgangssprachen notwendig, um sprachliche Hürden
nommen? Können die Kinder, sofern sie nicht abgeholt zu überwinden und möglichst allen im Land lebenden
werden oder selbstständig nach Hause fahren können Personen mit ihren Familien über z. B. Bildungseinrich-
(Verkehrschaos, Ausfall des öffentlichen Verkehrs, El- tungen Informationen zur Blackout-Vorsorge zugänglich
tern kommen nicht rechtzeitig zum Abholen nach zu machen.
Psychologie in Österreich 1 | 2022 61Theresia Ines Herbst & Herbert Saurugg
„Stromlos ist viel los!“ – Ein proaktiver Umgang mit dem Blackout-Risiko
6. Conclusio und Ausblick Gabriel, T. (2005). Resilienz – Kritik und Perspektiven. Zeitschrift für
Pädagogik 51, 2, S. 207-217.
Giebel, D. (2012). Integrierte Sicherheitskommunikation – Zur Heraus-
Auf der individuellen und gesamtgesellschaftlichen bildung von Unsicherheitsbewältigungskompetenzen durch und in
Sicherheitskommunikation. Münster: LIT Verlag.
Ebene wäre die Tragweite der Zerstörung während und
in Folge eines Blackout-Krisenfalls höchstwahrscheinlich Hausmann, C. (2005). Psychologie und Kommunikation für Pflegebe-
enorm. Die kurz-, mittel- und langfristigen Auswirkungen rufe. Ein Handbuch für Ausbildung und Praxis. Wien: Facultas.
sind noch nicht in ihrer ganzen Komplexität absehbar. Die Herleth, V. (2020). Blackout – Sei vorbereitet! Erlebnisbuch für Familien.
Auseinandersetzung mit dem Blackout-Risiko ist unange- Norderstedt: BoD.
nehm und trifft eine Gesellschaft, die durch große Pro- Herleth, V. (2021). Stromlos ist viel los! Ein Blackout – einfach erklärt
bleme und zusätzlich durch die Pandemie belastet und für Kinder. In Zusammenarbeit mit der KPH Wien/Krems. Norder-
angespannt ist. Krisenvorsorge erfordert Energie und Mut stedt: BoD.
und gelingt leichter anhand von Teamarbeit kleiner und Holling, C. (1973). Resilience and stability of ecological systems. Annual
größerer sozialer Gemeinschaften und Institutionen (Fa- Review of Ecology and Systematics, 4, S. 1-23.
milie, Nachbarschaft, Schulgemeinschaft, Freundeskreis, Holling, C. (2001). Understanding the complexity of economic, ecologi-
Berufskollegium, Stadtverwaltung …). Zusammenarbeit cal, and social systems. Ecosystems, 4(5): S. 390-405.
und gegenseitige Unterstützung stärken die sozialen Be-
Karutz, H. (2011). Kinder und Jugendliche in Notfallsituationen. In
ziehungen und damit die Resilienz. Die Psychologie mit F. Lasogga & B. Gasch (Hrsg.), Notfallpsychologie. Berlin, Heidel-
ihren vielfältigen Expertisen z. B. in der klinischen Psy- berg: Springer, S. 283-304.
chologie, Organisations-, Kommunikations- und Sozial- Kleb, U., Katz, N., Schinagl, C., Angermann, A. (JOANNEUM RESEARCH)
psychologie, Notfallpsychologie und Psychotraumatolo- & Winkler, A. (Agrarmarkt Austria) (2015). Risiko- und Krisenma-
gie u. a.m. könnte in allen drei Phasen, besonders auch nagement für die Ernährungsvorsorge in Österreich (EV-A). Graz:
in der Phase 3, wenn die Massenmedien und das Internet JOANNEUM RESEARCH.
wieder funktionieren und eine schwere Vertrauens- und Kunzler, A. M., Gilan, D. A., Kalisch, R., Tüscher, O. & Liebe, K. (2018). Ak-
Kommunikationskrise drohen, einen wichtigen Beitrag tuelle Konzepte der Resilienzforschung. Nervenarzt, 89, S. 747-753.
zur Stabilisierung und Wiederherstellung der sozialen Lackner, R. (2004). Wie Pippa wieder lachen lernte. Fachliche Hilfe für
Strukturen leisten. Andernfalls könnte eine Lücke entste- traumatisierte Kinder. Wien: Springer.
hen, welche zunächst entweder gar nicht, unsachgemäß
Lasogga, R. & Karutz, H. (2011). Belastungen, Moderatorvariablen und
oder durch andere gefüllt würde mit einer weiteren Eska- Folgen. In F. Lasogga & B. Gasch (Hrsg.), Notfallpsychologie. Berlin,
lation in Folge. Dem vorbeugend sind aber bereits jetzt Heidelberg: Springer, S. 129-161.
entsprechende Vorbereitungen und Vernetzungen erfor-
Levine, P. A. & Kline, M. (2010). Kinder vor seelischen Verletzungen
derlich, um im Anlassfall unterstützen zu können. schützen. Wie wir sie vor traumatischen Erfahrungen bewahren und
im Ernstfall unterstützen können. München: Kösel-Verlag.
Lueger-Schuster, B. & Pal-Handl, K. (2004). Wie Pippa wieder lachen
lernte – Elternratgeber für Kinder. Wien: Springer.
Literatur
Möller, B., Laparter, U. & Wieland-Grefe, S. (2012). „Und plötzlich war
ich ganz allein“ – Traumatisierende Erfahrungen einer Jugendlichen
Adams, G. S., Converse, B. A., Hales, A. H. et al. (2021). People system- während des „Hamburger Feuersturms“ und ihre transgenerationale
atically overlook subtractive changes. Nature 592, 258-261. https:// Weitergabe über drei Generationen. Praxis der Kinderpsychologie
doi.org/10.1038/s41586-021-03380-y. und Kinderpsychiatrie, 61, 8, S. 623-640.
Appelfeld, A. (2018). Geschichte eines Lebens. 5. Auflage. Berlin: Ro- Münker-Kramer, E. (2006). Akute Belastungsreaktion und
wohlt. Posttraumatische Belastungsstörungen. In W. Beigelböck,
S. Feselmayer & E. Honemann (Hrsg.), Handbuch der klinisch-
Bundesministerium für Landesverteidigung (BMLV) (Hrsg.) (2021). Si- psychologischen Behandlung. Zweite, überarbeitete und erweiterte
cher. Und morgen? Die Sicherheitspolitische Jahresvorschau 2021: Auflage. Wien: Springer, S. 293-322.
Herausforderung Blackout – Die nächste Systemkrise in Österreich?
Wien: Heeresdruckzentrum. Münker-Kramer, E. (2009). Eustress – Distress – Extremstress/trauma-
tischer Stress – und was dann? Folgestörungen und Behandlungs-
Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) ansätze. Psychologie in Österreich, 1, S. 54-62.
(2010). Gefährdung und Verletzbarkeit moderner Gesellschaften –
am Beispiel eines großräumigen und langandauernden Ausfalls der Österreichischer Integrationsfonds (ÖIF) – Fonds zur Integration
Stromversorgung. Berlin: Nomos Verlag. von Flüchtlingen und Migrant/innen (Hrsg.)(2020). Wien. Zah-
len, Daten, Fakten zu Migration und Integration. Ergänzende
Eckardt, J. (2013). Kinder und Trauma. Was Kinder brauchen, die einen Anmerkungen zur Statistischen Publikation Bundesländer. Wien:
Unfall, einen Todesfall, eine Katastrophe, Trennung, Missbrauch Bundeskanzleramt. https://www.integrationsfonds.at/mediathek/
oder Mobbing erlebt haben. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. mediathek-publikationen/publikation/wien-l-zahlen-daten-und-
fakten-1-6094.
Energiezelle-F (Hrsg.) (2019). Sicherheitsforschungsprojekt Regionales
Energiezellen- und Krisenvorsorgekonzept am Beispielszenario Sackmann, S., Lindner, S., Gerstmann, S. & Betke, H. (2018). Einbindung
„Blackout“ – Energiezelle Feldbach. Feldbach: Eigenverlag. ungebundener Helfer in die Bewältigung von Schadensereignissen.
In C. Reuter (Hrsg.), Sicherheitskritische Mensch-Computer-Inter-
Folkers, A. (2017). Das Sicherheitsdispositiv der Resilienz. Katastro-
aktion. Springer Vieweg, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-
phische Risiken und die Biopolitik vitaler Systeme. Frankfurt/New
658-19523-6_26.
York: Campus Verlag.
62 Psychologie in Österreich 1 | 2022Theresia Ines Herbst & Herbert Saurugg
„Stromlos ist viel los!“ – Ein proaktiver Umgang mit dem Blackout-Risiko
Voßschmidt, S. & Karsten, A. (2020). Resilienz und Kritische Infrastruk-
turen: Aufrechterhaltung von Versorgungstrukturen im Krisenfall.
Stuttgart: W. Kohlhammer.
Weinberg, D. (2011). Traumatherapie mit Kindern. Strukturierte Trauma-
Intervention und traumabezogene Spieltherapie. Stuttgart: Klett-
Cotta.
AutorInnen
Prof.in Mag.a Theresia Ines Herbst,
Dipl.-Päd.in
ist als Klinische und Gesundheitspsychologin/
Wahlpsychologin in ihrer Praxis in Wien mit dem
Tätigkeitsschwerpunkt Kinder-, Jugend- und
Familienpsychologie niedergelassen. Sie lehrt
als Hochschullehrperson an der Kirchlichen
Pädagogischen Hochschule Wien/Krems im
Primarstufen-Studienschwerpunkt Schulentwicklung/Reform- und
Alternativpädagogik/Montessori-Pädagogik. Jahrelange Tätigkeit als
Pädagogin und Kursleiterin, als Fort- und Weiterbildnerin u. a. im
Bereich (Hoch-)Begabtenförderung, div. Publikationen, Herausgeber-
und internationale Vortragstätigkeit.
Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems
Mayerweckstraße 1
A-1210 Wien
theresia.herbst@kphvie.ac.at
Psychologische Praxis
Furtwänglerplatz 6/2
A-1130 Wien
Telefon: +43 (0)664 5447022
info@kinderpsychologin.at
www.kinderpsychologin.at
Herbert Saurugg, M.Sc., Major a. D.
© Businessfoto Wien
ist internationaler Blackout- und Krisenvorsorge-
experte, Präsident der Österreichischen Gesell-
schaft für Krisenvorsorge (GfKV), Autor zahl-
reicher Publikationen und Keynote-Speaker
sowie Interviewpartner zum Thema „Ein Europa-
weiter Strom-, Infrastruktur- und Versorgungs-
kettenausfall (‚Blackout‘)“. Als ehemaliger
Berufsoffizier beschäftigt er sich seit über 10 Jahren mit der
zunehmenden Komplexität und Fragilität lebenswichtiger Infra-
strukturen sowie mit Lösungsansätzen, um die Versorgung mit
lebenswichtigen Gütern und Dienstleistungen wieder robuster und
die Gesellschaft resilienter zu gestalten. Er betreibt einen umfang-
reichen Fachblog unter www.saurugg.net und unterstützt Gemeinden,
Unternehmen und Organisationen bei der Vorbereitung auf ein
Blackout.
Stüber-Gunther-Gasse 7
A-1120 Wien
Telefon: +43 (0)660 3633896
office@saurugg.net
www.saurugg.net
Psychologie in Österreich 1 | 2022 63Sie können auch lesen