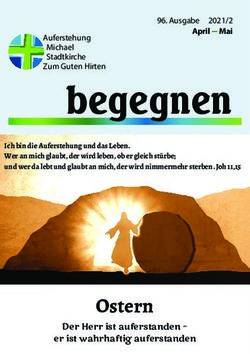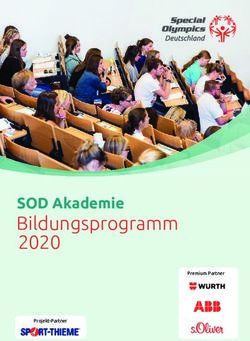Studieren an der Universität Innsbruck - Lehramtsstudien - www.uibk.ac.at
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Studieren an der Universität Innsbruck
Lehramtsstudien
Gültig ab Wintersemester 2010/2011
www.uibk.ac.at
1Inhaltsverzeichnis
Universität Innsbruck................................................................................................ 5
Berufsqualifikation................................................................................................... 6
Berufsaussichten...................................................................................................... 7
Lehramtsstudium in 2 Unterrichtsfächern (Diplomstudium) . ........................................ 9
Pädagogisch-schulpraktische Ausbildung.................................................................. 10
Das Vier-Säulen-Konzept......................................................................................... 11
Studienabschluss und nächste Schritte..................................................................... 11
Unterrichtsfach Bewegung und Sport....................................................................... 12
Unterrichtsfach Biologie und Umweltkunde.............................................................. 13
Unterrichtsfach Chemie ......................................................................................... 14
Unterrichtsfach Deutsch ......................................................................................... 15
Unterrichtsfach Englisch . ....................................................................................... 16
Unterrichtsfach Französisch .................................................................................... 17
Unterrichtsfach Geographie und Wirtschaftskunde ................................................... 18
Unterrichtsfach Geschichte, Sozialkunde, Politische Bildung ...................................... 19
Unterrichtsfach Griechisch ..................................................................................... 20
Unterrichtsfach Informatik und Informatikmanagement............................................. 21
Unterrichtsfach Italienisch ...................................................................................... 22
Unterrichtsfach Katholische Religion........................................................................ 23
Unterrichtsfach Klassische Philologie - Latein............................................................ 24
Unterrichtsfach Mathematik.................................................................................... 25
Unterrichtsfach Physik . .......................................................................................... 26
Unterrichtsfach Russisch . ....................................................................................... 27
Unterrichtsfach Spanisch ........................................................................................ 28
Unterrichtsfach Instrumentalmusikerziehung . .......................................................... 30
Unterrichtsfach Musikerziehung . ............................................................................ 31
Wirtschaftspädagogik............................................................................................. 33
Masterstudium Wirtschaftspädagogik . .................................................................... 34
Katholische Religionspädagogik............................................................................... 37
Bachelorstudium Katholische Religionspädagogik ..................................................... 38
Masterstudium Katholische Religionspädagogik ....................................................... 40
Kontakt und weitere Information............................................................................. 42
Lageplan . ............................................................................................................. 43
3
2 3Universität Innsbruck
Die Universität Innsbruck bildet LehrerInnen für Allge-
mein bildende höhere Schulen (AHS) und für Berufsbil-
dende mittlere und höhere Schulen (BMHS) aus. Hierfür
sind Studien in folgenden Formen eingerichtet:
1. Lehramtsstudium in zwei Unterrichtsfächern (z.B.
Französisch, Geographie und Wirtschaftskunde, Ma-
thematik, Physik)
2. Masterstudium Wirtschaftspädagogik
3. Bachelor- (BA) und Masterstudienprogramm (MA) im
Bereich der Katholischen Religionspädagogik
Ausbildungen für LehrerInnen an anderen Schultypen (1)
bieten die Pädagogischen Hochschulen (z.B. Kirchliche
Pädagogische Hochschule Edith-Stein oder Pädagogi-
sche Hochschule Tirol) an.
(1) z.B. Lehramt an Volks-, Sonder-, Haupt-, Berufs- und Polytechnischen Schulen;
Ernährungspädagogik; Informations- und Kommunikationspädagogik
5
4 5Berufsqualifikation
Ziel des Lehramtsstudiums ist die wissenschaftliche Berufsvorbildung für das Lehramt an Berufsaussichten
Höheren Schulen in fachlicher, fachdidaktischer, pädagogischer und schulpraktischer Hin-
sicht. Durch eine solide wissenschaftliche Grundausbildung sollen die AbsolventInnen in Die Berufschancen für LehrerInnen müssen natürlich
die Lage versetzt werden, sich in ihren Berufsfeldern flexibel und kompetent zu bewähren. für die Bundesländer und die verschiedenen Lehrämter
Die inhaltliche und methodische Pluralität im universitären Lehramtsstudium soll dabei differenziert betrachtet werden. Darüber hinaus sind
Eigeninitiative und Selbstorganisation, ein kritisches Bewusstsein, Kooperation und Team- längerfristige Prognosen für das Berufsfeld LehrerIn an
fähigkeit sowie Leistungsbereitschaft besonders fördern. höheren Schulen kaum zu erstellen, da in den nächsten
Jahren einerseits viele der derzeit berufstätigen Lehre-
Die AbsolventInnen eines Lehramtsstudiums sind LehrerInnen, die vorrangig im schuli- rInnen pensioniert werden, andererseits schon zum jet-
schen, aber auch in anderen Bildungsbereichen eingesetzt werden können. Sie arbeiten zigen Zeitpunkt Wartelisten existieren und des Weiteren
damit in unterschiedlichen gesellschaftlichen, sozialen, historischen, kulturellen, politi- mit rückläufigen SchülerInnenzahlen zu rechnen ist.
schen, rechtlichen und wirtschaftlichen Kontexten eines Schul- und Bildungssystems und
seiner Institutionen. Der Beruf der Lehrerin oder des Lehrers ist ein pädagogischer Beruf: Die Berufschancen sind in gewissem Maß auch abhän-
LehrerInnen sind Fachleute für das Fördern von persönlichen Entwicklungsprozessen, für gig von der gewählten Fächerkombination. Laut aktu-
das Arrangieren von Lernsituationen, für das Begleiten von Lernprozessen und für das ellen Informationen des Landesschulrats für Tirol (Jän-
Beurteilen von Lernergebnissen. ner 2010) gibt es einen hohen Bedarf an LehrerInnen
insbesondere in den naturwissenschaftlich-technischen
Mit den im Lehramtsstudium erworbenen Qualifikationen öffnen sich auch Tätigkeitsmög- Fächern.
lichkeiten in weiteren Bereichen. Besonders zu nennen sind dabei: Nachhilfe- und Erziehe-
rInnentätigkeit, Sozial- und Jugendarbeit, entwicklungspolitische Bildungsarbeit, diverse Einen guten Überblick über die derzeitigen Berufsaus-
Erwachsenenbildungs- und Volkshochschultätigkeiten sowie Tätigkeiten in der Medien- sichten gibt eine Broschüre des AMS: Jobchancen STU-
und Kommunikationsbranche. Wesentliche Bedeutung kommt dem Erwerb verschiedenster DIUM. Lehramt an höheren Schulen (7. aktualisierte
Zusatzqualifikationen zu (z.B. Zweitstudium, „Post-graduate-Ausbildungen“, Fremdspra- Auflage, Oktober 2009)
chen, EDV, Handhabung des Internet, betriebswirtschaftliches Know-how), die eine ent-
scheidende Rolle für die Chancen in außerschulischen Berufsfeldern spielen. http://www.ams.or.at/b_info/download/stlehr.pdf
7
6 7Lehramtsstudium in 2 Unterrichtsfächern
(Diplomstudium)
Das Lehramtsstudium in zwei Unterrichtsfächern ist der-
zeit ein Diplomstudium. Es gliedert sich in zwei Studie-
nabschnitte mit 4 bzw. 5 Semestern. Je nach gewählten
Unterrichtsfächern umfasst das Studium zwischen 160
und 200 Semesterwochenstunden und dauert 9 Semes-
ter. Ziel des Lehramtsstudiums ist die wissenschaftliche
Berufsvorbildung für das Lehramt an Höheren Schulen.
Die Ausbildung zum/zur Lehrer/in umfasst das eigentli-
che Lehramtsstudium, bestehend aus den vier Säulen“)
fachlichen, fachdidaktischen, pädagogischen und schul-
praktischen Bildungsteilen („Vier Säulen“). Die Absol-
vierung des Lehramtsstudiums ist Voraussetzung für die
Lehrtätigkeit an allgemein bildenden und berufsbilden-
den Schulen.
Die fachliche und fachdidaktische Ausbildung erfolgt an
den jeweiligen Fachinstituten in zwei an der LFU Inns-
bruck eingerichteten Unterrichtsfächern (Ausnahmen:
Wirtschaftspädagogik und Katholische Religionspäda-
gogik), wobei die Entscheidung über das „erste“ Unter-
richtsfach bis zur Anmeldung zu den Diplomprüfungen
fallen muss.
Die pädagogische und schulpraktische Ausbildung er-
folgt am Institut für LehrerInnenbildung und Schulfor-
schung (ILS) unabhängig von der gewählten Kombinati-
on von Unterrichtsfächern.
Den Abschluss des Lehramtsstudiums bilden eine Dip-
lomarbeit (nach Wahl aus einem der beiden Unterrichts-
fächer im fachlichen oder fachdidaktischen Bereich) und
die Diplomprüfung mit anschließender Verleihung des
Magistertitels.
9
8 9Pädagogisch-schulpraktische Ausbildung Das Vier-Säulen-Konzept
Die pädagogischen und schulpraktischen Ausbildungsanteile stellen zwei Säulen des Lehr- Nach Einjähriges Unterrichtspraktikum (früher „Probejahr“)
amtsstudiums dar und werden vom Institut für LehrerInnenbildung und Schulforschung (ILS) Studienabschluss durchgeführt von den Landesschulräten
angeboten. Diplomarbeit, 2. Teil der 2. Diplomprüfung
Zweiter 1. Teil der 2. Diplomprüfung, Diplomarbeit
Studienabschnitt
Die pädagogische Ausbildung im Lehramtsstudium umfasst pro Unterrichtsfach 8 Semester- Abschlussphase
stunden, daher insgesamt 16 Semesterstunden, und besteht aus drei Teilen: Fünf Semester Fach Fachdidaktik Fach Fachdidaktik
5. - 9. Pädagogik Praktika
» Die Eingangsphase umfasst vier Semesterstunden Pflichtfächer. 1. Diplomprüfung
» Die Ausbildungsphase umfasst zehn Semesterstunden, davon sechs Semesterstunden Erster
Pflichtfächer und ein Wahlfachmodul mit vier Semesterstunden. Studienabschnitt
Fach Fachdidaktik Fach Fachdidaktik Pädagogik
» Die Abschlussphase umfasst zwei Semesterstunden Pflichtfächer.
Vier Semester
1. - 4.
Die schulpraktische Ausbildung im Lehramtsstudium umfasst 12 Wochen mit 120 Stunden E i n g a n g s p h a s e
(= 8 Semesterstunden) pro Unterrichtsfach, daher insgesamt mit 240 Stunden (= 16 Semes- Unterrichtsfach 1 Unterrichtsfach 2 Unterrichtsfächer 1+2
terstunden), und besteht aus fünf Teilen:
Fach Fachdidaktik Fach Fachdidaktik Pädagogik Schulpraxis
» Das Eingangspraktikum umfasst zwei Semesterstunden.
» Das Basispraktikum umfasst vier Semesterstunden.
» Das Fachpraktikum 1 umfasst vier Semesterstunden. Studienabschluss und nächste Schritte
» Das Fachpraktikum 2 umfasst vier Semesterstunden.
» Das Abschlusspraktikum umfasst zwei Semesterstunden. Nach Erlangung des akademischen Grades eines Magisters bzw. einer Magistra der Na-
turwissenschaften (Mag. rer. nat.), der Geisteswissenschaften (Mag. phil.), der Theologie
(Mag. theol.) bzw. eines künstlerischen Unterrichtsfaches (Mag. art.) folgt das einjährige
Kontakt und Information Unterrichtspraktikum an der Schule, sowie ein Lehrgang für UnterrichtspraktikantInnen.
Das Unterrichtspraktikum wird durch das Unterrichtspraktikumsgesetz geregelt, von den
Ass.-Prof. Mag. Dr. Erich Mayr jeweiligen Landesschulräten organisiert und durch einen Lehrgang „Unterrichtspraktikum“
Telefon +43 512 507-4654 begleitet. Während des Unterrichtspraktikums steht man in einem Ausbildungsverhältnis,
E-Mail Erich.Mayr@uibk.ac.at das mit einem monatlichen Ausbildungsbeitrag abgegolten wird. Für diesen Zeitraum be-
Homepage www.uibk.ac.at/ils steht auch Versicherungsschutz (Kranken-Unfall-, Pensions- und Arbeitslosenversicherung).
11
10 11Lehramtsstudium Lehramtsstudium
Unterrichtsfach Bewegung und Sport Unterrichtsfach Biologie und Umweltkunde
Dauer / ECTS-AP 9 Semester / 270 ECTS-AP Dauer / ECTS-AP 9 Semester / 270 ECTS-AP
Akademischer Grad Magistra/Magister der Naturwissenschaften (Mag.rer.nat.) (Kombination von zwei Unterrichtsfächern)
Studienkennzahl C 482 Akademischer Grad Magistra/Magister der Naturwissenschaften (Mag.rer.nat.)
Studienplan Mitteilungsblatt vom 13.09.2001, 68. Stück, Nr. 831 * Studienkennzahl C 445
Voraussetzung Matura oder Äquivalent Studienplan Mitteilungsblatt vom 11.09.2001, 67. Stück, Nr. 830*
Zusatzprüfung Die Ergänzungsprüfung der körperlich-motorischen Eignung muss vor der Zu- Mitteilungsblatt vom 23.04.2007, 28. Stück, Nr. 191*
lassung zum Studium nachgewiesen werden. Voraussetzung Matura oder Äquivalent
Zusatzprüfung Die Zusatzprüfung aus Biologie und Umweltkunde ist vor Zulassung zum
*Alle Studienpläne finden Sie online unter: www.uibk.ac.at/studium/curricula Studium abzulegen, wenn dieses Fach nicht nach der 8. Schulstufe an einer
höheren Schule (an der Oberstufe) erfolgreich absolviert wurde.
Kurzbeschreibung *Alle Studienpläne finden Sie online unter: www.uibk.ac.at/studium/curricula
Ziel des universitären Lehramtsstudiums ist die wissenschaftliche Berufsvorbildung für das
Lehramt an Allgemeinbildenden höheren Schulen (AHS) und für Berufsbildende mittlere Kurzbeschreibung
und höhere Schulen in fachlicher, fachdidaktischer, pädagogischer und schulpraktischer
Hinsicht. Durch eine solide wissenschaftliche Grundausbildung sollen die AbsolventInnen Die fachliche Ausbildung umfasst 100 Semesterwochenstunden. In den Prüfungsfächern
befähigt werden, sich im Unterricht flexibel und kompetent zu bewähren. Botanik, Zoologie und Allgemeine Biologie werden Grundlagen der Systematik, eine
basale Formenkenntnis der einheimischen Tier- und Pflanzenwelt, Kenntnisse über die
Im Studium sollen Eigeninitiative und Selbstorganisation, kritisches Bewusstsein, Koopera- Zelle als Grundbaustein des Lebens und Ausgangspunkt für die Entwicklung und Evolution,
tion und Teamfähigkeit sowie Leistungsbereitschaft besonders gefördert werden. Für das Grundwissen der Genetik als Voraussetzung für das Verständnis der Molekular- und
Unterrichtsfach Bewegung und Sport werden folgende Qualifikationen vermittelt: Evolutionsbiologie und Grundlagen der Physiologie auf dem Niveau der Zelle, Organe und
Organismen vermittelt.
» Sportwissenschaftliche Kenntnisse in Sportpädagogik, Sportpsychologie, Sportsoziologie Die Inhalte der Prüfungsfächer Ökologie und Erdwissenschaften dienen dem
und Sportgeschichte; Bewegungswissenschaften und Biomechanik; Trainingswissen- Erwerb von ökologischem Grundwissen als Basis für eine fundierte Umwelterziehung im
schaften und Sportmedizin (Anatomie, Physiologie, Orthopädie); Sinne der Vernetzung von belebter und unbelebter Natur.
» Sportliches Leistungsniveau als Grundlage didaktischer, methodischer, sicherheitsbezo-
gener und motivationaler Maßnahmen in Grundsportarten, motorischer Fitness und aus- Im Fach Humanbiologie stehen Aspekte der Ernährung, Psychosomatik, Sexual- und
gewählten Trendsportarten; Gesundheitserziehung sowie Ressourcennutzung und Umweltbelastung im Vordergrund.
» Kritische Einschätzung des Kulturphänomens Sport in Ausstrahlung auf Werthierarchie,
Lebensqualität, Umwelt, Politik und Wirtschaft; Ein besonderer Schwerpunkt der Ausbildung liegt in der Vermittlung von biologierelevanten
» Kenntnisse fachspezifischer Forschungsmethoden (Methoden der empirischen Sozialfor- fachdidaktischen Kompetenzen:
schung, motorische Testverfahren, biomechanische Prüfverfahren, Methoden der Aus-
wertung und Ergebnispräsentation) » Fertigkeiten im Umgang mit dem Mikroskop und für einen modernen Biologie-
» Fachdidaktische Kompetenzen in den Grundsportarten des Sportunterrichts; Kompetente Unterricht notwendigen Laborgeräten;
Ausbildung in Sicherheit bei der Sportausübung und Hilfestellung; » Planung und Gestaltung von Arbeiten im Freiland;
» Anpassungsfähigkeit in der Unterrichtsgestaltung an unterschiedliche räumliche und ge- » die Fähigkeit, die SchülerInnen für die Natur zu begeistern und
rätespezifische Ausstattung; Begeisterungsfähigkeit. » die Fähigkeit, die SchülerInnen zu selbstständigem forschenden Lernen anzuregen.
Kontakt und Information Kontakt und Information
Ass.-Prof. Mag.Dr. Inge Werner Mag. Daniela Holzer ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Erwin Meyer
Telefon +43 512 507-4484 Telefon +43 512 507-96126 Telefon +43 512 507-6142
E-Mail Inge.Werner@uibk.ac.at E-Mail dekanat-psychsport@uibk.ac.at E-Mail Erwin.Meyer@uibk.ac.at
13
12 13Lehramtsstudium Lehramtsstudium
Unterrichtsfach Chemie Unterrichtsfach Deutsch
Dauer / ECTS-AP 9 Semester / 270 ECTS-AP Dauer / ECTS-AP 9 Semester / 270 ECTS-AP
(Kombination von zwei Unterrichtsfächern) (Kombination von zwei Unterrichtsfächern)
Akademischer Grad Magistra/Magister der Naturwissenschaften (Mag.rer.nat.) Akademischer Grad Magistra/Magister der Philosophie (Mag.phil.)
Studienkennzahl C 423 Studienkennzahl C 333
Studienplan Mitteilungsblatt vom 11.09.2001, 67. Stück, Nr. 830* Studienplan Mitteilungsblatt vom 13.09.2001, 68. Stück, Nr. 831 *
Mitteilungsblatt vom 23.04.2007, 28. Stück, Nr. 191* Voraussetzung Matura oder Äquivalent
Voraussetzung Matura oder Äquivalent Zusatzprüfung Die Zusatzprüfung aus Latein ist bis zur vollständigen Ablegung der ersten Di-
plomprüfung, nachzuweisen, wenn dieses Fach nicht an einer höheren Schule
*Alle Studienpläne finden Sie online unter: www.uibk.ac.at/studium/curricula im Ausmaß von mindestens 10 Wochenstunden erfolgreich absolviert wurde.
Kurzbeschreibung *Alle Studienpläne finden Sie online unter: www.uibk.ac.at/studium/curricula
Die AbsolventInnen sollen folgende fachliche Kompetenzen erwerben: » Kenntnisse in Anor-
ganischer Chemie, Analytischer Chemie, Physikalischer Chemie, Theoretischer Chemie, Orga- Kurzbeschreibung
nischer Chemie und Biochemie » Verstehen und Präsentieren der Lehrinhalte des Lehrplans
Chemie an höheren Schulen. » Fähigkeit, durch eigene Beobachtungen aus Experimenten die Die Ausbildung des Lehramtsstudiums Deutsch umfasst im Fachstudium den Erwerb von
allgemeinen Gesetze der Chemie abzuleiten, sowie diese Gesetze zur Erklärung von Beobach- fachlichen und fachdidaktischen Kenntnissen und Kompetenzen. Die wissenschaftliche
tungen des täglichen Lebens anzuwenden. » Übung im Umgang mit chemischen Substanzen Auseinandersetzung mit der deutschen Sprache und Literatur in Geschichte und Gegenwart
Fächer / Module
undRahmen
Im das Beherrschen chemischer Arbeitstechniken,
des Pharmaziestudiums wird Wissen aus um im Unterricht
verschiedenen verantwortungsvoll
Fächern mit
vermittelt, wobei sowie mit den damit zusammenhängenden soziokulturellen und gesellschaftlichen Prozessen
Chemikalien umzugehen. » Kritische
eine Gliederung in die vier Kernfächer Beurteilung des Stellenwerts der chemischen Produkte soll die AbsolventInnen befähigen, auf der Basis einer soliden Fachkompetenz den Bil-
für den Lebensstandard, aber auch der Risiken dieser Produkte für Mensch und Umwelt. dungs- und Lehraufgaben sowie den didaktischen Anforderungen so gerecht zu werden,
» Fähigkeit,
» neue Entwicklungen der Chemie durch eigenständiges Literaturstudium zu erfah-
Pharmakognosie, dass der Unterricht sowohl den altersspezifischen Voraussetzungen der SchülerInnen und der
ren.Pharmakologie
» » Dokumentationund der Ergebnisse von Experimenten in wissenschaftlicher Weise. Die fach-
Toxikologie, Lebenswelt der Jugendlichen als auch den unterschiedlichen spezifischen Ausbildungszielen
» Pharmazeutische Chemiedie
didaktische Ausbildung soll Studierenden befähigen, durch Auswahl von geeigneten Expe-
sowie der verschiedenen Schultypen entspricht. Prinzipiell werden in der Ausbildung auch die
rimenten und Beobachtungen SchülerInnen
» Pharmazeutische Technologie vorgenommen die Methoden des Wissenserwerbs auf dem Gebiet
werden kann. sozialen, politischen und interkulturellen Möglichkeiten und Perspektiven der Beschäfti-
der Chemie nahezubringen, die Vernetzung der Chemie mit Medizin, Pharmazie, Biologie und gung mit Sprache und Literatur berücksichtigt, damit kulturelle Vielfalt und Mobilität als
Ökologie
Diese aufzuzeigen
Kernfächer unddie
stellen mitPrüfungsfächer
naturwissenschaftlicher Denkweise
des zweiten vertraut zu dar.
Studienabschnitts machen. Chance und Aufgabe wahrgenommen werden können. Obwohl das Lehramtsstudium
Deutsch der wissenschaftlichen Berufsvorbereitung für die Allgemeinbildenden höheren
Fächer
Die Lehrveranstaltungen des ersten Studienabschnitts dienen der Vermittlung des erfor- Schulen (AHS) und Berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS) dient, erwerben
» Mathematik
derlichen und Physik
Grundlagenwissens » Organische
in Mathematik, Physik, Chemie,
EDV, Chemie Organisch-chemische
und Analytik, Biologie, die AbsolventInnen dabei auch Kompetenzen und Fertigkeiten, die über das Berufsfeld der Schu-
» Allgemeine
Hygiene Chemie, Umweltchemie,
und Mikrobiologie, Ge-
Anatomie, (Patho-) Arbeitsmethoden,
Physiologie und ErsteOrganisch-chemisches
Hilfe. Diese Lehrver- le hinaus, beispielsweise für den Bereich der Erwachsenenbildung, von großer Bedeutung sind.
fahrenstoffe,sind
anstaltungen Praktikum
folgendenauspropädeutischen Praktikum, Spektroskopie,
Allgemeiner Prüfungsfächern zugeordnet:Angewandte or-
Propädeutische Das Lehramtstudium Deutsch umfasst 72 Semesterstunden und dauert neun Semester. Von
Chemie und zu Chemie in wässriger Lö- ganische Chemie, Stereochemie, Heterocyc-
biologisch-medizinische Fächer, Propädeutische chemische Fächer, Interdisziplinäre Fächer. den 72 Semesterstunden entfallen 64 Semesterstunden auf die fachliche und fachdidakti-
sung, Chemie der Hauptgruppenelemente lenchemie sche Ausbildung. Von diesen sind acht Semesterstunden freie Wahlfächer.
»
DieAnalytische Grundvorlesung,
Lehrveranstaltungen Analytisches
des dritten » Physikalische
Studienabschnitts Chemie,
sind den Physikalisch-chemi-
Prüfungsfächern Spezielle Der erste Studienabschnitt versteht sich als Grundstudium und dient der Einführung in
Grundpraktikum
Pharmazie (Quantitative
1 bzw. Spezielle Analyse)
Pharmazie In- sches
2 zugeordnet. ImPraktikum
Rahmen dieser Lehrveranstaltungen die Grundlagen des Studiums und der Erarbeitung der theoretisch-methodischen und
strumentalanalytisches
erfolgt eine Weiterführung Praktikum, Umwelt- des» Kernwissens,
und Vertiefung Biochemie, Biochemisches Praktikum
eine Spezialisierung und die inhaltlichen Voraussetzungen des Unterrichtsfaches. Der zweite Studienabschnitt dient der
analytik: Wasser-,
Vorbereitung Boden- und Luftanalytik
zum eigenständigen » Praktikum aus(Diplomarbeit).
wissenschaftlichenArbeiten Theoretischer Chemie Erweiterung und Vertiefung im Sinne der wissenschaftlichen Berufsvorbereitung.
» Makromolekulare Chemie » Fachdidaktik
Kontakt und Information
Kontakt und Information Institut für Germanistik: www.uibk.ac.at/germanistik
ao.Univ.-Prof. Mag.Dr. Peter Jaitner ao.Univ.-Prof. Dr. Benno Bildstein ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Wolfgang Hackl
Telefon +43 512 507-5111 Telefon +43 512 507-5141 Telefon +43 512 507-4129
E-Mail Peter.Jaitner@uibk.ac.at E-Mail Benno.Bildstein@uibk.ac.at E-Mail Wolfgang.F.Hackl@uibk.ac.at
15
14 15Lehramtsstudium Lehramtsstudium
Unterrichtsfach Englisch Unterrichtsfach Französisch
Dauer / ECTS-AP 9 Semester / 270 ECTS-AP Dauer / ECTS-AP 9 Semester / 270 ECTS-AP
(Kombination von zwei Unterrichtsfächern) (Kombination von zwei Unterrichtsfächern)
Akademischer Grad Magistra/Magister der Philosophie (Mag.phil.) Akademischer Grad Magistra/Magister der Philosophie (Mag.phil.)
Studienkennzahl C 344 Studienkennzahl C 347
Studienplan Mitteilungsblatt vom 13.09.2001, 68. Stück, Nr. 831 * Studienplan Mitteilungsblatt vom 13.09.2001, 68. Stück, Nr. 831 *
Voraussetzung Matura oder Äquivalent Voraussetzung Matura oder Äquivalent
Zusatzprüfung Die Zusatzprüfung aus Latein ist bis zur vollständigen Ablegung der ersten Di- Zusatzprüfung Die Zusatzprüfung aus Latein ist bis zur vollständigen Ablegung der ersten Di-
plomprüfung, nachzuweisen, wenn dieses Fach nicht an einer höheren Schule plomprüfung, nachzuweisen, wenn dieses Fach nicht an einer höheren Schule
im Ausmaß von mindestens 10 Wochenstunden erfolgreich absolviert wurde. im Ausmaß von mindestens 10 Wochenstunden erfolgreich absolviert wurde.
*Alle Studienpläne finden Sie online unter: www.uibk.ac.at/studium/curricula *Alle Studienpläne finden Sie online unter: www.uibk.ac.at/studium/curricula
Kurzbeschreibung
Kurzbeschreibung
Ziel des Lehramtsstudiums aus Französisch ist die wissenschaftliche Berufsvorbereitung für
Ziel des Lehramtsstudiums Englisch ist die wissenschaftliche Berufsvorbereitung für die das Lehramt an Allgemeinbildenden höheren Schulen (AHS) und Berufsbildenden mittleren
Unterrichtstätigkeit an Allgemein bildenden höheren Schulen (AHS) und Berufsbildenden und höheren Schulen (BMHS) und außerschulischen Bildungsinstitutionen. Das Studium
mittleren und höheren Schulen (BMHS) sowie an außerschulischen Bildungsinstitutionen. bietet eine fachliche, eine fachdidaktische sowie eine allgemein pädagogische Ausbildung,
Durch dieses Studium sollen zukünftige EnglischlehrerInnen befähigt werden, kompetent, die zukünftigen Fremdsprachenlehrenden Kompetenz, Flexibilität und Sicherheit für ihren
flexibel und sicher in ihrem Beruf zu agieren. Da kompetentes Agieren im Unterricht Beruf gewährleistet. Die fachliche Ausbildung umfasst die Bereiche Literatur- und Sprach-
nur durch Souveränität in der eigenen Sprachbeherrschung möglich ist, spielt intensiver wissenschaft, Landes- und Kulturkunde sowie Sprachbeherrschung.
Sprachunterricht eine zentrale Rolle im Rahmen der Ausbildung, wobei sich der
Sprachunterricht nicht nur auf die eigens dafür vorgesehenen Lehrveranstaltungen Die Studierenden erhalten Einblicke in die Literatur- und Kulturgeschichte, lernen Texte
beschränkt, sondern auch in anderen Prüfungsfächern Berücksichtigung findet, kritisch zu verstehen und zu analysieren, werden mit Inhalten der Sprachwissenschaft ver-
in deren Rahmen sämtliche Lehrveranstaltungen in englischer Sprache abgehalten traut gemacht und setzen sich mit sozialen, politischen und historischen Aspekten der
werden. Diese anderen Prüfungsfächer sind Linguistics and Culture, English Literature and Zielländer auseinander.
Culture, American Literature and Culture sowie Fachdidaktik.
Die fachdidaktische Ausbildung will die zukünftigen SprachlehrerInnen in die Lage
Die Kenntnis der Sprachwissenschaft dient dabei einem vertieften Verständnis der Struktur versetzen, sich ein breites Methodenrepertoire aufzubauen, um einen reflektierten,
und Entwicklung der englischen Sprache in ihren verschiedensten Erscheinungsformen schülerInnenzentrierten, handlungsorientierten und kommunikativen Fremdsprachenunter-
(„New Englishes“). Die Auseinandersetzung mit English Literature and Culture dient dem richt, der sich am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GERS) und am
Verständnis der Entwicklung der englischen und postkolonialen Kulturen, während sich das neuesten Stand der Spracherwerbs-, Sprachlern- und Sprachbewertungsforschung ausrich-
Fach American Literature and Culture in erster Linie mit der nordamerikanischen Literatur tet, konstruktiv und kreativ gestalten zu können. Die fachdidaktische Ausbildung ist in
und Kultur befasst. In den fachdidaktischen Lehrveranstaltungen werden die Studierenden – das mit dem „Europasiegel für innovative Sprachenprojekte“ ausgezeichnete „Innsbrucker
zusätzlich zur allgemein pädagogischen und schulpraktischen Ausbildung – auf ihre Zukunft Modell der Fremdsprachendidaktik (IMoF)“ eingebunden, das sprachenübergreifende
als LehrerInnen vorbereitet. Dies geschieht zusammen mit anderen Fremdsprachen im Rah- Module anbietet und bereits in der Ausbildung eine gute Kooperation zwischen den
men des „Innsbrucker Modells der Fremdsprachendidaktik“ (IMoF). Sprachfächern an den Schulen fördert.
Kontakt und Information Kontakt und Information
Institut für Anglistik: www.uibk.ac.at/anglistik Institut für Romanistik: www.uibk.ac.at/romanistik
Institut für Amerikastudien: www.uibk.ac.at/amerikastudien Ass.-Prof. Mag. Dr. Werner Marxgut Ass.-Prof. Mag. Dr. Barbara Hinger
Ass.-Prof. Mag. Dr. Gerhard Pisek Telefon +43 512 507-4207 Telefon +43 512 507-4206
Telefon +43 512 507-4157, E-Mail Gerhard.Pisek@uibk.ac.at E-Mail Werner.Marxgut@uibk.ac.at E-Mail Barbara.Hinger@uibk.ac.at
17
16 17Lehramtsstudium Lehramtsstudium
Unterrichtsfach Geographie und Wirtschaftskunde Unterrichtsfach Geschichte, Sozialkunde, Politische Bildung
Dauer / ECTS-AP 9 Semester / 270 ECTS-AP Dauer / ECTS-AP 9 Semester / 270 ECTS-AP
(Kombination von zwei Unterrichtsfächern) (Kombination von zwei Unterrichtsfächern)
Akademischer Grad Magistra/Magister der Naturwissenschaften (Mag.rer.nat.) Akademischer Grad Magistra/Magister der Philosophie (Mag.phil.)
Studienkennzahl C 456 Studienkennzahl C 313
Studienplan Mitteilungsblatt vom 11.09.2001, 67. Stück, Nr. 830 * Studienplan Mitteilungsblatt vom 13.09.2001, 68. Stück, Nr. 831 *
Mitteilungsblatt vom 23.04.2007, 28. Stück, Nr. 191* Voraussetzung Matura oder Äquivalent
Voraussetzung Matura oder Äquivalent Zusatzprüfung Die Zusatzprüfung aus Latein ist bis zur vollständigen Ablegung des Bache-
lorstudiums nachzuweisen, wenn dieses Fach nicht an einer höheren Schule
*Alle Studienpläne finden Sie online unter: www.uibk.ac.at/studium/curricula im Ausmaß von mindestens 10 Wochenstunden erfolgreich absolviert wurde.
*Alle Studienpläne finden Sie online unter: www.uibk.ac.at/studium/curricula
Kurzbeschreibung
Das Lehramtsstudium Geographie und Wirtschaftskunde (GW) integriert die Geographie als Kurzbeschreibung
Umwelt- und Raumwissenschaft mit den Wirtschaftswissenschaften unter fachdidaktischen
Aspekten. Das Lehramtsstudium GW dauert neun Semester. Es ist in zwei Studienabschnitte Das Lehramtsstudium Geschichte, Sozialkunde, Politische Bildung dient dem Erwerb von fach-
(4+5 Semester) unterteilt und umfasst in 90 Semesterstunden die Prüfungsfächer Allgemeine lichen Kenntnissen und methodischen Fertigkeiten, die Studierende auf eine fundierte Ver-
Fächer / Module
Geographie, Regionalgeographie, mittlung von Geschichte mit allen gesellschaftlichen und politischen Dimensionen vorbereiten.
Im Rahmen des PharmaziestudiumsGeographische Arbeitstechniken,
wird Wissen aus Wirtschaftskunde
verschiedenen Fächern sowie
vermittelt, wobei
Fachdidaktik. Dazu kommen freie Wahlfächer im Ausmaß von neun Semesterstunden. Die An- Im ersten Studienabschnitt (vier Semester) werden Grundkenntnisse über die wesentlichen
eine Gliederung in die vier Kernfächer
zahl der zu absolvierenden Semesterstunden der pädagogischen Ausbildung beträgt in jedem historischen Entwicklungen in den Kernfächern Alte Geschichte, Mittelalterliche Geschich-
Unterrichtsfach acht Semesterstunden. Die schulpraktische Ausbildung dauert – genauso wie te, Geschichte der Neuzeit, Zeitgeschichte, Österreichische Geschichte sowie Wirtschafts-
» Pharmakognosie,
in jedem anderen Unterrichtsfach und Sozialgeschichte vermittelt.
» Pharmakologie und Toxikologie,– sechs Wochen (bzw. acht Semesterstunden).
Im zweiten Studienabschnitt (fünf Semester) vertiefen Studierende die Kenntnisse von Ent-
» Pharmazeutische Chemie sowie
Neben allgemeinen didaktischen wicklungen und Zusammenhängen der historischen Teilabschnitte. Gleichzeitig wird ein
» Pharmazeutische Technologie Fähigkeiten,
vorgenommen wiewerden
kritische Interpretation und Umsetzung der
kann.
jeweiligen Fachlehrpläne an Allgemeinbildende höhere Schulen (AHS) und Berufsbildende kritisches Bewusstsein gegenüber der Geschichte und Geschichtswissenschaft gefördert.
mittlere und höhere Schulen Ein weiterer Schwerpunkt im zweiten Studienabschnitt liegt in der Vermittlung von Kennt-
Diese Kernfächer stellen die (BMHS) werden Kompetenzen
Prüfungsfächer in folgenden Bereichen
des zweiten Studienabschnitts dar. gefördert:
nissen in Sozialkunde und in Politischer Bildung. Ein breites Angebot an Wahlfächern aus
» dem historisch-sozialwissenschaftlichen, kulturwissenschaftlichen und rechtswissenschaft-
DieRäumliche Orientierung des
Lehrveranstaltungen auf verschiedenen bedingungen
ersten Studienabschnitts dienenderderGlobalisierung
Vermittlung des erfor-
Maßstabsebenen » Mikro- undChemie
Makroökonomie lichen Bereich rundet die fachliche Ausbildung ab.
derlichen Grundlagenwissens in Mathematik, Physik, EDV, und Analytik, Biologie,
» Gestaltung und kritische Interpretation Parallel dazu erfolgt in beiden Studienabschnitten eine fachdidaktische Ausbildung,
Hygiene und Mikrobiologie, Anatomie, (Patho-)» Physiologie
Wirtschafts-und
undErste
Sozialpolitik
Hilfe. Diese Lehrver-
von Karten und welche die Studierenden speziell auf die Vermittlung historischer Kenntnisse und
anstaltungen sind kartenverwandten » Gesellschaftstheorien
folgenden propädeutischen Prüfungsfächern zugeordnet: Propädeutische
Darstellungen Kompetenzen im Unterrichtsfach Geschichte- und Sozialkunde / Politische Bildung vor-
biologisch-medizinische Fächer, Propädeutische »chemische
Bevölkerung, Siedlung
Fächer, und Raumplanung
Interdisziplinäre Fächer.
» Geoökologische Gliederung der Erde » Regionale Differenzierung der Wirtschaft bereitet. Unterrichtsplanung und -gestaltung und eine praxisorientierte didaktische und
» methodische Umsetzung historischer Themen stehen dabei im Mittelpunkt.
DieProzesse und Systemzusammenhänge
Lehrveranstaltungen im » Anwendung
des dritten Studienabschnitts von Prüfungsfächern
sind den EDV im UnterrichtSpezielle
Natur- und Kulturraum unter den Rahmen- Die allgemein pädagogische Ausbildung erfolgt am Institut für LehrerInnenbildung und
Pharmazie 1 bzw. Spezielle Pharmazie 2 zugeordnet. Im Rahmen dieser Lehrveranstaltungen
Schulforschung. Die Auseinandersetzung mit der Geschichte und das daraus resultierende
erfolgt eine Weiterführung und Vertiefung des Kernwissens, eine Spezialisierung und die
Der erste Studienabschnitt wird mit wissenschaftlichenArbeiten
der ersten Diplomprüfung, der zweite Studienabschnitt mit historisch fundierte Verständnis erlauben einen möglichst vorurteilsfreien, sachlich
Vorbereitung zum eigenständigen (Diplomarbeit).
der zweiten Diplomprüfung abgeschlossen. analytischen Zugang zu aktuellen Problemen der Gegenwart.
Kontakt und Information Kontakt und Information
ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Ernst Steinicke Mag. Dr. Brigitte Truschnegg Mag Dr. Irmgard Plattner
Telefon +43 512 507-5408 Telefon +43 512 507-37659 Telefon +43 512 507-4369
E-Mail Ernst.Steinicke@uibk.ac.at E-Mail Brigitte.Truschnegg@uibk.ac.at E-Mail Irmgard.Plattner@uibk.ac.at
19
18 19Lehramtsstudium Lehramtsstudium
Unterrichtsfach Griechisch Unterrichtsfach Informatik und Informatikmanagement
Dauer / ECTS-AP 9 Semester / 270 ECTS-AP Dauer / ECTS-AP 9 Semester / 270 ECTS-AP
(Kombination von zwei Unterrichtsfächern) (Kombination von zwei Unterrichtsfächern)
Akademischer Grad Magistra/Magister der Philosophie (Mag.phil.) Akademischer Grad Magistra/Magister der Naturwissenschaften (Mag.rer.nat.)
Studienkennzahl C 341 Studienkennzahl C 884
Studienplan Mitteilungsblatt vom 13.09.2001, 68. Stück, Nr. 831 * Studienplan Mitteilungsblatt vom 11.09.2001, 67. Stück, Nr. 830 *
Voraussetzung Matura oder Äquivalent Mitteilungsblatt vom 23.04.2007, 28. Stück, Nr. 191/192 *
Zusatzprüfung Die Zusatzprüfung aus Griechisch ist vor Zulassung zum Studium abzulegen, Voraussetzung Matura oder Äquivalent
wenn dieses Fach nicht nach der 8. Schulstufe an einer höheren Schule im
Ausmaß von mindestens 10 Wochenstunden erfolgreich absolviert wurde. *Alle Studienpläne finden Sie online unter: www.uibk.ac.at/studium/curricula
Die Zusatzprüfung aus Latein ist bis zur vollständigen Ablegung der ersten Kurzbeschreibung
Diplomprüfung abzulegen, wenn dieses Fach nicht an einer höheren Schule
im Ausmaß von mindestens 10 Wochenstunden erfolgreich absolviert wurde.
Die AbsolventInnen des Lehramtsstudiums im Unterrichtsfach Informatik und Informatik-
*Alle Studienpläne finden Sie online unter: www.uibk.ac.at/studium/curricula management sollen in der Lage sein,
» jenen Teil der Informatik, der an allgemeinbildenden und berufsbildenden höheren Schulen
Kurzbeschreibung unterrichtet wird, einfach und verständlich zu erklären und zu motivieren – Grundvoraus-
Wichtigster Inhalt des Lehramtsstudiums Griechisch ist die griechische Literatur, der wir ei- setzung dafür ist, diese Bereiche der Informatik und ihre wissenschaftlichen Hintergründe
nige der wichtigsten Basistexte der europäischen Kultur verdanken. Die Lektüre erfolgt im und Zusammenhänge sehr gut zu kennen und zu beherrschen;
Original und in Übersetzung. Im Vordergrund stehen Autoren verschiedenster Gattungen » SchülerInnen den praktischen Einsatz der Informatik in Beruf und Alltag zu vermitteln;
und Epochen wie z.B. Homer, Sophokles, Aristophanes, Platon und Plutarch. » den Lehrplan kritisch zu interpretieren und die Qualität von Schulbüchern zu beurteilen;
Weitere wichtige Bereiche des Studiums umfassen die griechische Sprache (hier werden die » sich gegebenenfalls neue Lehrplaninhalte selbstständig zu erarbeiten;
im Gymnasium oder anderweitig erworbenen Kenntnisse weiter ausgebaut), das Fortleben » in der Schule als ExpertIn für Informatik zu fungieren (z.B. Beratung bei Anschaffung
der Antike in der europäischen Kultur (Rezeptionsgeschichte), moderne Literaturtheorie und von Hard- und Software, Installation von Software, Betreuung von Netzwerken);
Nachbardisziplinen wie Geschichte, Archäologie und Philosophie. » über die gesellschaftliche Bedeutung der Informatik und der Informationstechnologie zu
Neben der allgemein pädagogischen und schulpraktischen Ausbildung werden die Studie- informieren.
renden in fachdidaktischen Lehrveranstaltungen auf ihre Zukunft als GriechischlehrerInnen
vorbereitet. Dabei gewinnen sie z.B. Einblick in die neuesten Lehr- und Lernmethoden oder Im Rahmen der fachlichen Ausbildung sind Lehrveranstaltungen über Programmieren,
die Grundzüge des Prüfens und Bewertens. Da das Studium in das mit dem „Europasie- Anwendersoftware, Betriebssysteme und Rechnernetze, Mathematik und Physik zu
gel für innovative Sprachenprojekte“ ausgezeichnete „Innsbrucker Modell der Fremdspra- absolvieren. Dabei wird auch die Denk- und Arbeitsweise der Informatik (z.B. exaktes Argu-
chendidaktik (IMoF)“ eingebunden ist, haben einige fachdidaktische Lehrveranstaltungen mentieren, sachliches und vorurteilsfreies Denken, zielgerichtetes Arbeiten) eingeübt. Die
sprachenübergreifenden Charakter, d.h. sie werden von Studierenden verschiedener Spra- Studierenden sollen während des Studiums einen ausreichenden Einblick in die Aufgaben
chen gemeinsam besucht. und Methoden der Informatik gewinnen und deren Möglichkeiten und Grenzen abschätzen
Die Schule ist jedoch nicht die einzige Zukunftsperspektive für Griechisch-Lehramtskandidat- können.
Innen: Weil die Beschäftigung mit unseren antiken Wurzeln sehr viel kulturelles Grund-
wissen, einen hohen Grad an Allgemeinbildung und zahlreiche „Soft Skills“ vermittelt, In den Lehrveranstaltungen aus Didaktik der Informatik lernen die Studierenden grundle-
sind sie auch in anderen Berufssparten gerne gesehen. gende Theorien und Modelle für die Planung, Durchführung und Evaluation des Informa-
tikunterrichts kennen.
Kontakt und Information
Institut für Sprachen und Literaturen: www.uibk.ac.at/sprachen-literaturen/grlat Kontakt und Information
Mag. Simon Zuenelli Univ.-Prof. Dr. Aart Middeldorp
Telefon +43 512 507-37603 Telefon +43 512 507-6100
E-Mail simon.zuenelli@uibk.ac.at E-Mail lehre-informatik@uibk.ac.at
21
20 21Lehramtsstudium Lehramtsstudium
Unterrichtsfach Italienisch Unterrichtsfach Katholische Religion
Dauer / ECTS-AP 9 Semester / 270 ECTS-AP Dauer / ECTS-AP 9 Semester / 270 ECTS-AP
(Kombination von zwei Unterrichtsfächern) Akademischer Grad Magistra/Magister der Theologie (Mag. theol.)
Akademischer Grad Magistra/Magister der Philosophie (Mag.phil.) Studienkennzahl C 020
Studienkennzahl C 350 Studienplan Mitteilungsblatt vom 14.06.2002, 48. Stück, Nr. 470 *
Studienplan Mitteilungsblatt vom 13.09.2001, 68. Stück, Nr. 831 * Voraussetzung Matura oder Äquivalent
Voraussetzung Matura oder Äquivalent Zusatzprüfung Die Zusatzprüfung aus Latein ist bis zur vollständigen Ablegung des Bache-
Zusatzprüfung Die Zusatzprüfung aus Latein ist bis zur vollständigen Ablegung der ersten Di- lorstudiums, bei Diplomstudien vor vollständiger Ablegung der ersten Dip-
plomprüfung, nachzuweisen, wenn dieses Fach nicht an einer höheren Schule lomprüfung, nachzuweisen, wenn dieses Fach nicht an einer höheren Schule
im Ausmaß von mindestens 10 Wochenstunden erfolgreich absolviert wurde. im Ausmaß von mindestens 10 Wochenstunden erfolgreich absolviert wurde.
*Alle Studienpläne finden Sie online unter: www.uibk.ac.at/studium/curricula *Alle Studienpläne finden Sie online unter: www.uibk.ac.at/studium/curricula
Kurzbeschreibung
Ziel des Lehramtsstudiums Italienisch ist die wissenschaftliche Berufsvorbereitung für das
Lehramt an Allgemeinbildenden höheren Schulen (AHS) und Berufsbildenden mittleren und
höheren Schulen (BMHS) und außerschulischen Bildungsinstitutionen. Das Studium bietet
eine fachliche, eine fachdidaktische sowie eine allgemein pädagogische Ausbildung, die
zukünftigen Fremdsprachenlehrenden Kompetenz, Flexibilität und Sicherheit für ihren Be-
ruf gewährleistet. Die fachliche Ausbildung umfasst die Bereiche Literatur- und Sprachwis- Kurzbeschreibung
senschaft, Landes- und Kulturkunde sowie Sprachbeherrschung.
An der Theologischen Fakultät gibt es zwei Studienrichtungen, die für das Lehramt
Die Studierenden erhalten Einblicke in die Literatur- und Kulturgeschichte, lernen Tex- ausbilden:
te kritisch zu verstehen und zu analysieren, werden mit Inhalten der Sprachwissenschaft
vertraut gemacht und setzen sich mit sozialen, politischen und historischen Aspekten der » Das Lehramtsstudium Katholische Religion ist ein Kombinationsstudium mit einem
Zielländer auseinander. Lehramtsfach aus dem geisteswissenschaftlichen oder naturwissenschaftlichen Bereich.
Im Rahmen der Wahlfächer können zusätzlich das Schulpraktikum und die Fachdidaktik
Die fachdidaktische Ausbildung will die zukünftigen SprachlehrerInnen in die Lage für Pflichtschulen absolviert werden.
versetzen, sich ein breites Methodenrepertoire aufzubauen, um einen reflektierten,
schülerInnenzentrierten, handlungsorientierten und kommunikativen Fremdsprachenunter- » Das Bachelor-/Masterstudium der Katholischen Religionspädagogik stellt derzeit eine
richt, der sich am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GERS) und am Sonderform des Lehramtsstudiums dar. Die Dauer des Bachelorstudiums beträgt sechs,
neuesten Stand der Spracherwerbs-, Sprachlern- und Sprachbewertungsforschung ausrich- die des Masterstudiums vier Semester. Der Abschluss mit dem akademischen Grad
tet, konstruktiv und kreativ gestalten zu können. Die fachdidaktische Ausbildung ist in Master of Arts qualifiziert für das Lehramt Katholische Religion an allen Schulformen;
das mit dem „Europasiegel für innovative Sprachenprojekte“ ausgezeichnete „Innsbrucker darüber hinaus kann dieses Studium auch auf Erwachsenenbildung, Beratung und
Modell der Fremdsprachendidaktik (IMoF)“ eingebunden, das sprachenübergreifende Module Seelsorge ausgerichtet werden.
anbietet und bereits in der Ausbildung eine gute Kooperation zwischen den Sprachfächern Der Bachelorabschluss qualifiziert zum Religionsunterricht an Pflichtschulen im Rahmen
an den Schulen fördert. eines kirchlichen Berufes; weiters für die religiöse Bildung und den pastoralen Dienst,
soweit kein Masterabschluss erforderlich ist.
Kontakt und Information
Institut für Romanistik: www.uibk.ac.at/romanistik Kontakt und Information
Ass.-Prof. Mag. Dr. Werner Marxgut Ass.-Prof. Mag. Dr. Barbara Hinger o.Univ.-Prof. Dr. Matthias Scharer
Telefon +43 512 507-4207 Telefon +43 512 507-4206 Telefon +43 512 507-8660
E-Mail Werner.Marxgut@uibk.ac.at E-Mail Barbara.Hinger@uibk.ac.at E-Mail Matthias.Scharer@uibk.ac.at
23
22 23Lehramtsstudium Lehramtsstudium
Unterrichtsfach Klassische Philologie - Latein Unterrichtsfach Mathematik
Dauer / ECTS-AP 9 Semester / 270 ECTS-AP Dauer / ECTS-AP 9 Semester / 270 ECTS-AP
(Kombination von zwei Unterrichtsfächern) (Kombination von zwei Unterrichtsfächern)
Akademischer Grad Magistra/Magister der Philosophie (Mag.phil.) Akademischer Grad Magistra/Magister der Naturwissenschaften (Mag.rer.nat.)
Studienkennzahl C 338 Studienkennzahl C 406
Studienplan Mitteilungsblatt vom 13.09.2001, 68. Stück, Nr. 831 * Studienplan Mitteilungsblatt vom 11.09.2001, 67. Stück, Nr. 830*
Voraussetzung Matura oder Äquivalent Mitteilungsblatt vom 23.04.2007, 28. Stück, Nr. 191*
Zusatzprüfung Die Zusatzprüfung aus Latein ist vor Zulassung zum Studium abzulegen, wenn Voraussetzung Matura oder Äquivalent
dieses Fach nicht an einer höheren Schule im Ausmaß von mindestens 10
Wochenstunden erfolgreich absolviert wurde. *Alle Studienpläne finden Sie online unter: www.uibk.ac.at/studium/curricula
Die Zusatzprüfung aus Griechisch ist bis zur vollständigen Ablegung der ersten Kurzbeschreibung
Diplomprüfung abzulegen, wenn dieses Fach nicht nach der 8. Schulstufe an
einer höheren Schule im Ausmaß von mindestens 10 Wochenstunden erfolg-
reich absolviert wurde. Die AbsolventInnen des Lehramtsstudiums im Unterrichtsfach Mathematik sollen in der
Lage sein,
*Alle Studienpläne finden Sie online unter: www.uibk.ac.at/studium/curricula
» jenen Teil der Mathematik, der an allgemeinbildenden und berufsbildenden höheren Schulen
Kurzbeschreibung unterrichtet wird, einfach und verständlich zu erklären und zu motivieren – Grundvoraus-
Wichtigster Inhalt des Lehramtsstudiums Latein ist die lateinische Literatur. Die Begegnung setzung dafür ist, diese Bereiche der Mathematik und ihre wissenschaftlichen Hintergrün-
mit den Texten erfolgt sowohl durch Originallektüre als auch durch Übersetzungen. Im de und Zusammenhänge sehr gut zu kennen und zu beherrschen;
Vordergrund stehen dabei „klassische“ Autoren wie Catull, Vergil, Ovid, Cicero oder » den Computer und mathematische Software im Unterricht einzusetzen;
Seneca, das Angebot an Lektüre- und Interpretationslehrveranstaltungen schließt aber » bei ihren SchülerInnen Interesse für Berufe, die tiefgehende Kenntnisse der Mathematik
auch spätantike, mittelalterliche und neuzeitliche Texte ein. erfordern, zu wecken und Querverbindungen zu anderen Unterrichtsfächern herzustellen;
Weitere wichtige Bereiche des Studiums umfassen die Perfektionierung der Lateinkenntnisse, » den Lehrplan kritisch zu interpretieren und die Qualität von Schulbüchern zu beurteilen;
das Fortleben der Antike in der europäischen Kultur (Rezeptionsgeschichte), moderne Lite- » sich gegebenenfalls neue Lehrplaninhalte selbstständig zu erarbeiten;
raturtheorie und Nachbardisziplinen wie Geschichte, Archäologie und Philosophie. » über die geschichtliche Entwicklung und gesellschaftliche Bedeutung der Mathematik
Neben der allgemein pädagogischen und schulpraktischen Ausbildung werden die Stu- zu informieren.
dierenden in fachdidaktischen Lehrveranstaltungen auf ihre Zukunft als LateinlehrerInnen
vorbereitet. Dabei gewinnen sie z.B. Einblick in die neuesten Lehr- und Lernmethoden oder Im Rahmen der fachlichen Ausbildung sind Lehrveranstaltungen aus Linearer Algebra,
die Grundzüge des Prüfens und Bewertens. Da das Studium in das mit dem „Europasie- Diskreter Mathematik, Analysis, Informatik, Algebra, Geometrie und Stochastik zu absol-
gel für innovative Sprachenprojekte“ ausgezeichnete „Innsbrucker Modell der Fremdspra- vieren. Dabei wird auch die Denk- und Arbeitsweise der Mathematik (z.B. exaktes Argumen-
chendidaktik (IMoF)“ eingebunden ist, haben einige fachdidaktische Lehrveranstaltungen tieren, sachliches und vorurteilsfreies Denken, zielgerichtetes Arbeiten, kreatives Arbeiten)
sprachenübergreifenden Charakter, d.h. sie werden von Studierenden verschiedener Spra- eingeübt. Die Studierenden sollen während des Studiums einen ausreichenden Einblick
chen gemeinsam besucht. in die Aufgaben und Methoden der Mathematik gewinnen und deren Möglichkeiten und
Die Schule ist jedoch nicht die einzige Zukunftsperspektive für Latein-Lehramtskandidat- Grenzen abschätzen können.
Innen: Weil die Beschäftigung mit unseren antiken Wurzeln sehr viel kulturelles Grund-
wissen, einen hohen Grad an Allgemeinbildung und zahlreiche „Soft Skills“ vermittelt, In den Lehrveranstaltungen aus Didaktik der Mathematik lernen die Studierenden grund-
sind sie auch in anderen Berufssparten gerne gesehen. legende Theorien und Modelle für die Planung, Durchführung und Evaluation des Mathe-
matikunterrichts kennen.
Kontakt und Information
Institut für Sprachen und Literaturen: www.uibk.ac.at/sprachen-literaturen/grlat Kontakt und Information
Mag. Simon Zuenelli ao.Univ.-Prof. Dr. Franz Pauer
Telefon +43 512 507-37603 Telefon +43 512 507-6082
E-Mail simon.zuenelli@uibk.ac.at E-Mail Franz.Pauer@uibk.ac.at
25
24 25Lehramtsstudium Lehramtsstudium
Unterrichtsfach Physik Unterrichtsfach Russisch
Dauer / ECTS-AP 9 Semester / 270 ECTS-AP Dauer / ECTS-AP 9 Semester / 270 ECTS-AP
(Kombination von zwei Unterrichtsfächern) (Kombination von zwei Unterrichtsfächern)
Akademischer Grad Magistra/Magister der Naturwissenschaften (Mag.rer.nat.) Akademischer Grad Magistra/Magister der Philosophie (Mag.phil.)
Studienkennzahl C 412 Studienkennzahl C 362
Studienplan Mitteilungsblatt vom 11.09.2001, 67. Stück, Nr. 830* Studienplan Mitteilungsblatt vom 13.09.2001, 68. Stück, Nr. 831 *
Mitteilungsblatt vom 23.04.2007, 28. Stück, Nr. 191* Voraussetzung Matura oder Äquivalent
Voraussetzung Matura oder Äquivalent Zusatzprüfung Die Zusatzprüfung aus Latein ist bis zur vollständigen Ablegung der ersten Di-
plomprüfung, nachzuweisen, wenn dieses Fach nicht an einer höheren Schule
*Alle Studienpläne finden Sie online unter: www.uibk.ac.at/studium/curricula im Ausmaß von mindestens 10 Wochenstunden erfolgreich absolviert wurde.
*Alle Studienpläne finden Sie online unter: www.uibk.ac.at/studium/curricula
Kurzbeschreibung
Kurzbeschreibung
Die AbsolventInnen des Lehramtsstudiums im Unterrichtsfach Physik sollen grundlegende
Kenntnisse erwerben:
„Учимся русскому языку!“ Russisch an Tiroler Schulen ist gefragt! In manchen Schulen
kann mittlerweile sogar die Matura in Russisch abgelegt werden.
» in den physikalischen Teilgebieten Mechanik, Elektrizität und Magnetismus, Optik,
Für das Lehramtsstudium Russisch benötigen die Studierenden keine Vorkenntnisse. Das
Wärme, Atom-, Molekül- und Festkörperphysik, Relativitätstheorie, Astrophysik und
Institut für Slawistik bietet eine profunde Sprachausbildung an, und in den Kompetenz-
Kosmologie – wobei es nicht auf die Zahl der bekannten Fakten, sondern auf den Über-
bereichen Sprachwissenschaft, Literatur- und Kulturwissenschaft werden die Grundlagen
blick, das Verständnis, und die Verbindung zu anderen Wissensgebieten ankommt;
gelegt, die die Studierenden als LehrerInnen für ihre Arbeit mit jedweder Art von Texten
» in jenen fachverwandten Gebieten, in denen physikalische Grundkenntnisse zu einem
benötigen. Lehrveranstaltungen aus diesen Bereichen machen die Studierenden mit dem
vertieften Verständnis führen, also in Meteorologie und Geophysik, in Biologie, in
Sprachsystem und der russischen Literatur und Kultur, einschließlich Film und Medien sowie
Chemie und in der physikalischen Medizin;
mit wissenschaftlichen Arbeitstechniken, Theorien und Methoden der Fächer vertraut. In der
» in der Geschichte der Physik;
Fachdidaktik erwerben die Studierenden das nötige Know-how für die Unterrichtsvor-
» in der technischen Nutzung von physikalischen Erkenntnissen und im Aufzeigen von
bereitung und -durchführung. Einige Lehrveranstaltungen der allgemeinen Didaktik
damit verbundenen Auswirkungen auf die Gesellschaft;
haben sprachenübergreifenden Charakter. Diese werden im Rahmen des „Innsbrucker Mo-
» darin, die „Methode der Physik“ (schülerInnengerecht) herauszuarbeiten: komplexe
dells der Fremdsprachendidaktik (IMoF)“ von MitarbeiterInnen des Arbeitsbereichs für Di-
Situationen mithilfe von einfachen Modellen zu verstehen, ohne dass dabei die wesent-
daktik der Sprachen (AbDiS) geleitet.
lichen Züge des Vorganges verlorengehen;
» darin, die „Methode der Physik“ zur Gewinnung von Erkenntnissen als ganz allgemein
Im Zentrum der Arbeit von RussischlehrerInnen steht neben der Weitergabe von Sprach-
anwendbare, sehr erfolgreiche Methode eines rationalen „Herangehens an die Welt“
wissen und der Entwicklung von sprachlichen Fertigkeiten wie Sprechen, Lesen und
zu präsentieren, um so die SchülerInnen zu ermutigen, sich diese Haltung zu eigen zu
Schreiben auch die Vermittlung von Landes- und Kulturkunde, die die Freude der Schüler-
machen und damit zu kritisch denkenden StaatsbürgerInnen zu werden.
Innen an der Sprache fördert und ihre Neugier auf die Menschen und die Kultur Russlands
weckt.
Im Rahmen der fachlichen Ausbildung sind Lehrveranstaltungen aus Experimental- und
Theoretischer Physik zu absolvieren. Es soll vor allem eingeübt werden, die Physik nicht als
Die fachliche Sicherheit, die die Studierenden bei ihrer Tätigkeit als LehrerInnen brauchen,
große Menge von unzusammenhängenden Einzelfakten zu sehen, sondern die Natur in ihrer
können sie mit einem Auslandsaufenthalt erhöhen.
Vernetzung der besprochenen Inhalte und Konzepte zu begreifen.
Kontakt und Information
Kontakt und Information Institut für Slawistik: www.uibk.ac.at/slawistik
ao.Univ.-Prof. Dr. Walter Saurer ao.Univ-Prof. Mag. Dr. Wolfgang Stadler
Telefon +43 512 507-6038 Telefon +43 512 507-4238
E-Mail Walter.Saurer@uibk.ac.at E-Mail Wolfgang.Stadler@uibk.ac.at
27
26 27Sie können auch lesen