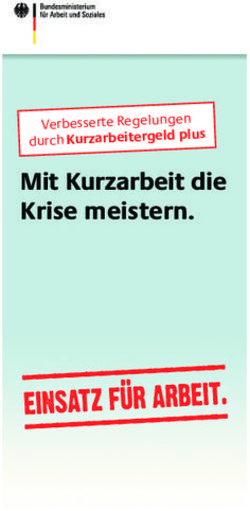Transfer-Kurzarbeitergeld und Beschäftigungsgesellschaft
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
RA’e Hans Stefan Korsch, Fachanwalt f. Arbeitsrecht / Dr. Gunther Mävers (Maître en Droit) 08/2004
Mütze Korsch Rechtsanwaltsgesellschaft mbH - 1 -
Transfer-Kurzarbeitergeld und Beschäftigungsgesellschaft
- Arbeits-, Sozialversicherungs- und Steuerrecht -
Einleitung
Spätestens seit der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts in Sachen Dörries-Scharmann1
sind "BQG" und "Struktur-Kug" geläufige Begriffe der arbeitsrechtlichen Restrukturierungs-
und Transaktionspraxis. Was versteckt sich hinter diesen Begriffen, welche Besonderheiten
gilt es bei "Beschäftigungs- u. Qualifizierungsgesellschaften" (im folgenden: BQG) und
"Struktur-Kurzarbeitergeld" bzw. jetzt „Transfer-Kurzarbeitergeld“ zu beachten. Der folgende
Beitrag zeigt ausgehend von der Darstellung der Grundzüge der Kurzarbeit (I) einige
Möglichkeiten auf, sich diese Institute im Rahmen der arbeitsrechtlichen Beratung unter
Einbeziehung des arbeits-, sozialversicherungs- und steuerrechtlichen Umfeldes zum Vorteil
aller Beteiligten zunutze zu machen. Dargestellt werden darüber hinaus die Regelungen
über das Kurzarbeitergeld (II.) bzw. die Spezialregelungen zum sog. Transfer-
Kurzarbeitergeld (III.), und damit im Zusammenhang die Errichtung und die Funktionsweise
einer BQG im Rahmen einer Restrukturierungsmaßnahme (IV.)
I. Begriff und Einführung von Kurzarbeit
Sinkt die Wirtschaftskraft eines Unternehmens, sind Umsatz bzw. Auftragseingang
rückläufig, werden stets sämtliche Kosten, insbesondere aber die Personalkosten einer
intensiven Prüfung unterzogen. Da eine einseitige Reduzierung der Mitarbeitervergütung
nach deutschem Arbeitsrecht de facto unmöglich ist2, kommt das Unternehmen nicht umher,
den Personalbestand auf den Prüfstand zu stellen. Dies muss nicht automatisch in jedem
Fall mit einer Personalfreisetzung, d.h. dem Ausspruch betriebsbedingter Kündigungen,
verbunden sein. Eine mögliche Alternative hierzu ist die Einführung sog. Kurzarbeit.3
a) Begriff der Kurzarbeit
1
Im vielbeachteten Fall der Umstrukturierung der Unternehmensgruppe Dörries-Scharmann aus
Mönchengladbach hat das Bundesarbeitsgericht das Konstrukt einer Beschäftigungs- und
Qualifizierungsgesellschaft erstmals abgesegnet, vgl. BAG, Urteil v. 10.12.1998 - Az.: 8 AZR
324/97 -, NZA 1999, 422 ff.
2
Das Bundesarbeitsgericht hält eine einseitige Reduzierung der Vergütung zwar nach den
Grundsätzen der Änderungskündigung nicht von vornherein für ausgeschlossen, hat aber
zugleich klargestellt, dass diese an sehr restriktive Voraussetzungen gebunden ist, vgl. BAG,
Urteil v. 20.03.1986 - Az.: 2 AZR 294/85 -, NZA 1986, 824.
3
Es gibt insbesondere keinen Vorrang der Einführung von Kurzarbeit. Das Bundesarbeitsgericht
hat in seiner neueren Rechtsprechung klargestellt, dass eine arbeitsgerichtliche Inhaltskontrolle
dahingehend, ob betriebsbedingte Kündigungen durch die Einführung von Kurzarbeit hätten
vermieden werden können, nicht möglich ist, vgl. BAG, Beschluss vom 04.03.1986 - Az.: 1 ABRRA’e Hans Stefan Korsch, Fachanwalt f. Arbeitsrecht / Dr. Gunther Mävers (Maître en Droit) 08/2004
Mütze Korsch Rechtsanwaltsgesellschaft mbH - 2 -
Kurzarbeit im arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Sinne wird als Verkürzung der
betriebsüblichen oder eines Teils der im Betrieb üblichen normalen Arbeitszeit definiert.4 Die
Reduzierung der Arbeitszeit kann bis zu 100 % betragen; im diesen Falle spricht man von
sog. "Kurzarbeit Null", einer Terminologie, die zwischenzeitlich sogar Eingang in die
5
Leitsätze der BAG-Rechtsprechung gefunden hat. Darüber hinaus unterscheidet man
zwischen der „klassischen“ Gewährung von Kurzarbeitergeld und der Gewährung von sog.
Transferkurzarbeitergeld.
Sinn und Zweck der Einführung von Kurzarbeit ist die (vorübergehende) Reduzierung der
Personalkosten bei gleichzeitigem Erhalt der Arbeitsplätze. Zumindest für kurzfristige
Anpassungsmaßnahmen stellt die Einführung dieser Form der Kurzarbeit somit eine echte
Alternative zum Ausspruch betriebsbedingter Kündigungen dar, um bspw. ein "Auftragsloch"
unbeschadet zu überstehen.
b) Einführung von Kurzarbeit
Der Arbeitgeber ist nicht zur einseitigen Einführung von Kurzarbeit berechtigt. Die
"Anordnung" von Kurzarbeit wäre eine unzulässige einseitige Änderung der
Arbeitsbedingungen; sie käme einer (nach deutschem Arbeitsrecht nur ausnahmsweise
zulässigen6) Teilkündigung gleich. Zur Einführung von Kurzarbeit bedarf es folglich einer
besonderen Grundlage. Dies gilt auch dann, wenn die Voraussetzungen für die Gewährung
7
von Kurzarbeitergeld gem. §§ 169 ff. SGB III vorliegen.
Die Befugnis zur Einführung von Kurzarbeit kann sich aus Tarifverträgen,
8
Betriebsvereinbarungen oder individuellen Vereinbarungen mit den Arbeitnehmern ergeben;
eine formlose Regelungsabrede scheidet hingegen als taugliche Rechtsgrundlage mangels
9
ihres normativen Charakters aus.
Existiert ein Betriebsrat, unterliegt die Einführung von Kurzarbeit als eine Frage der
vorübergehenden Verkürzung der betriebsüblichen Arbeitszeit der Mitbestimmung des
15/84, EzA § 87 BetrVG 1972 Nr. 17, und BAG, Urteil v. 11.09.1986 - Az.: 2 AZR 564/85, EzA §
1 KSchG Betriebsbedingte Kündigung Nr. 17.
4
Vgl. nur Küttner-Kreitner, Personalbuch 2003, Stichwort Kurzarbeit Rn. 1.
5
Vgl. bspw. BAG, Urteil v. 10.08.1994 - Az.: 10 AZR 259/94 -, AP Nr. 14 zu § 615 BGB
Kurzarbeit, wo es im 1. Leitsatz wie folgt lautet: "Wird die betriebliche regelmäßige Arbeitszeit in
einer Weise verkürzt, dass überhaupt keine Arbeit mehr zu leisten ist (Kurzarbeit 'Null'), so führt
dies zum Wegfall der Arbeitsleistung für den Zeitraum, für den die Kurzarbeit angeordnet ist."
6
Vgl. BAG, Urteil v. 07.10.1982 - Az.: 2 AZR 455/80 -, EzA Nr. 28 zu § 315 BGB.
7
Vgl. BAG, Urteil v. 14.02.1991 - Az.: 2 AZR 415/90 -, EzA § 87 BetrVG 1972 Kurzarbeit Nr. 1.
8
Ein Muster für eine Betriebsvereinbarung findet sich bspw. bei
Bauer/Lingemann/Diller/Haußmann, Anwaltsformularbuch Arbeitsrecht, M. 31.5.
9
Nach der Rechtsprechung vermögen derartige Regelungsabreden zwar das
Mitbestimmungserfordernis des § 87 I Nr. 3 BetrVG zu wahren, nicht aber den Inhalt der
Einzelarbeitsverhältnisse zu gestalten, vgl. BAG, Urteil v. 14.02.1991, Az.: 2 AZR 415/90 -, EzA
§ 87 BetrVG 1972 Kurzarbeit Nr. 1.RA’e Hans Stefan Korsch, Fachanwalt f. Arbeitsrecht / Dr. Gunther Mävers (Maître en Droit) 08/2004
Mütze Korsch Rechtsanwaltsgesellschaft mbH - 3 -
Betriebsrats nach § 87 Abs. 1 Nr. 3, 1. Alt. BetrVG.10 Nach ständiger Rechtsprechung des
Bundesarbeitsgerichts steht dem Betriebsrat insoweit sogar ein Initiativrecht zu, d.h. er kann
die Einführung von Kurzarbeit verlangen und ggf. einen Spruch der Einigungsstelle
erzwingen.11 Inhaltlich erstreckt sich das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates auf alle mit
der Kurzarbeit zusammenhängenden Einzelfragen; nach der Aufzählung von Natzel12
umfasst es insbesondere die Frage des Zeitraumes der Einführung von Kurzarbeit, ihrer
Form (Verkürzung der täglichen Arbeitszeit), des Ausfalls von ganzen Arbeitstagen, sog.
Feierschichten etc., die Frage teilweiser Einführung von Kurzarbeit im Betrieb sowie auch
der Abgrenzung des von Kurzarbeit betroffenen Personenkreises. Keine
Mitbestimmungspflicht besteht nach der Rechtsprechung hingegen, wenn die Kurzarbeit
infolge der veränderten Auftragslage früher als vorhergesehen wieder abgesetzt wird und
die Arbeitszeit auf die betriebsübliche Arbeitszeit zurückgeführt wird; durch den Abbau der
Kurzarbeit - so das Bundesarbeitsgericht - wird nicht die "betriebsübliche Arbeitszeit",
13
sondern die vorübergehend festgelegte "Ausnahme-Arbeitszeit" verändert. Kein
Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats soll nach der Kommentarliteratur ferner dann
bestehen, wenn Arbeitnehmer einer betrieblich organisatorischen Einheit Transfer-
14
Kurzarbeitergeld (dazu sogleich) erhalten sollen. Dies beruht auf der Erwägung, dass
zumindest bei einer externen BQG der die Mitbestimmungspflicht auslösende Tatbestand
der "vorübergehenden Verkürzung der Arbeitszeit" nicht gegeben ist und die in der BQG
verweilenden Arbeitnehmer mangels Eingliederung nicht Arbeitnehmer im Sinne des
Betriebsverfassungsgesetzes sind.15 Eine obergerichtliche Entscheidung zu dieser
Problematik liegt indes - soweit ersichtlich - bislang nicht vor.16 In derartigen Konstellationen
dürfte sich ein Mitbestimmungsrecht jedoch regelmäßig aus den §§ 111 ff. BetrVG ergeben,
wenn die in Aussicht genommene Maßnahme eine Betriebsänderung darstellt.
Existiert kein Betriebsrat, ist zu beachten, dass die Einführung von Kurzarbeit vom
Arbeitgeber gegenüber den Arbeitnehmern nicht im Wege des Direktionsrechts einseitig
durchgesetzt werden kann, sondern es zur wirksamen Änderung der Arbeitsverträge einer
17
vertraglichen Vereinbarung oder einer Änderungskündigung bedarf. Zu beachten ist
10
Vgl. BAG, Urteil v. 29.11.1978, DB 1979, 995.
11
Vgl. BAG, Beschluss v. 04.03.1986 - Az.: 1 ABR 15/84 -, EzA § 87 BetrVG 1972 Initiativrecht Nr.
6.; ebenso: ErfK-Hanau/Kania, § 87 BetrVG Rn. 35; Fitting/Kaiser/Heither/Engels, § 87 BetrVG
Rn. 158; a.A.: GK-Wiese, § 87 BetrVG Rn. 367.
12
Vgl. Hümmerich/Spirolke-Natzel, Das Arbeitsrechtliche Mandat, § 5 Rn. 54.
13
Vgl. BAG, Beschluss v. 21.11.1978 - Az.: 1 ABR 67/76 -, EzA § 87 BetrVG 1972 Arbeitszeit Nr.
7; ebenso: Richardi, § 87 BetrVG Rn. 390; a.A.: Fitting/Kaiser/Heither/Engels, § 87 BetrVG Rn.
151; GK-Wiese, § 87 BetrVG Rn. 388.
14
Vgl. Fitting/Kaiser/Heither/Engels, § 87 BetrVG Rn. 152; GK-Wiese, § 87 BetrVG Rn. 395;
Bachner/Schindele, NZA 1999, 130 ff., 133 f. a.A. Däubler/Kittner/Klebe, § 87 BetrVG Rn. 88.
15
Vgl. Bachner/Schindele, NZA 1999, 130 ff., 134.
16
Ob auch für die Anordnung von Kurzarbeit oder Überstunden als Auswirkung von Streiks und
Aussperrungen ein Mitbestimmungsrecht besteht - darauf soll hier nur hingewiesen werden - ist
schließlich ausgesprochen umstritten, vgl. zur Problematik umfassend
Fitting/Kaiser/Heither/Engels, § 87 BetrVG Rn. 164 ff.
17
Vgl. BAG, Urteil v. 14.02.1991, Az.: 2 AZR 415/90 -, EzA § 87 BetrVG 1972 Kurzarbeit Nr. 1.RA’e Hans Stefan Korsch, Fachanwalt f. Arbeitsrecht / Dr. Gunther Mävers (Maître en Droit) 08/2004
Mütze Korsch Rechtsanwaltsgesellschaft mbH - 4 -
schließlich der Sondertatbestand des § 19 KSchG betreffend die Zulässigkeit der Einführung
von Kurzarbeit im Falle von Massenentlassungen im Sinne von § 17 KSchG.18
c) Rechtsfolgen der Einführung
Die Einführung von Kurzarbeit führt zu einer teilweisen Suspendierung der
Hauptleistungspflichten des - im übrigen unverändert fortbestehenden - Arbeitsverhältnisses,
d.h. der von der Einführung der Kurzarbeit betroffene Arbeitnehmer wird von der
Verpflichtung zur Arbeitsleistung befreit, verliert aber in entsprechender Höhe seinen
Vergütungsanspruch gegen den Arbeitgeber. Hiervon nicht berührt sind etwaige Ansprüche
des Arbeitnehmers auf Kurzarbeitergeld sowie teils tarifvertraglich geregelte Ansprüche auf
Zuzahlungen durch den Arbeitgeber.
II. Kurzarbeitergeld
Die Einführung von Kurzarbeit ist gerade auch deshalb ein beliebtes Mittel zur
Kostenreduzierung, weil sie in ganz erheblichem Umfang von Seiten der Agentur für Arbeit
gefördert wird.
a) Sinn u. Zweck der Regelungen
Die Vorschriften über die Gewährung von Kurzarbeitergeld finden sich in §§ 169 ff. SGB III.
Mit dieser - erstmals im Jahre 1956 seinerzeit im AVAVG 1956 (§§ 116 ff.)19 und sodann im
20
Arbeitsförderungsgesetz (§§ 63 ff.) gesetzlich niedergelegten - Regelung verfolgte der
Gesetzgeber ursprünglich ausschließlich das sozialpolitische Ziel, den Erhalt von
Arbeitsplätzen während Zeiten konjunkturell bedingter Beschäftigungsschwankungen zu
21
gewährleisten. Diese ausdrückliche Zweckbestimmung hat der Gesetzgeber im Laufe der
Jahre zugunsten einer sehr offenen Förderungspraxis aufgegeben; das SGB III verzichtet
auf jegliche Funktionsdefinition und -beschränkung, vor allem auf die des Erhalts von
Arbeitsplätzen.22 Dieser Funktionswandel zeigt sich insbesondere auch an dem (sogleich
unter III. 1. im Einzelnen darzustellenden) Institut des Transfer-Kurzarbeitergeldes. Die
Regelungen über das (damals noch) Strukturkurzarbeitergeld wurden erstmals im Jahre
18
Ist der Arbeitgeber im Falle von anzeigepflichtigen Entlassungen nicht in der Lage, die
Arbeitnehmer bis zum Ablauf der Sperrfrist des § 18 KSchG voll zu beschäftigen, kann gem. §
19 KSchG Kurzarbeit durch die Bundesagentur für Arbeit zugelassen werden; entsprechende
tarifvertragliche Regelungen bleiben hiervon jedoch unberührt.
19
Gesetz für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung, BGBl. 1956 I, S. 1018 ff.
20
Arbeitsförderungsgesetz v. 25.06.1969, BGBl. 1969 I, S. 582 ff.
21
Vgl. BT-Drucks. 2/1274, S. 94, BT-Drucks. 4/2291, S. 55 u. S. 70.
22
Vgl. zu diesem Funktionswandel ausführlich Gagel-Bieback, SGB III Arbeitsförderung, vor § 169
Rn. 33 m. w. Nachw.RA’e Hans Stefan Korsch, Fachanwalt f. Arbeitsrecht / Dr. Gunther Mävers (Maître en Droit) 08/2004
Mütze Korsch Rechtsanwaltsgesellschaft mbH - 5 -
1987 in § 63 Abs. 4 AFG eingefügt23, dessen auf die Stahlindustrie beschränkte Geltung
dann im Jahre 1990 fiel24.
b) Voraussetzungen der Gewährung von Kurzarbeitergeld
Die Voraussetzungen für die Gewährung von Kurzarbeitergeld sind in den §§ 169 - 173 SGB
III geregelt. Gem. der Grundnorm des § 169 SGB III haben Arbeitnehmer Anspruch auf
Kurzarbeitergeld, wenn
1. ein erheblicher Arbeitsausfall mit Entgeltausfall vorliegt, [§ 169 Nr. 1 SGB III]
2. die betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind, [§ 169 Nr. 2 SGB III]
3. die persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind und [§ 169 Nr. 3 SGB III]
4. der Arbeitsausfall der Agentur für Arbeit angezeigt worden ist. [§ 169 Nr. 4 SGB III]
Diese Voraussetzungen werden in den nachfolgenden Regelungen der §§ 170 - 173 SGB III
näher aufgeschlüsselt:
- Erheblichkeit des Arbeitsausfalls (§ 170 SGB III)
Ein Arbeitsausfall ist nach der Legaldefinition des § 170 Abs. 1 SGB III unter den
nachfolgenden vier Voraussetzungen erheblich.
Zunächst muss er auf wirtschaftlichen Gründen oder einem unabwendbaren Ereignis
beruhen (§ 170 Abs. 1 Nr. 1 SGB III). Als wirtschaftliche Gründe kommen u.a.
Lieferengpässe, Auftragsrückgang, Absatzmangel, konjunkturelle Schwankungen etc. in
Betracht. § 170 Abs. 2 SGB III bestimmt ferner, dass ein Arbeitsausfall auch dann auf
wirtschaftlichen Gründen beruht, wenn er durch eine Veränderung der betrieblichen
Strukturen verursacht wird, die durch die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung verursacht
sind. Unabwendbar ist nach der Rechtsprechung jedes objektiv feststellbare Ereignis, das
auch durch die äußerste, nach den Umständen des Falles gebotene Sorgfalt nicht
abzuwenden war.25 Ein unabwendbares Ereignis liegt gem. § 170 Abs. 3 SGB III
insbesondere vor, wenn ein Arbeitsausfall auf ungewöhnlichen, dem üblichen
Witterungsverlauf nicht entsprechenden Witterungsgründen beruht oder durch behördliche
oder behördlich anerkannte Maßnahmen verursacht ist, die vom Arbeitgeber nicht zu
vertreten sind.
Ferner darf es sich nur um einen vorübergehenden Arbeitsausfall handeln (§ 170 Abs. 1 Nr.
2 SGB III). Dies ist nach der Rechtsprechung dann der Fall, wenn mit einer gewissen
Wahrscheinlichkeit vorhersehbar ist, dass in absehbarer Zeit, die die Bezugsfristen
23
Die Regelung war in § 63 Abs. 4 AFG enthalten und wurde durch das 8. AFG-ÄndG v.
14.12.1987 (BGBl. 1987 I, S. 2602) eingefügt.
24
Beschäftigungsförderungsgesetz, BGBl. 1990 I, S. 2406.
25
Vgl. BSG, Urteil v. 29.10.1997 - Az.: 7 RAr 48/96 -, SozR 3-4100 § 64 Nr. 3 = NZS 1998, 393 ff.RA’e Hans Stefan Korsch, Fachanwalt f. Arbeitsrecht / Dr. Gunther Mävers (Maître en Droit) 08/2004
Mütze Korsch Rechtsanwaltsgesellschaft mbH - 6 -
jedenfalls nicht deutlich überschreiten darf, mit dem Übergang zur Vollarbeit zu rechnen ist.26
Im Falle einer endgültigen Betriebstilllegung liegen die Voraussetzungen für die Gewährung
von Kurzarbeitergeld somit nicht vor, selbst wenn die Erhaltung der Arbeitsplätze in einem
anderen Betrieb desselben Unternehmens in Aussicht gestellt wird.27
Erforderlich ist des weiteren, dass der Arbeitsausfall nicht vermeidbar ist (§ 170 Abs. 1 Nr. 3
SGB III). Dem liegt die Erwägung zugrunde, dass grundsätzlich der Arbeitgeber das
Wirtschafts- und Betriebsrisiko tragen soll und - ggf. sogar wettbewerbsverzerrende -
28
Subventionen vermieden werden sollen. Unvermeidbar ist ein Arbeitsausfall gem. § 170
Abs. 4 S. 1 SGB III, wenn in einem Betrieb alle zumutbaren Vorkehrungen getroffen wurden,
um den Eintritt des Arbeitsausfalls zu verhindern. Als vermeidbar gilt ein Arbeitsausfall gem.
§ 170 Abs. 4 S. 2 SGB III insbesondere bei saisonal bedingten, betriebs- oder
branchenüblichen Arbeitsausfällen (Nr. 1), bei Arbeitsausfällen, die durch die vorrangige
Gewährung von bezahltem Erholungsurlaub verhindert werden können (Nr. 2) sowie bei
Arbeitsausfällen, die durch die Nutzung von im Betrieb zulässigen Arbeitszeitschwankungen
ganz oder teilweise vermieden werden können (Nr. 3). Nähere Einzelheiten zur Frage der
Auflösung von Arbeitszeitguthaben und des Ausschöpfens von betrieblichen
Flexibilisierungsrahmen sind in § 170 Abs. 4 S. 3 und 4 SGB III geregelt. Liegen die
vorbezeichneten Regelbeispiele nicht vor, so gilt für die Frage der Vermeidbarkeit nach der
Rechtsprechung folgendes: Arbeitgeber, Betriebsrat und Arbeitnehmer müssen nicht nur
Anstrengungen zur Einschränkung des Arbeitsausfalls unternehmen, den Arbeitsausfall so
kurz wie möglich zu halten, sondern sich ernsthaft bemühen, den Arbeitsausfall als solchen
zu verhindern.29 Gefordert ist, was nach dem objektivierten Maßstab eines verständigen
Dritten von einem sorgfältigen Unternehmer an Vorsorgemaßnahmen und ständigen
Anpassungsmaßnahmen erwartet werden kann.30 Die aus dem Kündigungsschutzrecht
bekannten engen Grenzen der Überprüfbarkeit von unternehmerischen
31
Organisationsentscheidungen im Rahmen der richterlichen Inhaltskontrolle finden insoweit
keine Anwendung; nach richtiger Auffassung hat die Bundesagentur das Recht und die
Pflicht zur umfassenden Prüfung.32
Schließlich ist ein Arbeitsausfall nur dann erheblich, wenn im jeweiligen Kalendermonat
(Anspruchszeitraum) mindestens ein Drittel der in dem Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer
von einem Entgeltausfall von jeweils mehr als zehn Prozent ihres monatlichen
Bruttoentgeltes betroffen ist (§ 170 Abs. 1 Nr. 4 SGB III, sog. Relevanzschwelle).
Ausweislich der Gesetzgebungsmaterialien fällt die Aufgabe zum Ausgleich eines
schwankenden Arbeitsausfalls unterhalb dieser Bagatellgrenze in den alleinigen
26
Vgl. BSG, Urteil v. 17.05.1983 - Az.: 7 RAr 13/82 -, SozR 4100 § 63 Nr. 2.
27
Vgl. BSG, Urteil v. 25.04.1991 - Az.: 11 RAr 21/89 -, NZA 1991, 952 ff.
28
Vgl. Gagel-Bieback, SGB III Arbeitsförderung, § 170 Rn. 104.
29
Vgl. BSG, Urteil v. 29.10.1997 - Az.: 7 RAr 48/96 -, SozR 3-4100 § 64 Nr. 3 = NZS 1998, 393 ff.
30
Vgl. BSG, Urteil v. 29.04.1998 - Az.: B 7 AL 102/97 -, SozR 3-4100 § 64 Nr. 4.
31
Ständige BAG-Rechtsprechung, vgl. bspw. BAG, Urteil v. 24.04.1997, - Az.: 2 AZR 352/96 -,
EzA § 1 KSchG Betriebsbedingte Kündigung Nr. 95.
32
Vgl. Gagel-Bieback, SGB III Arbeitsförderung, § 170 Rn. 110.RA’e Hans Stefan Korsch, Fachanwalt f. Arbeitsrecht / Dr. Gunther Mävers (Maître en Droit) 08/2004
Mütze Korsch Rechtsanwaltsgesellschaft mbH - 7 -
Verantwortungsbereich des Unternehmers, der diesen durch innerbetriebliche Maßnahmen
auszugleichen hat.33
- Betriebliche Voraussetzungen (§ 171 SGB III)
Die betrieblichen Voraussetzungen für die Gewährung von Kurzarbeitergeld sind gem. § 171
S. 1 SGB III erfüllt, wenn in dem betroffenen Betrieb mindestens ein Arbeitnehmer
beschäftigt ist. Nach dem Grundgedanken der Regelung soll die Möglichkeit zur
Inanspruchname von Kurzarbeitergeld somit in jedem Kleinstbetrieb möglich sein.
Maßgeblich ist der allgemeine arbeitsrechtliche Betriebsbegriff34: die organisatorische
Einheit, innerhalb derer der Unternehmer mit seinen Mitarbeitern mit Hilfe sachlicher und
sonstiger Mittel einen bestimmten arbeitstechnischen Zweck fortgesetzt verfolgt.35
Ausreichend ist gem. § 171 S. 2 SGB III jedoch auch, wenn die vorstehende Voraussetzung
in einer Betriebsabteilung vorliegt. Dem liegt die (richtige) Erwägung zugrunde, dass in
einzelnen Betriebsabteilungen eines Betriebs durchaus andere arbeitsmarktpolitische
Verhältnisse herrschen können als im gesamten Betrieb. Voraussetzung ist nach der
Rechtsprechung allerdings eine gewisse, vor allem personalpolitische Selbständigkeit36;
ferner muss die Betriebsabteilung gesondert bestimmten allgemeinen wirtschaftlichen
Risiken und nachfolgenden Arbeitsausfällen ausgesetzt sein, die nicht den ganzen anderen
Betrieb treffen.37
- Persönliche Voraussetzungen (§ 172 SGB III)
Zu den persönlichen Voraussetzungen gehört gem. § 172 Abs. 1 SGB III, dass der
Arbeitnehmer nach Beginn des Arbeitsausfalls eine versicherungspflichtige Beschäftigung
beim Arbeitgeber ausübt, das Arbeitsverhältnis insbesondere nicht gekündigt oder durch
Aufhebungsvertrag aufgelöst ist. Schließlich darf der Arbeitnehmer auch nicht vom
Kurzarbeitergeldbezug ausgeschlossen sein, zum Beispiel wegen Krankheit, Teilnahme an
einer beruflichen Weiterbildungsmöglichkeit u.a., vgl. hierzu im einzelnen § 172 Abs. 2 und 3
SGB III. Seit dem JobAQTIV-Gesetz38 bestimmt § 172 Abs. 1 a SGB III, dass die
persönlichen Voraussetzungen auch erfüllt sind, wenn der Arbeitnehmer während des
Bezuges von Kurzarbeitergeld arbeitsunfähig wird, solange Anspruch auf Fortzahlung des
Arbeitsentgelts im Krankheitsfalle besteht oder ohne den Arbeitsausfall bestehen würde.
33
Vgl. BT-Drucks. V/2291, S. 71; dies entspricht auch der herrschenden Meinung im Schrifttum,
vgl. Gagel-Bieback, SGB III Arbeitsförderung, § 173 Rn. 168 m.w.Nachw.
34
Vgl. BSG, Urteil v. 30.05.1978 - Az.: 7 / 12 RAr 100/76 -, SozR 4100 § 63 Nr. 1; BSG, Urteil v.
25.04.1991 - Az.: 11 RAr 21/89 -, SozR 3-4100 § 63 Nr. 2.
35
Ständige BAG-Rechtsprechung, vgl. bspw. BAG, Beschluss v. 31.05.2000 - 7 ABR 78/98 -, NZA
2000, 1350 ff.
36
Dies setzt ein Mindestmaß an eigenen Betriebsmitteln, eigenem Arbeitszweck und eigener
organisatorischer Leitung sowie regelmäßig, aber nicht notwendig eine gewisse Größe voraus,
vgl. BSG, Urteil v. 29.04.1998 - Az.: B 7 AL 102/97 -, SozR 3-4100 § 64 Nr. 4.
37
Vgl. Gagel-Bieback, SGB III Arbeitsförderung, § 171 Rn. 21.
38
Job-AQTIV-Gesetz v. 10.12.2001, BGBl. 2001 I, S. 3443 ff.RA’e Hans Stefan Korsch, Fachanwalt f. Arbeitsrecht / Dr. Gunther Mävers (Maître en Droit) 08/2004
Mütze Korsch Rechtsanwaltsgesellschaft mbH - 8 -
Diese Änderung dient ausweislich der Gesetzesbegründung der Klarstellung und der
Absicherung der bisherigen Praxis.39
- Anzeige des Arbeitsausfalls bei der Agentur für Arbeit (§ 173 SGB III)
Der Arbeitsausfall ist bei der Agentur für Arbeit, in deren Bezirk der Betrieb liegt, schriftlich
anzuzeigen, § 173 Abs. 1 SGB III. Die Anzeige kann nur vom Arbeitgeber oder der
Betriebsvertretung erstattet werden; eine etwaige Stellungnahme des Betriebsrats ist
beizufügen. Wichtig ist ferner, dass bereits mit der Anzeige das Vorliegen eines erheblichen
Arbeitsausfalls und die betrieblichen Voraussetzungen für die Gewährung von
Kurzarbeitergeld umfassend darzustellen und glaubhaft zu machen sind. Dies sollte
zweckmäßigerweise durch entsprechende schriftliche Erklärung der Geschäftsführung
und/oder des Personalverantwortlichen geschehen. Das Einverständnis des Betriebsrats mit
der vorgesehenen Maßnahme ist zusammen mit der Anzeige vorzulegen. In der Praxis
empfiehlt es sich zudem, so früh wie möglich mit dem zuständigen Ansprechpartner der
Agentur für Arbeit rechtzeitig vorab Kontakt aufzunehmen und diesen stets über den Stand
des Verfahrens unterrichtet zu halten. Regelmäßig wird durch die zuständigen Arbeitsämter
ein persönliches Gespräch im Beisein aller Betriebspartner durchgeführt.
Wichtig: Die ordnungsgemäße Anzeige bei der (zuständigen!) Agentur für Arbeit ist
materielle Anspruchsvoraussetzung; eine Heilung oder Wiedereinsetzung im Falle der
Anzeige bei der unzuständigen Agentur für Arbeit kommt nach der Rechtsprechung nicht in
Betracht.40 Die Zuständigkeit richtet sich nach der für den Betrieb zuständigen
Lohnabrechnungsstelle, §§ 323 Abs. 2, 327 Abs. 3 SGB III.
c) Bezugsdauer
Die Regelung über die Bezugsdauer findet sich in § 177 SGB III. Sie soll ausweislich der
Gesetzesbegründung deutlich machen, dass Kurzarbeitergeld nur eine Leistung zur
Überbrückung vorübergehender Beschäftigungseinbrüche ist.41 Kurzarbeitergeld wird gem. §
177 Abs. 1 SGB III für den Arbeitsausfall während der Bezugsfrist geleistet. Sie beginnt mit
dem ersten Kalendermonat, für den Kurzarbeitergeld gezahlt wird (also ab dem ersten Tag
42
dieses Monats) , und beträgt im Regelfall längstens 6 Monate. Die im Falle der Gewährung
von Kurzarbeitergeld in einer betriebsorganisatorisch eigenständigen Einheit bestehende
Verlängerungsmöglichkeit wird wegen des sachlichen Zusammenhangs nachfolgend im
Rahmen der Ausführungen zum Transfer-Kurzarbeitergeld unter III. dargestellt.
39
Vgl. BT-Drucks. 14/6944, S. 37.
40
Vgl. BSG, Urteil v. 14.02.1989 - Az.: 7 RAr 18/87 -, NZA 1989, 613 ff.
41
BT-Drucks. 13/4941, S. 186 f.
42
Diese - hierauf weist Bieback völlig zu Recht hin - sprachlich etwas unglückliche Formulierung
kann zu einer erheblichen Verkürzung des Regelbezugszeitraums bei Beantragung erst gegen
Monatsende führen, vgl. zur optimalen Gestaltung des Bezugszeitraumes ausführlich Gagel-
Bieback, SGB III Arbeitsförderung, § 177 Rn. 16.RA’e Hans Stefan Korsch, Fachanwalt f. Arbeitsrecht / Dr. Gunther Mävers (Maître en Droit) 08/2004
Mütze Korsch Rechtsanwaltsgesellschaft mbH - 9 -
Kurzarbeitergeld kann auch wegen eines vergleichbaren Sachverhaltes mehrfach beantragt
werden. Eine mögliche neue Bezugsfrist beginnt drei Monate nach dem letzten
Kalendermonat, für den Kurzarbeitergeld geleistet worden ist (sog. Karenzzeit, § 177 SGB
III). Die Regelung verhindert, dass Kurzarbeitergeld zu einer Dauerleistung wird; eine
Wiedergewährung ist nur möglich, wenn der Betrieb gezeigt hat, dass er zumindest für einen
Zeitraum von drei Monaten ohne Bezug von Kurzarbeitergeld wirtschaftlich existenzfähig
ist.43
Die früher bestehende Befristung, wonach in einem Zeitraum von drei Jahren insgesamt
zwei Jahre nicht überschritten werden durften, wurde aufgehoben.
d) Höhe des Kurzarbeitergeldes
Die Höhe des zu zahlenden Kurzarbeitergeldes ist vom Arbeitgeber zu ermitteln. Für den
damit befassten Anwalt, sei er auf Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberseite tätig, gilt der alte
lateinische Wahlspruch iudex non calculat in diesem Falle nicht. Die Berechnung der
zutreffenden Höhe des Kurzarbeitergeldes bedeutet, dass die gesetzlichen Anforderungen
sorgfältig beachtet werden müssen.
Das Kurzarbeitergeld beträgt - so lautet die auf den ersten Blick einfach anmutende
Definition des Gesetzes -
(1) für Arbeitnehmer, die beim Arbeitslosengeld die Voraussetzungen für den
erhöhten Leistungssatz erfüllen würden, 67 Prozent,
(2) für die übrigen Arbeitnehmer 60 Prozent
der Nettoentgeltdifferenz im Anspruchszeitraum (§ 178 SGB III).
Für den Unkundigen lässt die Gesetzesdefinition mehr Fragen offen als sie beantwortet. Die
Legaldefinition für den erhöhten Leistungssatz findet sich in § 129 SGB III unter der Ziffer 1:
Anspruch auf den erhöhten Leitungssatz haben Arbeitslose, die mindestens 1 Kind (im
Sinne des § 32 Abs. 1, 3 - 5 EStG) haben, sowie für Arbeitslose, deren Ehegatte oder
Lebenspartner mindestens 1 Kind hat, wenn beide Ehegatten oder Lebenspartner
unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind und nicht dauernd getrennt leben. Alle übrigen
Arbeitslosen erhalten den allgemeinen Leistungssatz in Höhe von 60 %. Die Prozentsätze
nehmen Bezug auf die "Nettoentgeltdifferenz im Anspruchszeitraum". Die
Nettoentgeltdifferenz wird in § 179 SGB III definiert und entspricht dem Unterschiedsbetrag
zwischen
(1) dem pauschalierten Nettoentgelt aus dem Sollentgelt und
(2) dem pauschalierten Nettoentgelt aus dem Istentgelt.
43
Vgl. Gagel-Bieback, SGB III Arbeitsförderung, § 177 Rn. 4.RA’e Hans Stefan Korsch, Fachanwalt f. Arbeitsrecht / Dr. Gunther Mävers (Maître en Droit) 08/2004
Mütze Korsch Rechtsanwaltsgesellschaft mbH - 10 -
Sollentgelt und Istentgelt werden im folgenden in § 179 SGB III definiert, ohne dass damit
dem Betroffenen allerdings eine einfach zu handhabende Regelung an die Hand gegeben
worden wäre. Tatsache ist, dass diese wenig benutzerfreundliche Regelung schon manchen
Verantwortlichen für die Personalabteilung an den Rand der Verzweiflung gebracht hat. Vor
diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass man auch von den Agenturen für Arbeit teils
unterschiedliche Auskünfte erhält; es lohnt sich daher ggf. eine Second Opinion einzuholen.
Sollentgelt ist das Bruttoarbeitsentgelt, das der Arbeitnehmer ohne den Arbeitsausfall und
vermindert um Entgelt für Mehrarbeit in dem Anspruchszeitraum erzielt hätte; Istentgelt ist
das in dem Anspruchszeitraum tatsächlich erzielte Bruttoarbeitsentgelt des Arbeitnehmers
zuzüglich aller ihm zustehenden Entgeltanteile, vgl. § 179 Abs. 1 Satz 1 und 2 SGB III.
Bei der Berechnung zu beachten ist, dass Entgelte für Mehrarbeit bei der Ermittlung des
Sollentgeltes keine Berücksichtigung finden. Urlaubs- und Feiertagslohn werden bei der
Ermittlung des Istentgeltes, nicht aber des Sollentgeltes in Ansatz gebracht, da diese
44
Beträge kein Entgelt darstellen, das der Arbeitnehmer ohne den Arbeitsausfall erzielt hätte.
45
Für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes müssen diese Beträge neutralisiert werden.
Letztlich ist bei der Berechnung des Kurzarbeitergeldes auch der umfangreiche Runderlass
Kurzarbeitergeld der Bundesagentur für Arbeit zu berücksichtigen.
Kurzum: die Berechnung der Anspruchshöhe ist wegen zahlreicher ineinander verschränkter
Regelungen und des hohen Abstraktionsgrades der gesetzlichen Definitionen im Ergebnis
kompliziert. Die Bundesagentur für Arbeit hat das Problem im Grundsatz erkannt: sie bietet
auf ihren Internetseiten (www.arbeitsagentur.de) zahlreiche hilfreiche Unterlagen und
Berechnungsbeispiele nebst einer Excel-Tabelle zur genauen Ermittlung des
Leistungsanspruchs zum Download an, auf die verwiesen wird.
e) Verfahren
Neben der bereits oben erwähnten Anzeige des Arbeitsausfalls durch den Arbeitgeber bei
der zuständigen Agentur für Arbeit ist zum Verfahren - ohne Anspruch auf Vollständigkeit -
folgendes zu beachten:
Von der Anzeige im Sinne der §§ 169 Nr. 4, 173 SGB III zu unterscheiden ist der Antrag auf
Kurzarbeitergeld nach § 323 Abs. 2 Satz 1 und 2 SGB III. Der Antrag wird vom Arbeitgeber
oder von der Betriebsvertretung gestellt. Wenngleich Anzeige und Antrag in der Praxis
regelmäßig zusammengestellt werden, handelt es sich um zwei unterschiedliche
Verfahrensschritte mit der Folge, dass zwei formal getrennte Bescheide ergehen. Zur
44
Der Arbeitgeber ist insoweit allerdings nur zur Zahlung einer Feiertagsvergütung in Höhe des
Kurzarbeitergeldes verpflichtet, das der Arbeitnehmer ohne den Feiertag bezogen hätte, vgl.
Urteil des BAG vom 05.07.1979 - Az.: 3 AZR 173/78 -, EzA FeiertagslohnzahlungsG Nr. 19.
45
Vgl. Gagel-Bieback, SGB III Arbeitsförderung, § 179 Rn. 21 f. / 43.RA’e Hans Stefan Korsch, Fachanwalt f. Arbeitsrecht / Dr. Gunther Mävers (Maître en Droit) 08/2004
Mütze Korsch Rechtsanwaltsgesellschaft mbH - 11 -
Vermeidung von Unklarheiten empfiehlt sich die Verwendung der amtlichen Vordrucke, die
auf den Internetseiten der Bundesagentur für Arbeit (www.arbeitsagentur.de) zum Download
bereit stehen. Die Ausschlussfrist für den Antrag beträgt gem. § 325 Abs. 3 SGB III drei
Monate ab Ablauf des Anspruchzeitraumes.46
Der Arbeitgeber ist gem. § 320 Abs. 1 Satz 1 SGB III auf Verlangen verpflichtet, der Agentur
für Arbeit die Voraussetzungen für die Erbringung von Kurzarbeitergeld nachzuweisen.
Diese Verpflichtung des Arbeitgebers erstreckt sich auf die kostenlose Errechnung (!) und
47
Auszahlung des Kurzarbeitergeldes. Dabei hat er von den Eintragungen auf der
Lohnsteuerkarte in dem maßgeblichen Antragszeitraum auszugehen, es sei denn aus einer
ihm vorgelegten Bescheinigung der für den Arbeitnehmer zuständigen Agentur für Arbeit
ergibt sich anderes. Gem. § 320 Abs. 4 SGB III hat der Arbeitgeber der Agentur für Arbeit
ferner monatlich während der Dauer des Leistungsbezuges Auskünfte über Betriebsart,
Beschäftigtenzahl, Zahl der Kurzarbeiter, Ausfall der Arbeitszeit und bisherige Dauer,
Unterbrechung oder Beendigung der Kurzarbeit zu erteilen. Verstößt er gegen die
vorbezeichneten Verpflichtungen, so läuft der Arbeitgeber Gefahr, sich einer etwaigen
48
Schadensersatzpflicht nach Maßgabe des § 181 Abs. 3 SGB III ausgesetzt zu sehen.
Das Kurzarbeitergeld wird nachträglich für den Bewilligungszeitraum ausgezahlt,
Einzelheiten regelt die Vorschrift des § 337 SGB III. Kommt die zuständige Agentur für
Arbeit nach einer vorläufigen Prüfung der Sach- und Rechtslage zu dem Ergebnis, dass die
Voraussetzungen für die Gewährung von Kurzarbeitergeld erfüllt sind, bewilligt sie in aller
Regel die Auszahlung eines Vorschusses. Sofern dies nicht passiert, ist der Arbeitgeber
weder arbeits- noch sozialrechtlich verpflichtet, gegenüber den von der Kurzarbeit
betroffenen Arbeitnehmern in Vorleistung zu gehen49, wenngleich dies in der Praxis in aller
Regel der Fall ist. Mangels cessio legis sollte sich der Arbeitgeber insoweit unbedingt eine
Abtretungserklärung der Ansprüche des Arbeitnehmers gegen die Bundesanstalt
50
unterzeichnen lassen, was nach richtiger Ansicht zulässig ist.
Widerruft die Agentur für Arbeit die Gewährung von Kurzarbeitergeld, so hat dies für den
Arbeitgeber die missliche Folge, dass er den hiervon betroffenen Arbeitnehmern nach der
Rechtsprechung zur Zahlung von Verdienstausfall verpflichtet ist. Allerdings besteht dieser
Anspruch nach der Rechtsprechung nur in Höhe des sonst bezogenen Kurzarbeitergeldes,
da der Arbeitnehmer nicht besser gestellt werden soll als er ohne den Widerrufsbescheid
51
gestanden hätte.
46
Vgl. zu näheren Einzelheiten Gagel-Hünecke, SGB III Arbeitsförderung, § 325 Rn. 14 ff.
47
Vgl. Küttner-Voelzke, Personalbuch 2004, Stichwort Kurzarbeit Rn. 52.
48
Insoweit handelt sich um eine abschließende Regelung, vgl. BSG, Urteil v. 25.06.1998 - Az.: B 7
AL 126/95 R -, SozR 3-4100 § 71 Nr.2.
49
Vgl. Gagel-Hünecke, SGB III Arbeitsförderung, § 320 Rn. 16.
50
Vgl. Gagel-Hünecke, SGB III Arbeitsförderung, § 320 Rn. 16.; a.A.: GK-Schmidt, § 72 Rn. 63.
Die Rechtsprechung hat die Problematik zwar angeschnitten, aber - soweit ersichtlich - nicht
abschließend entschieden, vgl. BSG, Urteil v. 11.06.1987 - Az.: 7 RAr 103/85 -, SozR 1300 § 50
Nr. 17.
51
Vgl. BAG, Urteil v. 11.11.1990 - Az.: 5 AZR 557/89 -, EzA § 615 BGB Betriebsrisiko Nr. 11.RA’e Hans Stefan Korsch, Fachanwalt f. Arbeitsrecht / Dr. Gunther Mävers (Maître en Droit) 08/2004
Mütze Korsch Rechtsanwaltsgesellschaft mbH - 12 -
III. Transfer-Kurzarbeitergeld und BQG
Die vorbeschriebenen Formen der Anwendung des Kurzarbeitergeldes betreffen den
Regelfall der Fortführung des Arbeitsverhältnisses zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber
im Anschluss an den Bezug zu Kurzarbeitergeld. Gerade in den vergangenen Jahren stellte
sich die wirtschaftliche Lage der deutschen Betriebe so dar, dass massive Veränderungen
des strukturellen Umfeldes nicht mehr mit Hilfe klassischer Kurzarbeit, sondern durch
Beendigung zahlreicher Anstellungsverträge gelöst werden mussten. Zur Vermeidung
betriebsbedingter Kündigungen wurde und wird immer häufiger das Instrumentarium sog.
Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaften (auch genannt: BQG) genutzt. Für sie
findet die Sonderform des Transferkurzarbeitergeldes Anwendung.
1. Transferkurzarbeitergeld
Seit Inkrafttreten des Dritten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt52 ist
es im 10. Abschnitt über die Transferleistungen in § 216 b SGB III geregelt.
Zur Vermeidung von Entlassungen und zur Verbesserung ihrer Vermittlungsaussichten
haben Arbeitnehmer Anspruch auf Transfer-Kurzarbeitergeld, wenn
1. und solange sie von einem dauerhaften unvermeidbaren Arbeitsausfall mit Entgeltausfall
betroffen sind
2. die betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind,
3. die persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind und
4. der dauerhafte Arbeitsausfall der Agentur für Arbeit angezeigt worden ist.
a) Dauerhafter Arbeitsausfall
Ein dauerhafter Arbeitsausfall liegt nach der Legaldefinition des § 216 b Abs. 2 SGB III vor,
wenn infolge einer Betriebsänderung die Beschäftigungsmöglichkeit für die Arbeitnehmer
nicht nur vorübergehend entfällt. Die Definition der Betriebsänderung nimmt Bezug auf die
Regelung des § 111 BetrVG, allerdings unabhängig von der Unternehmensgröße, d.h.
Unternehmen mit weniger als in der Regel 20 wahlberechtigten Arbeitnehmern sind umfasst.
Ein dauerhafter Arbeitsausfall ist anzunehmen, wenn unter Berücksichtigung der
Gesamtumstände des Einzelfalles davon auszugehen ist, dass der betroffene Betrieb in
absehbarer Zeit die aufgebauten Arbeitskapazitäten nicht mehr im bisherigen Umfang
benötigt (so auch die bisherige Rechtslage). Neu ist, dass das bisherige
Tatbestandsmerkmal der Erheblichkeit des Arbeitsausfalls (§ 170 SGB III a.F.) entfallen ist,
52
Drittes Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt v. 23.12.2003, BGBl. I 2003, S.
2848 ff.RA’e Hans Stefan Korsch, Fachanwalt f. Arbeitsrecht / Dr. Gunther Mävers (Maître en Droit) 08/2004
Mütze Korsch Rechtsanwaltsgesellschaft mbH - 13 -
was die Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen erleichtern und damit der
Verwaltungsvereinfachung und der Rechtsklarheit dienen soll.
b) Betriebliche Voraussetzungen
Die betrieblichen Voraussetzungen der Gewährung sind in § 216 b Abs. 3 SGB III durch
zwei Merkmale charakterisiert.
Zum einen müssen in einem Betrieb oder in einer Betriebsabteilung
Personalanpassungsmaßnahmen durchgeführt werden. Zum anderen bedarf es zur
Vermeidung von Entlassungen und zur Verbesserung der Eingliederungschancen der
betroffenen Arbeitnehmer der Überführung derselben in eine betriebsorganisatorisch
eigenständige Einheit (beE). Auf das bisherige Merkmal der Strukturkrise (bisher: § 175
SGB III a.F.). wird verzichtet. Indem somit allein auf die betriebliche Ebene abgestellt wird,
wird die Möglichkeit der Schaffung von Transfergesellschaften für alle betrieblichen
Restrukturierungsprozesse geöffnet.
Der Anspruch ist gem. § 216 b Abs. 7 SGB III ausgeschlossen, wenn die Arbeitnehmer nur
vorübergehend in der betriebsorganisatorisch eigenständigen Einheit zusammengefasst
werden, um anschließend einen anderen Arbeitsplatz in dem gleichen oder einem anderen
Betrieb des Unternehmens oder im Falle der Konzernzugehörigkeit in einem Betrieb eines
anderen Konzernunternehmens des Konzerns zu besetzen. Diese Neuregelung soll
Missbrauchstatbeständen vorbeugen; die Nutzung des Transfer-Kurzarbeitergeldes zur
Finanzierung spezifischer Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen im
Eigeninteresse des Unternehmens zu Lasten der Beitragszahler wird ausgeschlossen.
c) Persönliche Voraussetzungen
Zur Erfüllung der persönlichen Voraussetzungen für die Gewährung bedarf es der
nachfolgenden vier Tatbestandsmerkmale.
Der Arbeitnehmer
• muss von Arbeitslosigkeit bedroht sein,
• muss nach Beginn des Arbeitsausfalls entweder eine versicherungspflichtige
Beschäftigung fortsetzen oder im Anschluss an die Beendigung eines
Berufsausbildungsverhältnisses aufnehmen,
• darf nicht vom Kurzarbeitergeldbezug ausgeschlossen sein und
• (neu!) muss vor der Überleitung in die betriebsorganisatorische Einheit aus Anlass
der Betriebsänderung an einer arbeitsmarktlich zweckmäßigen Maßnahme zur
Feststellung der Eingliederungsaussichten teilgenommen haben (sog. Profiling-
Modul); können in berechtigten Ausnahmefällen trotz Mithilfe der Agentur für Arbeit
die notwendigen Feststellungsmaßnahmen nicht rechtzeitig durchgeführt werden,RA’e Hans Stefan Korsch, Fachanwalt f. Arbeitsrecht / Dr. Gunther Mävers (Maître en Droit) 08/2004
Mütze Korsch Rechtsanwaltsgesellschaft mbH - 14 -
sind diese im unmittelbaren Anschluss an die Überleitung innerhalb eines Monates
nachzuholen
Hierdurch soll sichergestellt werden, dass die betroffenen Arbeitnehmer in die Lage versetzt
werden, die eigenen Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt besser einschätzen zu können und
sich ggf. entscheiden, an nach Maßgabe des § 216 a SGB III förderungswürdigen
Transfermaßnahmen teilzunehmen. Der Eintritt in eine betriebsorganisatorische Einheit soll
damit schwer vermittelbaren Arbeitnehmern vorbehalten bleiben. Den
Gesetzgebungsmaterialien lässt sich eine eher restriktive Tendenz entnehmen: hiernach
sollen die in § 216 b Abs. 4 Nr. 4 SGB III genannten Ausnahmefälle nur vorliegen, wenn die
Entscheidung der Betriebsparteien zur Einrichtung einer in der Regel externen
betriebsorganisatorisch eigenständigen Einheit unverschuldet so kurzfristig erfolgt, dass
trotz Einschaltung der Agentur für Arbeit selbst bei vorhandener Infrastruktur eine qualitative
Maßnahme der Eignungsfeststellung im Vorfeld nicht mehr durchführbar ist.
Ob die Durchführung der Feststellungsmaßnahmen im nachhinein nur ein Ausnahmefall
oder in der betrieblichen Praxis eher der Regelfall sein wird, bleibt gleichwohl abzuwarten.
Sollte die Bundesagentur für Arbeit diesen Punkt restriktiv handhaben, wird dies sicherlich
zu einer Verteuerung der Restrukturierungsprozesse führen, weil nach erfolgter Einigung der
Betriebsparteien dieser Prozess dem Übergang der Arbeitnehmer in die
Transfergesellschaften vorgelagert werden müsste. In dieser Zeit bleiben die von der
Restrukturierung betroffenen Arbeitnehmer auf der pay roll des Unternehmens. Unklar ist
darüber hinaus, welche Kriterien im Hinblick auf die „Feststellung der
Eingliederungsaussichten“ Anwendung finden. Es wird auch zu klären sein, ob diese
Feststellungen nur durch die Bundesagentur für Arbeit oder auch sonstige qualifizierte Dritte
vorgenommen werden dürfen.
Im übrigen gelten die Regelungen des § 172 Abs. 1 a - 3 SGB III über die Gewährung von
Kurzarbeitergeld im Krankheitsfall sowie über die dort normierten Ausschlusstatbestände
entsprechend.
d) Bezugsfrist
Bis zum 31.12.2003 konnte Struktur-Kurzarbeitergeld in einer betriebsorganisatorisch
eigenständigen Einheit für die Dauer von max. 24 Monaten bezogen werden53. Mit Wirkung
ab dem 01.01.2004 ist dies bis zum 30.06.2005 fortan nun mehr für max. 15 Monate
möglich. Im daran anschließenden Förderzeitraum vom 01.07.2005 bis 30.06.2006 ist ein
verlängerter Bezug von konjunkturellem Kurzarbeitergeld für maximal 12 Monate möglich.54
53
Vgl. die aufgrund der Ermächtigungsgrundlage des § 182 Nr. 3 SGB III erlassenen Verordnung
über die Bezugsfrist des Kurzarbeitergeldes vom 15.01.2003, BGBl. 2003 I, S. 89 ff.
54
Quelle:
http://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Navigation/Presse/tagesnachrichten,did=28664.htm
l#28660RA’e Hans Stefan Korsch, Fachanwalt f. Arbeitsrecht / Dr. Gunther Mävers (Maître en Droit) 08/2004
Mütze Korsch Rechtsanwaltsgesellschaft mbH - 15 -
Dem liegt die richtige Überlegung zugrunde, dass die Eingliederungschancen von Beziehern
von Transfer-Kurzarbeitergeld durch eine längere Bezugsfrist nicht steigen. Die Erfahrung
der Praxis zeigt vielmehr, dass bei einem Teil der Betroffenen die Bereitschaft, sich intensiv
um einen neuen Arbeitsplatz zu bemühen, in den letzten Monat der Zugehörigkeit zu einer
Beschäftigungsgesellschaft deutlich steigt. Dies korrespondiert im übrigen mit den
Änderungen im Bereich des Arbeitslosengeldbezuges und soll nach der
Gesetzesbegründung einer Frühverrentung effektiv entgegenwirken.55
e) Verfahren
Da § 216 b SGB III im wesentlichen auf die für das "klassische" Kurzarbeitergeld
anwendbaren Vorschriften verweist, ergeben sich bezüglich Anzeige und Antragstellung
keine Besonderheiten; insoweit kann auf die obigen Ausführungen verwiesen werden,
insbesondere auch betreffend die Berechnung des Transferkurzarbeitergeldes. Die Praxis
hat gezeigt, dass eine rechtzeitige Kontaktaufnahme mit den zuständigen Stellen bei der
Agentur für Arbeit - z.B. noch während der Interessenausgleichs- und
Sozialplanverhandlungen - für die Beschleunigung des Verfahrens ratsam und hilfreich ist.
Liegen die Voraussetzungen für die Gewährung von Transfer-Kurzarbeitergeld vor, haben
die Bezugsberechtigen Anspruch auf Zahlung von Kurzarbeitergeld für die Dauer von max.
12 Monaten.
Während des Bezuges von Transferkurzarbeitergeld hat der Arbeitgeber den Arbeitnehmern
gem. § 216 b Abs. 6 SGB III Vermittlungsvorschläge zu unterbreiten. Die bisherige Praxis -
so lautet es in der Gesetzesbegründung - habe gezeigt, dass vielfach bei fehlenden äußeren
Vermittlungsimpulsen die Zeit des Bezuges von Kurzarbeitergeld oft ungenutzt verstrichen
ist und in Einzelfällen sogar zu einer Verschlechterung der Eingliederungsperspektive der
betroffenen Arbeitnehmer geführt hat. Hier soll die Neuregelung Abhilfe schaffen und
gewährleisten, dass Arbeitnehmer aktiv zur Eigeninitiative angespornt werden und nicht die
Verweildauer in der BQG als "sozial abgefedertes Auslaufen" des
Beschäftigungsverhältnisses ansehen. Hat die Maßnahme zur Feststellung der
Eingliederungsaussichten ergeben, dass Qualifizierungsdefizite bestehen, soll der
Arbeitgeber geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Eingliederungsaussichten
anbieten. Insoweit kommt aufgrund der Neuregelung auch eine Beschäftigung zum Zwecke
der Qualifizierung bei einem anderen Arbeitgeber, deren Zulässigkeit früher umstritten war,
für die Dauer von bis zu 6 Monaten in Betracht.
55
Letzteres wurde bspw. vom Deutschen Beamtenbund im Rahmen der öffentlichen Anhörung
von Sachverständigen in Berlin am 07.10.2003 kritisch beurteilt, vgl. BT-Drucks. 15(9)645, S.
16. Zur Eindämmung der Frühverrentungspraxis - so lautet es in der Stellungnahme - möge
zwar auch mit der Gestaltung der Instrumente im Leistungsrecht und in der Arbeitsmarktpolitik
zusammenhängen. Es erscheine jedoch vorrangig, einen Einstellungswandel in deutschen
Personalbüros herbeizuführen; die Kürzung von Leistungen für Betroffene gehe am Problem
vorbei. Kritisch zu der Neuregelung auch die Stellungnahme der IG Metall vom 18.08.2003, S. 4.RA’e Hans Stefan Korsch, Fachanwalt f. Arbeitsrecht / Dr. Gunther Mävers (Maître en Droit) 08/2004
Mütze Korsch Rechtsanwaltsgesellschaft mbH - 16 -
§ 216 b Abs. 9 SGB III verpflichtet schließlich den Arbeitgeber, der Agentur für Arbeit jeweils
zum Stichtag 30. Juni und 31. Dezember eines Jahres unverzüglich Daten über die Struktur
der betriebsorganisatorisch eigenständigen Einheit, die Zahl der darin zusammengefassten
Arbeitnehmer sowie Angaben über die Altersstruktur und die Integrationsquote der Bezieher
von Transferkurzarbeitergeld zuzuleiten.
2. Errichtung und Funktionsweise einer BQG
Die BQG wird – soweit sie nicht bereits existiert – durch Betriebsvereinbarung im Rahmen
des Interessenausgleichs zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat geplant. Regelmäßig
handelt es sich um eine externe BQG. Insoweit gibt es zwischenzeitlich eine Vielzahl von
Anbietern.
Die Errichtung einer unternehmensinternen BQG ist schon aus Gründen der gewünschten
endgültigen und optischen Trennung nicht zu empfehlen. Darüber hinaus wird das etwaige
Risiko aus § 613 a BGB vermieden.
Es ist dringend zu empfehlen, bereits vor Abschluss des Interessenausgleichs – möglichst
gemeinsam mit dem Betriebsrat – vorab mit der zuständigen Agentur für Arbeit die Chancen
für die Genehmigung der BQG und deren Förderungsmöglichkeiten im Detail abzustimmen.
Je besser diese Abstimmung erfolgt ist, um so problemloser ist im nachhinein die weitere
Abwicklung.
a) Dreiseitiger Vertrag AG-AN-BQG
Zur Überführung der von der Restrukturierungsmaßnahme betroffenen Arbeitnehmer in die
BQG bedarf es zunächst eines sog. dreiseitigen Vertrages, der zwischen Arbeitgeber,
Arbeitnehmer und der BQG geschlossen wird.
b) Arbeitsvertrag AN-BQG
Teil des dreiseitigen Vertrages ist das Angebot der BQG an die Arbeitnehmer zum
Abschluss eines Arbeitsvertrages auf Basis „Kurzarbeit Null“. In der Praxis werden die
diesbezüglichen Angebote an die betroffenen Arbeitnehmer mit einer Annahmefrist von max.
2 Wochen verbunden. Die Erfahrung zeigt, dass in der Regel ein sehr hoher Prozentsatz der
Arbeitnehmer bereit ist, das unterbreitete Angebot fristgemäß anzunehmen. So
unterzeichneten im Falle der Dörries-Scharmann etwa 96 % der Beschäftigten nur einen Tag
nach der Betriebsversammlung, in welcher das Konstrukt der BQG vorgestellt wurde, das
vorgelegte Angebot.56 Die Akzeptanz der BQG für die Arbeitnehmer ist zum einen mit der
Weiterbeschäftigung für einen Zeitraum von derzeit bis zu 15 Monaten mit der damit
verbundenen Qualifizierung und Weiterbildung und der gleichzeitigen Vermeidung der
56
BAG, Urteil v. 10.12.1998 - Az.: 8 AZR 324/97 -, NZA 1999, 422 ff.RA’e Hans Stefan Korsch, Fachanwalt f. Arbeitsrecht / Dr. Gunther Mävers (Maître en Droit) 08/2004 Mütze Korsch Rechtsanwaltsgesellschaft mbH - 17 - Arbeitslosigkeit verbunden; zum anderen erfolgt regelmäßig die Abfindungszahlung quasi mit Vertragsunterzeichnung, weil die Überführung in die BQG ohne Einhaltung der Kündigungsfrist erfolgt. Nicht zuletzt besteht nach Abschluss des Interessenausgleichs auch ein erheblicher Druck sowohl seitens des Arbeitgebers als auch des Betriebsrats sowie der Gewerkschaften, der mit der Unabwendbarkeit der Durchführung der Maßnahme und den Risiken eines etwaigen nachfolgenden Kündigungsschutzprozesses begründet wird. 3. Aufgaben der BQG a) Beschäftigung der eintretenden AN Aufgabe der BQG ist, die in ihr verweilenden Arbeitnehmer zu beschäftigen. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um eine Beschäftigung herkömmlicher Art; primäre Aufgabe der BQG ist vielmehr die Qualifizierung der in ihr verweilenden Arbeitnehmer. b) Qualifizierung der eintretenden AN Nur wenn Qualifizierungsmaßnahmen im qualitativ wie quantitativ hinreichenden Maße durchgeführt werden, hat die Errichtung und Unterhaltung einer BQG arbeitsmarktpolitischen Erfolg. Erfahrungsgemäß scheidet sich hier die Spreu vom Weizen im Hinblick auf die Anbieter von BQG’s. Der auf den ersten Blick „teure“ Anbieter kann im Ergebnis für alle Beteiligten der günstigere Anbieter sein. Auf Grund qualifizierter Vermittlung findet der Arbeitnehmer schneller einen neuen Arbeitsplatz; auf der anderen Seite reduzieren sich die Kosten der BQG für den Arbeitgeber. Das Spektrum der Qualifizierungsmaßnahmen ist groß; typischerweise werden folgende Maßnahmen der Förderung durchgeführt: - Potenzialanalyse - Aufbereitung der Bewerbsunterlagen - Training - Einzelgespräche - Kontaktanbahnung - Job-Center - Thementage - Vorträge - etc. Dies bedarf einer ständigen personellen Betreuung und Begleitung der in der BQG verweilenden Arbeitnehmer. Die erfolgreiche Durchführung der Qualifizierungsmaßnahmen - und insbesondere auch der Wiedervermittlung in den Arbeitsmarkt (dazu sogleich unten c) - hängt insbesondere von einer intensiven Betreuung der zu qualifizierenden Arbeitnehmer ab. Nur wenn zwischen den Betreuern der BQG und den Arbeitnehmern ein enger und
RA’e Hans Stefan Korsch, Fachanwalt f. Arbeitsrecht / Dr. Gunther Mävers (Maître en Droit) 08/2004
Mütze Korsch Rechtsanwaltsgesellschaft mbH - 18 -
fortdauernder Kontakt besteht, tritt der gewünschte Erfolg ein. Die Arbeitnehmer sind im
Rahmen des Anstellungsvertrages zu verpflichten, die Qualifizierungsangebote
wahrzunehmen. Verstöße gegen diese Verpflichtung können im Extremfall die fristlose
Kündigung des Beschäftigungsvertrages mit der BQG zur Folge haben.
Auch wenn die Agentur für Arbeit es zur Anerkennung der Förderungsfähigkeit als
ausreichend erachtet, wenn derartige Qualifizierungsmaßnahmen in monatlichen Abständen
durchgeführt werden, zeigt die Praxis, dass aus Qualifizierungsmaßnahmen resultierende
Ermittlungserfolge signifikant höher sind, je intensiver die Betreuung der betroffenen
Arbeitnehmer ist.
Statistische Erhebungen belegen, dass in einer BQG mit intensiver Betreuung und
geeigneten Qualifizierungsmaßnahmen regelmäßig bereits in den ersten Monaten ca. 50 %
der betroffenen Arbeitnehmer zu vermitteln sind.
4. Finanzierung / Refinanzierung der BQG
Die Möglichkeiten der Finanzierung der BQG machen einen wesentlichen Teil ihres Erfolges
aus; die Finanzierung basiert auf zwei Säulen: Leistungen der Agentur für Arbeit einerseits
und des (ehemaligen) Arbeitgebers andererseits.
a) Finanzierung durch Leistungen der Agentur für Arbeit
Zum einen werden die Kosten für eine BQG von der Bundesagentur für Arbeit durch
Erstattung des Kurzarbeitergeldes bzw. Transferkurzarbeitergeldes in der gesetzlich
vorgesehenen Höhe getragen. Insoweit kann auf die obigen Ausführungen verwiesen
werden.
b) Finanzierung durch Leistungen des Arbeitgebers
Die zweite finanzielle Säule der BQG sind die Leistungen des ehemaligen Arbeitgebers.
Diese werden als Remanenzkosten bezeichnet. Zu den Remanenzkosten gehören
• etwaige Aufstockungsbeiträge auf das Kurzarbeitergeld, z. Bsp. auf 80 % des letzten
Nettogehaltes
• sämtliche Sozialversicherungsbeiträge (die Aufstockungsbeträge sind nicht
sozialversicherungspflichtig, vgl. § 2 Abs. 2 Nr. 4 Arbeitsentgeltverordnung57)
• Urlaubs, Feiertags- und Weihnachtsgeldbezüge (diese trägt der Arbeitgeber in voller
Höhe, da insoweit kein Kurzarbeitergeld gezahlt wird)
• die Kosten der BQG und der Qualifizierungsmaßnahmen (2000,- ¼ELV 5000,- ¼SUR
Mitarbeiter)
57
Quelle: http://www.bmgs.bund.de/download/gesetze_web/arbevo/arbeitsentgeltverordnung.htmSie können auch lesen