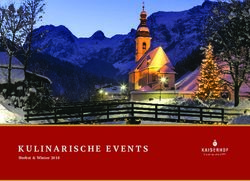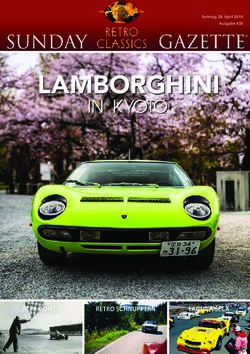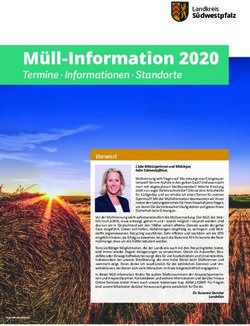Traum auf vier Rädern - Elektroauto - TFF Forum
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Elektroauto Traum auf vier Rädern Eine Koalition aus Politikern, Autobauern und Stromkonzernen bauscht das Potenzial des Elektroautos maßlos auf. Tatsächlich wird es wohl ein Nischenprodukt bleiben Von Dietmar H. Lamparter und Fritz Vorholz 8. Juli 2008, 14:50 UhrAktualisiert am 7. Dezember 2013, 11:33 UhrQuelle: DIE ZEIT, 2008-07- 03T12:00Z Nr. 2844 Kommentare Viele Normalverdiener fühlen sich heute zu einem luxuriösen Lebensstil regelrecht verdammt. Sie müssen Auto fahren, können es sich aber nicht mehr leisten. Das Elend buchstabiert sich so: Einmal volltanken. Was dann an der Kasse folgt, das tut vielen Arbeitnehmern und Rentnern richtig weh. Denn Sprit ist so teuer wie nie zuvor. Da erscheint es vielen tröstlich, dass diese Qual bald ein Ende finden könnte. Dass man den teuren Sprit nicht mehr braucht, um mit dem Auto voranzukommen. Das versprechen unisono Industrielenker und Politiker. Grüne, Schwarze und Rote. Freunde der Sonnenenergie und Fans von Atomstrom. Die Mobilität der Zukunft, dieser Konsens eint eine große und täglich wachsende Koalition, kommt aus der Steckdose – und zwar deutlich billiger als aus der Zapfpistole. Und sie ist bereits zu besichtigen. Angela Merkel und die anderen Staats- und Regierungschefs der G-8-Nationen, die sich kommende Woche zu ihrem Gipfeltreffen im japanischen Hokkaido versammeln, können sich als Testpiloten eines Elektrofahrzeugs betätigen. Toyota will ihnen ein Stromauto überlassen. Es fährt vor allem mit Saft aus der Steckdose und nur noch ein bisschen mit dem Saft, der die Mächtigen nervt wie keine andere Substanz: Öl. Der Rohstoff ist knapp und teuer, das ist eine Gefahr für die Weltkonjunktur und ärgert die Wähler. Obendrein heizt Öl die Erde auf. Es ist nach Kohle die zweitgrößte Quelle von klimaschädlichem CO₂, und das meiste Öl verbrennt in Automotoren. Steckdosenautos dagegen sind CO₂-frei, jedenfalls dann, wenn sie klimaverträglich erzeugten Strom tanken: Windstrom, Sonnenstrom, Atomstrom. Deshalb elektrisiert der Gedanke an die elektrische Mobilität die Mächtigen – schließlich versprechen sie seit Jahren, den Treibhauseffekt zu bekämpfen, und zwar mittels "innovativer Technologien", wie es nächste Woche in ihrem Kommuniqué heißen wird. Viele beschwören das Stromauto, darunter solche, die gestern der Autogemeinde noch Wasserstoff und Biosprit als saubere Alternativen zum Benzin verschreiben wollten. Kaum hat sich der Sprit vom Acker als desaströse Therapie gegen die Ölabhängigkeit erwiesen, schwärmen sie ebenso unbekümmert vom Strom und nähren die Hoffnung, damit ließe sich die gewohnte individuelle Mobilität auf vier Rädern kostengünstig und umweltschonend sichern, quasi auf ewig. Tatsächlich bildet sich da eine unheilige Allianz. In ihr finden sich Politiker jeglicher Couleur zusammen, die einen neuen Hoffnungswert für die Wähler brauchen. Autobauer, die den politischen Druck ablenken wollen, indem sie endlich Produkte anbieten, denen das ultimative Ökosiegel gebührt. Und die unbeliebten
Stromproduzenten, die nicht nur auf der Suche nach neuen Geschäftsmodellen sind, sondern auch ein neues Image anstreben – Klimaretter statt Monopolisten. Die Hoffnung dürfte sich indes schon bald als unbegründet erweisen. Die Batterien, ohne die sich kein elektrisches Auto bewegt, sind selbst in der neuesten Entwicklungsstufe nicht nur sehr teuer und kaum praxiserprobt, sondern auch aufgrund ihres hohen Gewichts nur für kleinere Autos und kurze Strecken geeignet; und es sieht nicht danach aus, als könnten die Innovatoren bald schon einen weiteren technischen Durchbruch schaffen. Es wird deshalb wohl noch sehr lange dauern, bis der Traum vom universell einsetzbaren Elektroauto Wirklichkeit wird – "wenn überhaupt", wie ein Fachmann eines süddeutschen Autokonzerns sagt. Inoffiziell, versteht sich. Offiziell kämpft die Autoindustrie verbissen gegen scharfe CO₂-Grenzwerte und erweckt gleichzeitig den Eindruck, die Erlösung vom Öl sei schon fast Realität. Tatsächlich sind an diversen Orten Elektromobile zu besichtigen. Zum Beispiel in London. 100 elektrisch angetriebene Smart schnurren dort durch die City. Der Strom, den sie brauchen, kostet kaum mehr als einen Euro für eine Batterieladung. Bei gesitteter Fahrweise reicht sie für gut 100 Kilometer. Obendrein erspart die EKlasse der anderen Art ihrem Besitzer die saftige Citymaut, die in London für CO₂- Schleudern inzwischen fällig wird. Auch in Paris, in Berlin und anderswo werden bald e Urinzelne Elektrofahrzeuge zu sichten sein und nicht nur Stromerzeuger, sondern auch Umweltschützer erfreuen. Tatsächlich macht sich der World Wide Fund for Nature ebenso für die elektrische Mobilität stark wie die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie, die Bundesregierung, die sich in ihrem Klimaschutzprogramm der Förderung der Elektromobilität verschrieben hat, ebenso wie Volkswagen und Daimler, E.on und RWE. Und "unsere besten Verbündeten sind die Grünen", sagt ein Spitzenfunktionär des Verbandes der hiesigen Stromwirtschaft. Jeder will dabei sein, auch in den USA. Dort tut sich das Forschungsinstitut der Stromwirtschaft mit einer großen Umweltorganisation zusammen. Deren Studie sagt, Steckdosenautos hätten das Zeug dazu, "substanziell" zum Klimaschutz beizutragen. Eine Bürgerinitiative namens Plug in America rührt gleichfalls die Trommel für die vermeintlichen Zukunftsfahrzeuge. Das Fieber der elektrischen Mobilität hat längst auch China erfasst. Von der Partei- und Staatsführung ist die Sache bereits zu einem "Megaprojekt" erklärt worden. Und hierzulande gaben vergangene Woche VW, E.on, Batteriehersteller und eine Handvoll weiterer Partner den Startschuss für den ersten großen Flottenversuch mit Autos, die zum Tanken vor allem eine gewöhnliche Steckdose brauchen. Bundesumweltminister Sigmar Gabrielsagte anlässlich der Präsentation des blauen E-Golf im VW-Salon an der Berliner Prachtmeile Unter den Linden: "Wir werfen einen Blick in die Zukunft – und die beginnt nicht übermorgen, sondern heute." VW- Chef Martin Winterkorn tönte: "Die Zukunft wird den Elektromotoren gehören – betankt aus der Steckdose."
Toyota hat 1,5 Millionen Autos mit Elektrohilfsmotoren verkauft Gabriel und Winterkorn strickten da gemeinsam an einer Legende. Die ersten der 20 sowohl mit Elektro- als auch mit Verbrennungsmotor ausgestatteten Steckdosen- Golf, die an dem Flottenversuch teilnehmen sollen, wird VW nicht vor Anfang 2010 liefern. Von Serienproduktion ist vorerst gar keine Rede. Auch andere Hersteller sparen nicht mit hochfliegenden Ankündigungen. Daimler- Chef Dieter Zetsche kündigte gerade an, dass die Stuttgarter 2010 den Elektro-Smart und ein Mercedes-Modell, wohl die A-Klasse, mit der neuesten Batterietechnik auf den Markt bringen wollen. Und Carlos Ghosn, der Chef von Nissan und Renault, will die Konkurrenz mit massivem Elektroautoeinsatz in Japan und in den USA ausstechen. Zudem hat sich Ghosn mit dem ehemaligen SAP-Manager Shai Agassi verbündet und will ihm für zwei ambitionierte Großprojekte, bei denen bis 2011 ganz Israel und Dänemark mit Ladestationen überzogen werden sollen, die E-Autos liefern. Der US-Autoriese General Motors setzt alles daran, bis dahin seinen Chevrolet Volt auf den Markt zu bringen. Das Rettungsauto für den Konzern, dessen Spritschlucker sich nicht mehr verkaufen, kann an der Steckdose betankt werden, hat aber sicherheitshalber einen kleinen Benzinmotor an Bord (siehe Interview Seite 20). Selbst Branchenprimus Toyota, der bereits 1,5 Millionen Hybridautos – ausgestattet sowohl mit Benzin- wie mit Elektromotor – verkauft hat, will nachladen. Denn klassische Hybridfahrzeuge beziehen ihre Ursprungsenergie bislang ausschließlich aus dem Benzin- oder Dieseltank. Nur die beim Bremsen zurückgewonnene Energie kann verbrauchsmindernd elektrisch abgefahren werden. Deshalb will auch Toyota von 2010 an mehrere Modelle zusätzlich für die Aufladung an der Steckdose ausrüsten. "Beim Elektroauto müssen alle großen Hersteller mit", beschreibt Wolfgang Bernhart, vom Beratungsunternehmen Roland Berger den neuen Branchentrend. Auch die potenzielle Kundschaft glaubt bereits an die elektrische Mobilität, wie eine vom Autozulieferer Continental in Auftrag gegebene Umfrage in acht Ländern von Deutschland über China bis hin zu den USA ergab. "Mehr als 45 Prozent zeigen sich offen für ein Elektroauto im Stadtverkehr", berichtet Conti-Technologievorstand Karl-Thomas Neumann. Der Zulieferer investiert derzeit heftig in die Fertigung neuer Akkus und will Mercedes nächstes Jahr "die erste Lithium-Ionen-Batterie in einem Automobil" liefern. Wer wollte den Autofahrern ihr Interesse an E-Autos verdenken? Ein herkömmliches Fahrzeug – Durchschnittsverbrauch: sechs Liter – verursacht Spritkosten in Höhe von rund neun Euro pro 100 Kilometer. Ein vergleichbares Elektromobil braucht 20 Kilowattstunden Strom, die nach Marktpreis mit kaum mehr als vier Euro zu Buche schlagen. Elektromotoren arbeiten eben effizienter als Verbrennungsmotoren; allerdings entstehen in den üblichen Wärmekraftwerken immense Energieverluste. Zudem langt der Fiskus bei Benzin und Diesel deutlich kräftiger zu als bei Strom. Als Massenphänomen könnte sich der deutsche Finanzminister das E-Auto derzeit gar nicht leisten. Und doch spricht es für die Elektrofahrzeuge, dass sie sich fast emissionsfrei bewegen – jedenfalls dann, wenn die Akkus mit regenerativem Strom aufgeladen werden. Doch selbst wenn sie mit Strom aus neuen Steinkohlekraftwerken versorgt würden,
entsprächen die Emissionen nur ungefähr denen eines herkömmlichen Benzin- oder Dieselfahrzeugs, heißt es in einer für das Umweltministerium angefertigten Expertise. Kommt allerdings Atomstrom in den Elektrotank, hat der Umweltminister ein Problem. CO₂-frei führe das Elektroauto zwar auch dann noch, nur eben politisch nicht korrekt – jedenfalls nicht, solange die SPD am Atomausstieg festhält. Die Sache mit dem Elektroauto sei deshalb "ein Spiel mit dem Feuer", sagt einer von Gabriels Mitarbeitern. Doch das ist das geringste Problem, wie man erfährt, wenn man sich in der Fahrzeugindustrie genauer umhört. "Der Knackpunkt ist die Batterie", sagt Franz Fehrenbach, der Chef des Autozulieferers Bosch, der soeben ein Joint Venture mit dem südkoreanischen Batteriehersteller Samsung verabredet hat, um Lithium-Ionen- Akkus zu bauen. Zwar können derartige Batterien, die bisher nur in Mobiltelefonen, Laptops oder Bohrschraubern eingesetzt werden, bei gleicher Größe ungleich mehr Energie speichern als die üblicherweise im Fahrzeugbau verwendete alte Technik. Aber gemessen an den Anforderungen des Autofahrens können auch die modernen Energiespeicher keine Wunder vollbringen. Selbst die beste Batterie kann mit Benzin, Diesel oder Gas als Energiespeicher nicht annähernd mithalten. Der deutsche Ingenieur Frank Weber, der für General Motors den strombetriebenen Chevrolet Volt entwickelt, räumt ein: Die nutzbare Energie der 180 Kilogramm schweren Lithium- Ionen-Batterie entspreche "vier Liter Benzin". Vier Liter! Aber könnte nicht vielleicht der nächste Technologiesprung das Problem lösen? Der sei unwahrscheinlich, meinen Experten. Der rein batterieelektrische Betrieb habe Grenzen, sagt Herbert Kohler, Daimlers oberster Antriebsforscher. Natürlich werde es noch Optimierungen geben können, aber bei etwa 200 Kilometer Reichweite sei auf absehbare Zeit Schluss. Ein ähnlicher Sprung wie von der alten auf die neue Batterietechnik sei nach der Logik der Elektrochemie schlicht nicht mehr zu erwarten, doziert der Professor. Dass sich die Autobranche offiziell trotzdem für das E-Auto begeistert, hat profane Gründe. Sie reagiert auf politischen Druck und wittert neue Konkurrenz. So verpflichtet Kalifornien die großen Autobauer dazu, in den Jahren 2012 bis 2014 mindestens 7500 Elektro- oder Brennstoffzellenautos sowie 66000 Hybridfahrzeuge anzubieten. Kalifornien ist für Daimler und Co. einer der wichtigsten Automobilmärkte der Welt. Am Kardinalproblem kommt niemand vorbei: Elektroautos fahren nicht weit Aufgeschreckt wurden die Autochefs auch dadurch, dass Branchenfremde wie der chinesische Batteriehersteller BYD mit eigenen Autos in ihren Markt eindringen wollen und dass Newcomer wie die kalifornische Firma Tesla Motors sie plötzlich alt aussehen ließen. Die Tesla-Leute pflanzten einem leichten britischen Sportwagen einen E-Motor und einen dicken Packen Lithium-Ionen-Batterien ein – und begeisterten die Schickeria Kaliforniens mit dem ökologisch korrekten Roadster. Doch am Kardinalproblem der Reichweite kommen sie alle nicht vorbei. Selbst nicht der Chef des Autobauer-Verbandes in Deutschland, Matthias Wissmann, der zwar die großen Anstrengungen seiner Industrie für das vermeintliche Zukunftsauto lobt, aber zugibt, dass die bisherige E-Technik "die Ansprüche der Kunden an Reichweite und Praktikabilität nicht erfüllen kann".
Auch wenn sein Smart die neuesten Batterien erhalte, komme er mit einer Ladung höchstens 160 Kilometer weit, und der Akku wiege auch dann noch 160 Kilo, sagt der Daimler-Batterieexperte Christian Mohrdieck. Mehr Reichweite bedeutet noch mehr Pfunde. Und wolle man einer Mercedes-S-Klasse zu einer adäquaten Reichweite verhelfen, würde allein die Batterie 700 bis 800 Kilo wiegen, erklärt Mohrdieck. Sein Schluss: Stromer mit Batterie haben nur in Kleinwagen wie dem Smart oder der nächstgrößeren Klasse eine Chance. Deshalb setzen viele Hersteller bei größeren Autos auf zwei Motoren, einen elektrischen und einen herkömmlichen. Zu allem Übel dauert es bis zu acht Stunden, das Energieäquivalent von vier Liter Benzin in Form von Strom aus einer Steckdose zu saugen. Und was ist mit zügigem Batterietausch in speziellen Wechselstationen, wie sie Shai Agassis Project Better Place in Israel und Dänemark errichten will? Alain Uyttenhoven, Statthalter von Toyota in Deutschland, fühlt sich dabei an den "Pferdewechsel in der Postkutschenzeit" erinnert. 200 Kilo Gewicht, Hochspannung, der unabdingbare Anschluss an das Kühlsystem des Fahrzeugs, das alles mache eine technisch aufwendige Infrastruktur mit geschultem Personal nötig. Schnellladestationen scheinen auch keine probate Lösung für das Reichweitenproblem: Je schneller geladen wird, desto kürzer die Haltbarkeit der Batterie, sagen die Experten. "Man darf nicht glauben, dass das batteriebetriebene Elektroauto alle Probleme lösen wird, wir werden damit in absehbarer Zeit nicht von München nach Hamburg fahren, auch nicht mit austauschbarer Batterie", sagt der Conti-Vorstand Karl-Thomas Neumann. Überdies können auch die modernen Batterien überhitzen und sich entzünden, was bereits zu Rückrufaktionen von Laptopakkus geführt hat. Autos müssen sie ein Autoleben lang, also zehn Jahre, sicher mit Strom versorgen. Geht das? Continental weist alle Bedenken ebenso zurück wie General Motors. Die Gewissheit überrascht ein wenig. Denn wie man Lebensdauerversuche mit neuen Batterien macht, wisse niemand so recht, sagt Gerold Neumann vom Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie (ISIT) in Itzehoe. Bleibt der Aufpreis des vermeintlichen Zukunftsautos. Analysten der Deutschen Bank haben ihn bereits ausgerechnet: zusätzlich 11000 Dollar für das reine Elektroauto. Das durch billigeres Tanken wieder hereinzuholen wird extrem schwer. Der Aufschlag wird sich auch nicht so schnell verringern, weil die Absatzzahlen laut den Bankanalysten gering bleiben: Im Jahr 2020 werden demnach in Europa ganze fünf Prozent aller neu zugelassenen Fahrzeuge Stromer sein; in den USA sieben Prozent. Wolfgang Bernhart von Roland Berger, ist da zwar optimistischer. Seine Prognose, bis zu 25 Prozent Steckdosenautos bei Neuwagen im Jahr 2020, gilt aber nur, wenn die Batteriepreise sich wie erwartet bis dahin halbieren; anderenfalls ginge die Entwicklung "noch stärker hin zu kleinen Fahrzeugen mit konventionellem Antrieb". Als eleganter Ausweg aus der Preismisere schwebt Shai Agassi ein System wie heute beim Mobiltelefon vor: Der Kunde bekommt das Auto gestellt und bezahlt für die gefahrenen Kilometer. Doch wer finanziert die Infrastruktur und die Autos vor? Wer spielt sozusagen die Rolle der Telekom? Die Stromversorger, Start-ups wie Agassis Project Better Place? Nicht von ungefähr sei Agassi bei Daimler, Toyota und GM abgeblitzt, weiß ein Automanager. Dass die deutschen Hersteller von teuren und prestigeträchtigen Autos auf die Idee nicht anspringen, ist klar. Für sie ist es unvorstellbar, ihre Autos zu verschenken, da würde ihr Geschäftsmodell implodieren.
Erst hoffte man auf Wasserstoffautos, dann auf Biosprit – vergebens Je näher man sich die E-Auto-Bewegung anschaut, desto mehr zerfällt sie. Bosch- Chef Fehrenbach glaubt zwar, dass der Durchbruch für das elektrische Fahren da ist, warnt aber vor zu viel Euphorie: "Es gibt noch einige, nicht triviale technische Hürden zu überwinden." Deshalb sei es bei Bosch klar, dass man parallel weiter Diesel- und Benzinantriebe optimieren müsse, um den Verbrauch und die Emission zu reduzieren. In den alten Antrieben liege noch großes Potenzial. "In den nächsten 20 Jahren werden effiziente Verbrennungsmotoren weiterhin die dominante Rolle im Automobil spielen", sagt Fehrenbach. Nicht nur ein Autozulieferer, auch die Gesellschaft muss sich also überlegen, ob sie ihr Geld und ihre Energie aufwendet, um spritsparende Benziner zu entwickeln – oder um auf den Hoffnungswert E-Auto zu setzen. Hype hin oder her. "Batteriebetriebene Elektroautos werden in erster Linie eine Anwendung für den urbanen Verkehr darstellen", prophezeit Daimler Forschungschef Herbert Kohler. Deshalb stecken die Stuttgarter weiterhin sehr viel Geld in effizientere Diesel- und Benzinmotoren. Was technisch in absehbarer Zeit möglich ist, konnte Kohler jüngst im sonnigen Sevilla demonstrieren. Dort drehte der F 700 seine Runden. Das Forschungsauto in S-Klasse-Größe verbraucht nur 5,3 Liter Benzin pro 100 Kilometer – die Hälfte der aktuellen Serienmodelle. Es ginge bei vielen Autos noch einfacher. Wenige Stunden bevor VW-Chef Winterkorn vergangene Woche in Berlin seinen Steckdosen-Golf zeigte, stand vor dem Bundespresseamt ein anderer Golf, silbern mit schwarzer Motorhaube und 170 PS darunter. Serienmäßig verbraucht der Renner 7,2 Liter. Die Version, die im Auftrag des Umweltbundesamtes leicht modifiziert wurde, kommt mit fast einem Viertel weniger aus. Mehrkosten bei Serienproduktion: voraussichtlich nur ein paar Hundert Euro. Es ist noch gar nicht lange her, da sollte Wasserstoff die Autogemeinde von Erdöl und Umweltsorgen befreien. Opel tourte mit einem Hydrogen-Zafira durchs Land, Mercedes mit einer umgebauten A-Klasse. Im Jahr 2000 taten sich Politik und Wirtschaft zusammen und entwarfen die "Verkehrswirtschaftliche Energie Strategie", kurz VES. Bis 2007/08 könne ein "flächendeckendes Netz" von 2000 Tankstellen mit alternativen Treibstoffen zur Verfügung stehen, hoffte man. 2003 verkündeten die Chefs von General Motors und der Tochterfirma Opel, man wolle "als erster Hersteller das Ziel von einer Million verkaufter wasserstoffbetriebener Fahrzeuge erreichen". Ergebnis: Weltweit sind nur einige Hundert Hydrogenfahrzeuge von Mercedes, BMW, Honda oder GM im Einsatz, Testfahrzeuge bei Kurierdiensten, Behörden oder Stadtwerken. Schwerwiegende technische Probleme sind ungelöst. Tatsächlich gibt es im Sommer 2008 in ganz Deutschland gerade einmal fünf Wasserstofftankstellen. Gleichwohl setzt Daimler langfristig für längere Reichweiten und größere Autos auf diese Technik, nicht auf Batteriestrom. Der Biosprit-Hype war noch kürzer. Im Januar 2005 kündigte George W. Bush bei seiner Rede an die Nation an, den Benzinverbrauch bis zum Jahr 2010 um 20 Prozent verringern zu wollen, hauptsächlich durch Beimischung von Biokraftstoff. Tatsächlich ersetzen Bioethanol und Biodiesel in Nordamerika und Europa mittlerweile rund eine Million Fass Erdöl pro Tag. Doch als Folge sind die Getreidepreise explodiert, Hungeraufstände der Armen machen Schlagzeilen, und eine weltweite Allianz gegen den Sprit vom Acker ist aktiv. Die Euphorie hat sich vollständig verflüchtigt.
Sie können auch lesen